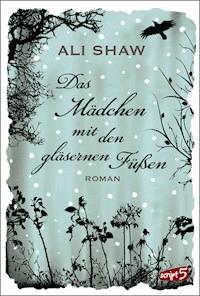Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zu gerne wäre Ida wie die Anderen: mutig, kontaktfreudig und spontan. Doch das ist sie nun mal nicht. Nicht nur weil sie um Facebook und Partys einen großen Bogen macht. Sondern vor allem, weil sie wöchentlich bei einer Therapeutin sitzt und über ihre Krankheit spricht. Idas größte Angst ist, sich für immer verloren zu haben. Dann begegnet sie Ben, der nach außen hin all das zu sein scheint, was Ida nicht ist: selbstbewusst, sarkastisch und eine Spur zu abwehrend. Doch auch in ihm herrschen Zweifel und die Paranoia, verletzt zu werden. Denn Ben hat eine tragische Vergangenheit. Erst als ihnen bewusst wird, dass sie gar nicht so verschieden sind, machen sie gemeinsam einen Schritt aus der Dunkelheit heraus und versuchen es mit der Welt aufzunehmen. Und sie schlagen sich so viel besser, als sie angenommen haben. Auf ihre ganz eigene Art. Ein Buch über die erste Liebe, Flaschenpost und fliegende rosa Elefanten am Himmel. Ein Buch voller Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Mama
Du hast mir immer gesagt,
dass ich meinen Weg eines Tages finden werde.
Ohne dich wär ich nicht da, wo ich heute bin.
Du gibst mir die Kraft, die mich manchmal verlässt.
Dein kleiner Finger eingehakt in meinen und ich weiß,
dass ich für alles bereit bin.
Playlist
Snow Patrol (Sleeping At Last/ The Wind And The Wave) – Chasing Cars
Simple Plan – Welcome To My Life
Sleeping At Last – All Through The Night
Thom – The One
Bon Iver – Skinny Love
Frida Gold – Langsam
We The Kings ft. Elena Coats – Sad Song
TRIGGERWARNUNG
Liebe/r Leser/innen,
ich weise darauf hin, dass »Wir sehen die fliegenden rosa Elefanten«
Passagen und Inhalte enthalten, die triggern könnten.
Triggerwarnung vor:
Depression, Trauer, Tod, Suizid, Suizidgedanken, Ängste – Bitte lest die Geschichte nur dann, wenn ihr emotional mit diesen Themen umgehen könnt.
Ida und Ben:
Jeder für sich ist ein Totalausfall,
zusammen sind sie eine riesige Katastrophe.
Dennoch geben sie sich gegenseitig das Gefühl,
nicht komplett allein zu sein.
Und ist das nicht das Allergrößte?
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Nachwort
Danksagung
Prolog
Tagebucheintrag
Warum ist das Leben nur so schwer? Eine ziemlich berechtigte Frage, die sich garantiert viele stellen. Aber gibt es darauf auch eine Antwort?
Wahrscheinlich ist man selbst die Ursache für all die Schwierigkeiten. Schließlich schafft man sich eine ganze Menge Ängste und Zweifel an, die übers eigene Leben bestimmen. Aber bei dem Versuch, sie zu bekämpfen, scheitert man kläglich.
Wie sehr man sich auch anstrengt, man landet doch nur auf dem Boden! Und während man aufzustehen versucht, bilden die Ängste einen Kreis um einen herum und fangen höhnisch an zu lachen. Dieses Lachen wird immer lauter und lauter, bis es jeder hören kann. Manche versuchen, es zu ignorieren, und gehen einfach weiter.
Aber dann gibt es da noch die andere Sorte Menschen. Diejenigen, die sich dran erfreuen, andere am Boden zu sehen. Das gibt ihnen den ultimativen Kick, ein Gefühl der Überlegenheit. Und in diesem einen Moment sind sie es auch.
Man selbst liegt am Boden und lässt einen Haufen abfällige Bemerkungen über sich ergehen.
Und plötzlich kommt einem der Gedanke, weshalb das Leben einem so einen Mist zumutet. Warum greift es nicht ein und befreit einen aus dieser dämlichen Lage?
Aber anscheinend hält das Leben es nicht für nötig. Stattdessen setzt es noch einen drauf. Gerade wenn man sich aufgerappelt und die lachende Meute hinter sich gelassen hat, fällt man wieder hin. Vor lauter Tränen hat man den Stein nicht gesehen, der mitten auf dem Weg lag.
Und während das höhnische Gelächter wieder losgeht, hat man nur einen einzigen Gedanken: Tut mir echt leid, liebes Leben, aber ich muss dir sagen, dass du echt beschissen bist!
Kapitel 1
Verzweifelt knallte ich den Laptop zu und versuchte, nicht an heute Morgen zu denken. Doch mein Hirn ließ nicht locker und konfrontierte mich weiter mit der Tatsache, dass ich nicht dazugehörte. Ich erinnerte mich, dass ich inmitten einer lärmenden Klasse saß und mir vorkam wie ein Niemand unter Gleichaltrigen, die so viel mehr wussten, wie ein Leben zu führen war. Ich fühlte mich fremd. Fremd in meiner eigenen Haut und in allem, was mich umgab. Selbst hier, in meinem vertrauten Zimmer, musste ich erdulden, wie verwirrte Gedanken im Schnelldurchlauf durch meinen Kopf rasten.
Dabei fühlte ich mich sonst sicher in meinen eigenen vier Wänden. Ich mochte die apricotfarbene Tapete, die in einem freundlichen Ton erstrahlte, wenn die Sonne durch das Fenster schien. Dieser Anblick erinnerte mich an den Gran-Canaria-Urlaub mit meiner Familie, bei dem wir auf einer Mauer saßen und einen wunderschönen Sonnenuntergang zu Gesicht bekamen. Ein wohlig-warmes Gefühl spiegelte die äußere Schönheit in mir wieder, während ein ganz normaler Tagesrhythmus sich dem Ende neigte. Heute fehlte von diesem Empfinden allerdings jegliche Spur, von den hellen Strahlen ganz zu schweigen. Die Düsternis hatte mich wieder vollständig umhüllt.
Als ich vor die Vitrine neben den Kleiderschrank trat, fiel mein Blick auf die Schneekugelsammlung. Mit zehn hatte ich mein erstes Exemplar geschenkt bekommen, und seitdem war ich eine leidenschaftliche Sammlerin. Es beruhigte und faszinierte mich zugleich, hinter das Glas zu schauen, auf eine andere kleine Welt, viel friedlicher als meine eigene. Doch heute fiel es mir schwer, darin etwas Tröstendes zu sehen.
Um mich abzulenken, schaltete ich den Fernseher an. Zwei ziemlich korpulente Frauen stritten sich gerade darüber, welche Diät sie als Nächstes ausprobieren sollten. Es war fünf Uhr nachmittags, und der Bildschirm triefte nur so vor Assi-TV!
Da ich heute nicht in der Stimmung war, mir die gespielten Probleme von Amateurschauspielern anzuhören, schaltete ich schnell um. Doch auf den anderen Sendern kam auch nichts, das meine klammernden Zweifel in Schach halten konnte. Schließlich kam ich wieder bei den Diät-Frauen an, die sich immer noch nicht einig waren. Zu allem Überfluss tanzten jetzt auch noch die Männer der beiden an. Sie drohten mit der Scheidung, da sie ihre Frauen zu dick fanden. Es entstand eine riesige Diskussion, und bevor mein Gehirn irgendeinen Schaden nehmen konnte, drückte ich den Knopf zum Ausschalten.
Ich musste mir etwas anderes zum Ablenken suchen. Zwei schreiende Frauen mit vermeintlichen Gewichtsproblemen schafften es nicht, dass mein Gehirn aufhörte, in die Tiefen meines Gedankenozeans einzutauchen. Sie hatten eher dafür gesorgt, dass es Feuer fing und fast explodierte. Sofort stellte ich mir vor, wie meine Gehirnmasse durch die Gegend flog. Sehr verlockend!
Ich nahm mein Handy aus der Hosentasche und startete die Playlist. Sofort erklang die Stimme des Sängers meiner Lieblingsband. Musik half doch immer gegen böse Gedanken, oder nicht?
Aber heute standen die Chancen nicht gut. Nach ein paar Songs musste ich feststellen, dass mich selbst »Simple Plan« nicht aufheitern konnte. Oh, Gott! Was konnte ich nur tun?
Unruhig geisterte ich im Zimmer umher. Langsam fing es in meinen Armen an zu kribbeln. Erst nur wenig, dann immer mehr. Mein Atem ging schneller. Meine Hände zitterten. Tränen traten mir in die Augen. »Bleib ruhig, Ida«, sagte ich zu mir.
Doch meine Worte erreichten mich nicht mehr. Mittlerweile hatte ich das Gefühl, dass mir die Luft im Inneren wegblieb. Benommen stützte ich mich an der Wand ab. »Mama«, schrie ich, so laut ich konnte. »Mama, bitte komm!«
Als ich mich zitternd aufs Sofa setzte und das Gesicht in ein Kissen drückte, merkte ich, wie meine Mutter mich in eine schützende Umarmung zog. Schon verringerte sich meine Angst ein wenig. Doch die Kontrolle über meinen Körper erlangte ich nicht zurück.
Erst nach einer halben Stunde hatte ich mich langsam wieder beruhigt. Mein Puls ging ruhiger, und das Zittern war fast vollkommen verschwunden. Tränen kullerten mir über die Wangen. Wieder einmal konnte ich nicht begreifen, was passiert war. Obwohl ich solche Situationen schon oft erlebt hatte, war ich ratlos und verzweifelt.
»Geht’s wieder, mein Schatz?«
Ich nickte langsam. Erst jetzt bemerkte ich den traurigen und erschöpften Gesichtsausdruck meiner Mutter. Auch sie konnte nicht begreifen, was sich soeben abgespielt hatte. Dabei war ihr Leben mittlerweile genauso durcheinandergewürfelt worden. Gebückt saß sie neben mir. Wie schon all die vielen Male zuvor, in denen sie sich zu mir herüberbeugte und mit dem Oberkörper versuchte, mein Zittern zu unterdrücken. Doch sie dachte gar nicht daran, mich mit meinem inneren Schmerz alleinzulassen.
»Willst du über deine Sorgen reden?«
Nein, wollte ich nicht. Aber nicht, weil ich mich dafür schämte, sondern eher, weil ich meine Ma nicht damit belasten wollte. Ich gab schon seit einer ganzen Weile mein Bestes, die Probleme ohne fremde Hilfe in den Griff zu bekommen. Tief in mir wusste ich, dass daraus nichts werden würde. Wenn der Schmerz in deiner Seele so gigantisch wird, dass er ihre Beständigkeit niederreißt und ihre Bedeutsamkeit mit Dunkelheit befleckt, brauchst du jemanden, der dich in deinen zertrümmerten Einzelteilen auffängt. Und dann musst du die Kraft in dir finden, um sie wieder zusammenzusetzen.
»Nein, ich schaff das schon. Es ist eigentlich gar nichts. Ich werde jetzt schlafen gehen, und morgen ist alles wieder gut.« Oh Mann, das war die größte Lüge aller Zeiten.
»Bist du dir wirklich sicher?«
»Ja, natürlich! So was von – tausendprozentig sicher!« Viel zu übertrieben, Ida, sagte ich in Gedanken zu mir selbst.
»Aber versprich mir: Sobald du dir wieder Sorgen machst, kommst du zu mir, und wir sprechen darüber.«
»Versprochen!«
Dann ließ sie mich alleine.
Nachdem sich das Zimmer wieder mit endloser Leere gefüllt hatte, krabbelte ich in mein Bett und hielt mich mit der Kraft, die mir noch geblieben war, an der Decke fest. In dem Moment war sie der Rettungsanker meines inneren Bewusstseins. Meine letzte Stütze um mich von der Vorstellung abzuhalten, die Erde ohne ihre gewohnte Schwerkraft vor meinem inneren Auge wahrzunehmen und dabei zuzusehen, wie sie die Schwächsten mit einer Lässigkeit abschüttelte.
Und dann, ganz plötzlich, sah ich mich inmitten von starken Gestalten, die aufrecht standen, während ich an einem bröckelnden Zipfel hing und in das dunkle Nichts starrte. Ich schlug mich tapfer, auch wenn ich es mir nicht eingestand. Ich kämpfte für meine Berechtigung, hier zu sein. In einem Hier und Jetzt, das viel von mir abverlangte und mich gleichzeitig erden wollte. Meine Hand leistete einen harten Dienst und blieb standhaft in ihren Bemühungen, sich festzukrallen.
Doch irgendwann verlor alles und jeder seine Stärke, sobald die Aussicht auf Besserung in der Grube voller Opfer landete, die vom eigenen Kampf zerstört worden waren und in deren Antlitz man seine eigene Zukunft sah.
Und so ließ ich los und fiel in ein bodenloses Ende.
Später, kurz vor dem Einschlafen, wurde mir in monströser Härte bewusst, dass meine Krankheit mich fest im Griff hatte. Dass sie mir nicht nur die Luft abschnitt, sondern auch einen Keil zwischen mich und mein Leben trieb. Die Angstattacken, die mich quälten, raubten mir die gesamte Energie und ließen eine leere Hülle meiner selbst zurück, die von niemandem beachtet wie die abgestreifte Haut einer Schlange auf dem Boden liegen blieb. Tief in mir wusste ich, dass sich dringend etwas ändern musste, damit ich nicht vollständig die Kontrolle über meine Existenz verlor.
Kapitel 2
Ich stand im Bad und starrte in den Spiegel. Ein ganz normales Mädchen, das sein langes blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte und in dessen Gesicht eine leichte Stupsnase thronte, starrte mir entgegen.
Doch als ich genauer hinsah, konnte ich einen Menschen erkennen, der schon zu lange einen Krieg mit sich selbst führte, für den er falsch ausgerüstet war. Ab und zu, das wusste ich, tauchte ein verzerrtes Lächeln auf, und auch ein Funkeln in den Augen, damit niemand an dem Gesicht zweifelte oder gar glaubte, dass das Mädchen etwas zu verbergen hatte. Doch die Augen blieben trotz des Schauspiels ausdruckslos, so wie fast alles an mir. Ein letztes Mal starrte ich mein Spiegelbild an und schnitt mir selbst eine Grimasse und rannte aus meinem Zimmer.
Unten am Treppenabsatz wurde ich vom süßesten Hund der Welt begrüßt. Vor fast fünf Jahren, als sich meine Krankheit enorm verschlimmerte, hatte ich fast jeden Tag an Angstattacken gelitten, die mir oft jede Lebensfreude nahmen. Daraufhin hatten meine Eltern mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllt und mir einen Hund gekauft. Seitdem lebte Dina bei uns, eine schwarze Labradorhündin, mein ganz persönlicher Mutmacher. Mit ihrer verrückten, vorwitzigen Art brachte sie mich immer wieder zum Lachen, sodass es mir gleich etwas besser ging.
»Morgen, Dina! Oh, nicht so stürmisch!«
Sie sprang erfreut um mich herum und wedelte wie wild mit dem Schwanz. Von dieser lebensfrohen Art kannst du dir einiges abschauen, dachte ich bei mir.
»Guten Morgen, Schatz.« Meine Mutter trat aus der Küche und sah mich besorgt an. »Geht’s dir heute schon besser?«
»Schon viel besser«, log ich.
Ich schwindelte nicht oft. Wirklich nicht. Aber es war die Antwort, die meine Mutter hören wollte. Also tat ich ihr den Gefallen, damit ich einmal weniger ihren mitleidigen Blick ertragen musste. Zusammen setzten wir uns an den Frühstückstisch, an dem der Rest der Familie schon wartete.
Eigentlich bekam ich morgens meist keinen Bissen hinunter. Aber heute hatte ich einen Heißhunger auf Nutella. Schokolade sollte ja bekanntlich glücklich machen. Und das wollte ich werden – glücklich!
»Heut schlägst du dir aber ordentlich den Bauch voll. Was ist los mit dir?« Tim, mein Bruder, sah mich erstaunt an.
Was sollte ich darauf antworten? Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich mir von dem Nutellabrötchen gute Laune erhoffte. Meine Familie würde sofort wissen, dass ich mich nicht gut fühlte, und wieder Panik schieben.
Also entschied ich mich dafür, nichts zu sagen und so zu tun, als hätte ich die Frage überhört. Zu meinem Glück ging Tim nicht weiter darauf ein.
Doch zu früh gefreut. Gleich kam die zweite unangenehme Frage, die noch viel schlimmer für mich war.
»Freust du dich auf die Schule?«
Nicht sein Ernst, oder? Oh Mann, so was konnte nur von meinem Vater kommen! Ich wusste, dass meine Eltern es nur gut mit mir meinten. Sie taten alles, um mir ein glückliches und sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Sie kämpften mit mir gegen meine Krankheit an. Doch es gab einen entscheidenden Punkt, der alles erschwerte und den niemand wirklich wahrhaben wollte: Die unterschiedlichen Seiten, auf denen wir standen, würden niemals miteinander verschmelzen. Klar, wir waren eine Familie – und so sollte es auch bis an unser Lebensende bleiben. Das änderte aber nichts daran, dass es aussichtslos blieb, dass sie jemals vollständig verstehen würden, wie es sich anfühlte, an einer Krankheit des Geistes zu leiden oder Momente am Abgrund zu erleben, nach denen nichts mehr wie zuvor war. Genauso konnte ich nicht im Entferntesten wissen, was es bedeutete, ein Kind zu haben, das sich quasi in Einzelteilen fortbewegte und in dessen Augen sich der Wunsch nach Erlösung widerspiegelte.
Bevor ich eine für alle zufriedenstellende Antwort geben konnte, kam mein Bruder mir zuvor. In Momenten wie diesem liebte ich ihn mehr als jeden anderen Menschen.
»Gestern hab ich so ’ne Show geguckt. Es ging um zwei dicke Frauen, die sich drum gestritten haben, welche Diät sie als Nächstes ausprobieren sollten. Und, Leute, es ist wirklich kaum zu glauben: Am Ende haben die sich tatsächlich auf ’ne Nutella-Diät geeinigt!« Tim bekam sich vor Lachen kaum ein.
Meine Eltern konnten seinen Humor nicht teilen und schüttelten nur verständnislos den Kopf.
Wow, die zwei verrückten Hühner hatten es tatsächlich geschafft, sich zu einigen. Vermutlich nur, damit sich ihre beknackten Ehemänner nicht scheiden ließen. Ich grinste in mich hinein.
Als ich die Haustür hinter mir zuknallte, bekam ich es mit der Angst zu tun. Wie sollte ich den Tag bloß überstehen? Banales Gerede, das mich ermüdete. Blicke, die mich verunsicherten. Handlungen anderer Leute, die ich in Frage stellte.
Augenblicklich verlangsamte ich meinen Gang. Nahezu niemand ging gerne zur Schule. Das war in meinem Alter eigentlich auch in Ordnung, aber ich ging nicht nur ungern zur Schule, ich hatte blanke Panik.
Erstens weil ich mich vor Klassenarbeiten, Referaten und Projekten so unter Druck setzte und Angstzustände bekam, dass ich nicht mehr normal denken konnte, was in solchen Situationen ziemlich ungünstig war. Doch es fiel mir schwer dagegen anzukämpfen. Meine Krankheit sabotierte mich, und ich ließ mich darauf ein, woraufhin ihre Macht nur noch größer wurde.
Außerdem waren die Schüler in meiner Klasse ein großes Problem. Ständig mussten sie über diejenigen herziehen, die in ihren Augen »anders« aussahen oder andere Lebenseinstellungen hatten. Vermutlich zerfetzten sie sich auch über mich die Mäuler. Ich war schließlich richtig anders. Natürlich hatten sie keinen Schimmer, dass ich unter einer psychischen Krankheit litt. Doch ich war mir sicher, dass sie meine Angst spüren konnten.
Wenn mit einem etwas nicht stimmt, wird man augenblicklich in die »Iiih-du-bist-anders!«-Schublade katapultiert. Dort ist es eng und stockdunkel. Es gibt keinen Platz, um sich zu entfalten. Alles, was du tun kannst, ist, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass dich niemand so schnell befreien wird. Die Leute denken meist, sie würden alles über dich wissen und deshalb wäre es unnötig, die Schublade noch mal aufzuziehen, um dich richtig kennenzulernen. Sie sehen in dir nur den Freak mit tausend Schwächen. Aber deine Stärken werden sie nie genauso leicht herausfinden können, wie sie dich verurteilt haben. Und damit steht dir eine furchtbare Aufgabe bevor: Du musst es in der engen, dunklen Schublade aushalten, bis irgendjemand sie aufzieht, um herauszufinden, wer du wirklich bist.
Aber ich hoffte längst nicht mehr darauf, dass jemand das Interesse haben könnte, mich zu befreien. Mit meinen siebzehn Jahren hatte ich schon viel zu viel Düsternis erlebt, um an den Ritter in der glänzenden Rüstung zu glauben, der zur Rettung auf einem weißen Pferd angeritten kam.
Mittlerweile war ich, obwohl ich getrödelt hatte, an der Haltestelle angekommen. Schließlich konnte ich nicht einfach die Schule schwänzen. Vor seinen Problemen wegzurennen, brachte einem auch keinen Frieden – manchmal musste man sich seinen Ängsten stellen, auch wenn es viel von einem abverlangte. Nur so konnte man sie letztendlich besiegen. Zumindest sagte mir das jeder.
In meinem Leben war das jedoch nicht so leicht umzusetzen. Ich hatte manchmal eine so gewaltige Angst, dass ich keinerlei Kontrolle mehr über meinen Körper hatte. Meine Gedanken spielten dann verrückt, und in den schlimmsten Augenblicken wusste ich nicht mal mehr, wer ich war. Die Panik raubte mir den Verstand.
Oft hatte ich vor ganz normalen Dingen Angst. Zum Beispiel davor, in einen engen Bus zu steigen, wo dann das Gefühl von Beklemmung hochkroch. Oder vor Orten, an denen sich zu viele Menschen aufhielten. Vermutlich war das für viele Leute schwer nachzuempfinden. Aber für mich waren das Situationen, in denen ich gegen meine Angst ankämpfen musste.
Im Bus rutschte ich unruhig auf meinem Sitz hin und her, mein Herz pochte wie wild. Ich hatte das Gefühl, jeder würde mich anstarren, obwohl das nicht der Fall war. Niemand bemerkte mich. Ich war ein unscheinbares graues Mäuschen, das
nicht auffiel. Allerdings änderte dieses Wissen nichts an meinem Grundgefühl.
Fünfzehn Minuten später lief ich mit hängenden Schultern über den Schulhof, den Blick auf den Boden gerichtet. So fühlte ich mich sicherer.
Plötzlich sprang mich jemand von hinten an. Erschrocken drehte ich mich um, musste aber augenblicklich grinsen, als ich in das freche Gesicht blickte. Kathi gehörte zu den wenigen Menschen in meinem Leben, die mich von meinen Problemen ablenken konnten.
»And the winner is: Kaaathiii! Tja, Ida, du weißt ja, was jetzt auf dich zukommt.«
Oh Scheiße, die Wette! Wie hatte ich das nur vergessen können?
Letzte Woche hatte meine Freundin ein Date mit Jan gehabt, einem der heißesten Typen der Schule. Oder besser gesagt, sie hätte eine Verabredung mit ihm haben sollen, denn diese war nicht zustande gekommen. Mein Beitrag daran lag bei 95 Prozent.
Eine Stunde bevor das Date stattfinden sollte, war ich bei Kathi zu Hause gewesen, um sie in Sachen Klamotten zu beraten. Ausgerechnet ich, die kaum was von Mode verstand! Doch eigentlich regelte Kathi diese Dinge allein. Sie hatte nur jemanden gebraucht, dem sie von Jans tollen blauen Augen vorschwärmen konnte.
Um kurz vor acht wurde Kathi nervös. Zu allem Überfluss fiel ihr dann auch noch ein, dass ihre Mutter ihr aufgetragen hatte, Staub zu saugen und die Spülmaschine auszuräumen.
Um meine Freundin zu beruhigen, schlug ich vor, die Arbeit aufzuteilen. Gesagt, getan. Während Kathi das Haus saugte, räumte ich schnell das Geschirr aus. Plötzlich hörte ich einen lauten Knall aus Richtung Wohnzimmer.
Als ich hinüberging, bemerkte ich eine Vase, die zertrümmert auf dem Boden lag. Verwirrt fragte ich mich, wie das sein konnte, denn Kathi war gar nicht im Wohnzimmer gewesen, als die Vase zerscheppert war. Es musste noch jemand im Haus sein! Schnell angelte ich mir den Baseballschläger, der Kathis kleinem Bruder gehörte und in einer Ecke an der Wand lehnte.
Als ich gerade aus dem Zimmer huschen wollte, sah ich einen Schatten auf mich zukommen. Sofort drückte ich mich an die Wand, mit dem Schläger in der Hand auf meinen Einsatz wartend. In dem Moment, als der Einbrecher an mir vorbeigehen wollte, schlug ich zu, so fest ich konnte.
Tja, und mit diesem Schlag vermasselte ich Kathis ganze Abendplanung. Ich hatte keinen Einbrecher niedergeschlagen, sondern ihren Date-Partner. Durch den Lärm des Staubsaugers hatten wir das Klingeln nicht gehört, sodass Jan sich durch die offene Terrassentür selbst hereingelassen hatte. Der Arme musste noch am selben Abend ins Krankenhaus, damit die Platzwunde genäht werden konnte. Kathi schäumte vor Wut, weil Jan danach nicht mehr bereit war, sich mit ihr zu verabreden. Dadurch entstand unser bisher größter Streit, in dem sie mir vorwarf, dass ich viel zu schreckhaft und ängstlich wäre und damit mir und meinem Umfeld ständig schaden würde. Das traf mich hart, schließlich war ihr das Ausmaß meiner Krankheit bewusst.
Verletzt und wütend, wie ich war, hatte ich mich auf ihren Vorschlag eingelassen: eine Wette. Sollte Kathi mich innerhalb einer Woche zehnmal erschrecken, lautete meine Aufgabe, Jan davon zu überzeugen, dass ich an dem Missverständnis schuld war und Kathi eine zweite Chance verdient hatte. Wenn ich allerdings als Siegerin hervorging, durfte Kathi mir nie wieder vorwerfen, dass ich ihr Date ruiniert hatte.
Eigentlich war von Anfang an klar, dass ich verlieren würde. Einen Menschen mit einer Angststörung zu erschrecken, war nicht sonderlich schwer.
»Na, willst du mir nicht gratulieren?«, riss Kathi mich aus den Gedanken.
»Äh, ja. Glückwunsch!«
Meine Freundin wurde hektisch. »Komm, auf zu Jan, dann kannst du alles aufklären.« Sie packte mich am Arm und zog mich hinter sich her.
»Doch nicht jetzt! Das geht nicht!«
»Ach, und warum nicht?« Sie blieb stehen.
»Ich … äh … muss mich erst drauf vorbereiten.« Ich versuchte, Zeit zu gewinnen, als ich merkte, dass Kathi immer ungeduldiger wurde.
»Du musst dich erst drauf vorbereiten? Nicht dein Ernst, Ida!«
Verlegen zog ich die Schultern hoch. »Doch. Ich brauch noch ein bisschen, damit ich mir überlegen kann, was ich sagen werde. In der Pause geh ich zu ihm. Versprochen.«
Kathi schüttelte verständnislos den Kopf. »Weißt du was? Manchmal versteh ich echt nicht, wie dein Hirn tickt.« Gereizt drehte sie sich um und ließ mich allein auf dem Schulhof zurück.
Na toll. Als hatte ich nicht schon genug Sorgen! Jetzt musste ich auch noch meine eingeschnappte Freundin besänftigen und zu einem der coolsten Typen der Schule gehen, um ihm zu sagen, wie leid es mir tat, dass ich ihm eine übergebraten hatte.
Herrje, das würde noch ein lustiger Tag werden! Ich war eigentlich kein Typ für Sarkasmus, aber genau den brauchte ich jetzt, um diesen Tag zu überstehen.
Kapitel 3
Ich ging in die elfte Klasse der Höheren Berufsfachschule. Allerdings nur, weil ich gern Erzieherin werden wollte und es zur Ausbildung gehörte. Sonst wäre mir nie in den Sinn gekommen, noch zwei Jahre länger die Schulbank zu drücken. Nach meinem Realschulabschluss hatte ich ein FSJ – ein »Freiwilliges Soziales Jahr« – im Kindergarten absolviert und dabei festgestellt, dass mir die Arbeit mit den Jungs und Mädels richtig Spaß machte. Obwohl ich damals schon Angst vor den beiden Jahren hatte, die ich wieder lernend verbringen müsste, entschied ich mich für die Ausbildung. Ein großer Fehler, was ich damals ja nicht ahnen konnte.
Linda war meine Freundin – die beste, die ich je hatte. Wir kannten uns schon seit dem Kindergarten. Sie war wunderschön, selbstbewusst und mitfühlend. Die Art von Mädchen, mit dem jeder befreundet sein wollte. Und ich war stolz, dass sie ausgerechnet mich ausgesucht hatte. Zusammen waren wir ein unschlagbares Team. Wir verstanden uns blind und konnten einander komplett vertrauen. In all den Jahren, in denen wir uns kannten, hatte sie niemals aufgehört, mich zu ermutigen. Immer wieder sagte sie mir, wie wichtig es war, niemals aufzugeben. Genau das war wahre Freundschaft.
»Hey, Ida! Na, worüber machst du dir heute Sorgen?«
Mist, Linda merkte einfach alles! »Ist das so offensichtlich?«
»Ziemlich! Du siehst aus, als … als hättest du den coolsten Typen der Schule k.o. geschlagen.«
»Haha. Sehr witzig.«
»Ach komm schon, Ida. Das war doch echt der Knaller! Schade, dass ich nicht dabei war.«
Nun musste ich doch lächeln. »Okay, ein bisschen lustig war’s schon. Aber –«
»Kein Aber«, fiel Linda mir ins Wort. »Geschah dem arroganten Kerl ganz recht.«
Jan war wirklich arrogant. Das erklärte auch seinen schlechten Fahrstil. Er war schon achtzehn, konnte aber sein Auto kaum steuern, weil er meistens zu beschäftigt war, im Rückspiegel seine Frisur zu checken. Kein Witz!
»Auch wenn er ein selbstverliebtes Arschloch ist, hat er das nicht verdient«, sagte ich. »Wegen mir ziert jetzt eine große Narbe seine Stirn. Und jetzt habe ich auch noch die verdammte Wette verloren!« Ich atmete schneller, als vermutlich gut war.
»Du hast die Wette verloren?«
»Ja, gerade eben. Kathi freut sich wie verrückt. Sie ist der festen Annahme, dass ich Jan davon überzeugen kann, dass alles ein großes Versehen war.« Ich verdrehte die Augen.
»Mach dir keine Sorgen. Du gehst in der Pause einfach zu diesem Idioten, entschuldigst dich – und dann hat sich die Sache erledigt«, versuchte Linda, mich zu beruhigen. Erfolglos.
»Irgendwie muss ich’s fertigbringen, dass Kathi eine zweite Chance bekommt. Sonst verzeiht sie mir nie!«
»Das ist doch ihr Problem. Hör auf, dir Sorgen um die Gedanken anderer Leute zu machen«, befahl Linda energisch. »Denk erst mal an dich selbst. Du hast’s schon schwer genug.«
In diesem Moment klingelte es zur ersten Stunde.
»Wir sehen uns in der Pause.« Linda drückte mich und sprintete zu ihrer Klasse.
Jetzt war ich auf mich allein gestellt. Und bevor dieser Gedanke überhaupt in mein Bewusstsein rücken konnte, spürte ich die Angst schon tief in meinem Inneren. Die Angst war ein unfairer Gegner. Erst schlich sie sich ganz langsam an einen heran, und wenn sie dann nah genug war, schnappte sie zu. Dann gab es kein Entkommen, man war ihr hilflos ausgeliefert. Das waren die schrecklichsten Momente. Die Momente, welche am meisten schmerzten.
Als ich in meine Klasse schlurfte, schien mich niemand zu registrieren. Möglichst unauffällig setzte ich mich auf meinen Platz und kramte mein Buch heraus. Zu allem Übel wartete in den ersten beiden Stunden auch noch Mathe auf mich. Schlimmer konnte es nicht mehr werden.
Doch in diesem Augenblick stürmte Sophie in die Klasse und ließ sich auf den leeren Stuhl neben mir plumpsen.
»Du hast heut schon wieder einen Pferdeschwanz! Lass deine Haare doch endlich mal offen – dann würdest du viel besser aussehen!«
Das war ihre Art, mich zu begrüßen: herrisch und etwas zu fordernd. Ständig feuerte sie Tipps für ein optimales Aussehen auf mich nieder.
»Ich trage sie aber lieber zusammen. So fühl ich mich wohler«, rechtfertigte ich mich.
»Mach doch, was du willst.« Eingeschnappt wandte sich Sophie ab und begann, sich in ihrem Handspiegel zu betrachten.
Genervt verdrehte ich die Augen. Hoffentlich würden die ersten beiden Stunden schnell vorübergehen. Doch sofort fiel mir wieder ein, was dann in der Pause auf mich zukommen würde. Augenblicklich verkrampfte sich mein Magen, und ein Gefühl der Übelkeit überkam mich. Hatte ich nicht gesagt, dass dieser Tag echt lustig werden würde?
Und wenn ihr jetzt ganz still gewesen wärt, hättet ihr mich lachen hören.
»Stell dich nicht so an! Du musst doch nur zu ihm rüber und sagen, dass ich nicht so durchgeknallt bin wie meine Psychofreundin.«
»Danke, Kathi, das hat mir jetzt total Mut gemacht.«
Ich sah sie entnervt an.
»Kein Problem. Ich helfe doch immer gern«, entgegnete sie.
Sofort merkte ich meiner Freundin an, dass sie mich aufgrund meiner Unfähigkeit wie alle anderen zu sein, am liebsten erwürgt hätte. Erst machte mich ihr egoistisches Verhalten wütend. Doch sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen. Kathi war zwar manchmal ganz schön anstrengend und konnte verletzend sein, aber genauso oft brachte sie mich zum Lachen, was verhinderte, dass ich zu tief in meine Sorgenwelt hinabtauchte.
»Ida, alles in Ordnung?«, riss Linda mich aus meinen Gedanken.
Als ich gerade antworten wollte, kam mir Kathi zuvor: »Was soll denn mit ihr sein? Sie hat doch noch gar nichts zu ihm gesagt.«
»Du kapierst es echt nicht, oder?«, schnaubte Linda. »Du kannst froh sein, dass Ida so eine gute Freundin ist und dir den Gefallen tut, zu deinem dämlichen Typen zu gehen.«
Es war schön, jemanden auf meiner Seite zu haben. Jemanden, der sich für mich einsetzte und zu mir stand.
»Hey, noch ist er nicht mein Typ! Aber vielleicht steigen ja die Chancen in ein paar Minuten, wenn Ida es diesmal nicht wieder versaut.«
Kathis Wut war förmlich zu spüren und setzte mich noch mehr unter Druck. Ich schluckte schwer.
»Ida, in fünf Minuten ist die Pause vorbei. Jetzt beeil dich«, drängelte Kathi nervös und schubste mich vorwärts.
Zögerlich ging ich in Jans Richtung, meine Hände zitterten.
»Du schaffst das!«, rief Linda mir nach.
Tja, da war ich mir gar nicht so sicher.
Als ich hinter Jan und seinen Kumpels stand, war alles, was ich mir zurechtgelegt hatte, wie ausgelöscht. Ich kramte im hintersten Teil meines Hirns, fand aber keine Worte. Diese Situation machte mich wirklich wahnsinnig!
Standet ihr schon einmal vor einem gut aussehenden Typen, den ihr niedergeschlagen hattet (aus Versehen natürlich), und solltet ihn davon überzeugen, dass eure egoistische Freundin nichts dafür konnte, sondern ihr selbst so durchgeknallt wart? Nein? – Glück gehabt!
Am liebsten hätte ich mich einfach umgedreht und die Flucht ergriffen. Aber das konnte ich Kathi nicht antun.
Also nahm ich all meinen Mut zusammen. Allein die Tatsache, dass ich hier stand, war für eine Außenseiterin wie mich ungemein befremdlich. Doch ich schob das Gefühl beiseite und erinnerte mich daran, eine gute Freundin sein zu wollen. »Hey, Jan«, brachte ich mit bebender Stimme hervor. »Es … äh … tut mir leid, was letzte Woche passiert ist. Ich –«
Weiter kam ich nicht. Jan drehte sich zu mir um und starrte mich feindselig an. Ein gehässiges Lächeln stand auf seinen Lippen, als er sich einschüchternd vor mir aufbaute.
»Hey, Jungs, habt ihr das gehört? Das war die Stimme eines gestörten Psychos!«
Zuerst saß mir der Schock in den Knochen. Doch dann schloss ich die Augen und besann mich darauf, was ich vorhatte. Ich versuchte, mich nicht verunsichern zu lassen, und setzte erneut an. »Ich bin hier, weil –«
»… weil du mir wieder eine reinhauen willst?«, vollendete Jan den Satz und lachte höhnisch auf. »Das würde ich an deiner Stelle lieber lassen. Hier hättest du ziemlich viele Zeugen. Und wenn ich dir einen gut gemeinten Tipp geben darf: Such dir so schnell wie möglich ’nen Psychiater. Den hast du nämlich dringend nötig.«
Das saß. Ein Volltreffer direkt ins Herz. Sofort traten mir Tränen in die Augen.
Wie war es möglich, dass eine Person, die kaum einen Stellenwert im Leben eines anderen hatte, einen mit Worten so sehr verletzen konnte, dass man das Gefühl bekam, innerlich zu zerbrechen?
»0h, guckt mal. Die Psychotante weint«, säuselte Jan und warf mir einen starren Blick zu.
Sofort fingen seine Kumpels an zu lachen. »Das sieht man auch nicht alle Tage«, rief einer von ihnen.
Da war der Punkt erreicht, an dem es zu viel für mich wurde. Ich machte kehrt und entfernte mich wie in Trance einige Schritte von der grölenden Gruppe. Während ich zu realisieren begann, was sich da eben zugetragen hatte, starrte ich Linda und Kathi aus leeren Augen an. Dann nahm ich die Beine in die Hand und rannte so schnell, wie ich noch nie zuvor gerannt war.
Ich nahm alles um mich herum nur verschwommen wahr und fing ab und zu neugierige Blicke auf. Als ich das Schulgebäude erreicht hatte, wo ich mich sicherer fühlte, blieb ich stehen. Nur langsam beruhigte sich mein Puls.
Es war Jans gutes Recht, wütend auf mich zu sein. Aber es war nicht fair von ihm gewesen, mich vor allen anderen so bloßzustellen. Ich hatte ihm noch nicht mal erklären können, dass alles ein riesengroßes Versehen gewesen war! Schluchzend stolperte ich die Treppen hinauf, als mich jemand von der Seite ansprach.
»Hey, Schlägerbraut.«
Augenblicklich fuhr ich herum. Auf dem Fensterbrett neben mir saß ein Junge mit braunen, zerzausten Haaren, der irgendwie verwegen aussah. Er thronte lässig auf dem breiten Fenstersims und lächelte herausfordernd. »Meinst du mich?«, kam es zögernd aus mir heraus, während ich mich irritiert umsah.
»Ja, klar. Du bist doch die, die Jan eine übergebraten hat, oder?«
»Äh, ja …« Verwirrt schaute ich den Jungen an. Das hielt ihn aber nicht davon ab, weiter seine Begeisterung zu zeigen.
»Richtig coole Aktion von dir. Hammerhart.« Sein Grinsen wurde immer breiter.
Ich merkte, wie Ärger in mir hochstieg. Wie zur Hölle konnte der Kerl so etwas von sich geben? »Ist ja schön, dass du dich so darüber freust. Leider kann ich deine Begeisterung nicht ganz teilen. Gerade eben hat er mich nämlich auf offenem Schulhof gedemütigt.«
»Wieso hast du ihm nicht noch eine reingehauen?«, gab er ruhig zurück, rutschte vom Fensterbrett, warf sich seine Tasche über die rechte Schulter und trat auf mich zu.
Ich schüttelte verständnislos den Kopf. »Hey, Moment mal. Dass ich Jan k.o. geschlagen habe, war ein Versehen. Ich würde das keinem Menschen mit Absicht antun!«, brachte ich empört heraus.
Wie konnte dieser Typ nur annehmen, dass ich mich gegenüber weniger sympathischen Menschen immer so verhielt?! Schlägerbraut. Ja, klar!
»Idioten wie Jan würde das sicher nicht schaden. Anders haben die’s nicht verdient.« Er kam einen Schritt näher, in seinen Augen spiegelte sich nun eine Ernsthaftigkeit, die mich durcheinanderbrachte.
Als ich gerade etwas entgegensetzen wollte, stürzten Kathi und Linda die Treppe hoch.
»Ida, alles okay mit dir?« Linda war ziemlich aus der Puste.
Doch Kathi ließ mir keine Zeit zum Antworten. Sie brodelte innerlich, es war nur eine Frage von Sekunden, bis die Vorwürfe wie heiße Lava aus ihr herausströmten.
»Das hast du ja wieder gründlich versaut«, schrie sie. »Du bekommst wirklich nichts auf die Kette!«
Obwohl Kathi richtig temperamentvoll sein konnte, hatte ich sie noch nie so wütend erlebt. Anscheinend lag ihr wirklich etwas an Jan – und nur wegen mir wollte er jetzt nichts mehr von ihr wissen! Das schlechte Gewissen überkam mich erneut.
»Tut mir wirklich leid. Wie kann ich das nur wiedergutmachen?«
»Indem du mich in Ruhe lässt«, schrie meine enttäuschte Freundin und rauschte mit Tränen in den Augen an mir vorbei in den nächsten Gang.
Kurz kam es mir so vor, als hätte sie all das, was uns bis dahin verband, mit sich genommen. Verflucht, das konnte sie doch nicht ernst meinen! Wir waren seit fünf Jahren befreundet, und jetzt sollte alles wegen eines blöden Typens vorbei sein? »Hoffentlich meint sie das nicht so«, brach es panisch aus mir heraus.
»Ach, Quatsch. Kathi kriegt sich wieder ein. Du weißt doch, wie impulsiv sie sein kann. Dann sagt sie Dinge, die sie nicht so meint.« Linda legte mir eine Hand auf die Schulter.
Erleichtert atmete ich aus. »Du hast ja recht. Trotzdem fühl ich mich schuldig. Wie habe ich nur denken können, dass ein Einbrecher im Haus wäre! So was passiert doch nur in Filmen!«
Linda redete mir weiter gut zu. »Sei nicht so hart zu dir. Außerdem ist Kathi genauso schuld wie du. Mal ehrlich: Welcher Mensch fängt kurz vor seinem Date noch an, das Haus zu saugen? – Niemand!«
»Niemand außer Kathi!«, warf ich leise ein.
Sofort mussten wir laut loslachen. Diese ganze Einbrecher-Nummer war echt verrückt. So verrückt, dass es schon wieder lustig war. Und hätte ich nicht so tief in diesem ganzen Schlamassel dringesteckt, hätte ich schon viel früher darüber lachen können.
Es klingelte zur dritten Stunde. Ich drehte mich zu dem seltsamen Typen um, aber er war verschwunden.
»Suchst du jemanden?«, wollte Linda wissen.
»Äh, eben stand hier ein Kerl. Groß, braune Haare, blaue Augen –«
»Also sah er wohl ziemlich gut aus.«
Gute Feststellung, Linda. »Äh, weiß nicht. Kann schon sein.« »Hat er mit dir geredet?«
»Ja, schon.«
»Ich glaub, dir hat gerade jemand ganz schön den Kopf verdreht.«
»Nein! Der Typ hat mich ›Schlägerbraut‹ genannt«, schoss es aus mir heraus. »Das geht mal so was von gar nicht!«
»Schlägerbraut?«, prustete Linda los. »Das ist echt gut! Endlich mal jemand mit Humor.«
»Jaja, echt total lustig«, sagte ich ironisch und verdrehte aufgebracht die Augen.
Nach diesem Horror-Schultag war ich froh, als ich endlich zu Hause ankam. Aber auch hier konnte ich nicht vor meinen Ängsten davonrennen.
Das Schlimmste an einer Angststörung ist, dass sie dich überallhin verfolgt. Sie lässt dich nie lange in Ruhe. Die Angst ist ein ziemlich starker Gegner. Morgens, wenn man aufwacht, ist sie schon da. Sie kommt immer pünktlich zur Arbeit: Frisch und voller Tatendrang macht sie sich daran, einem das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das versucht sie den ganzen Tag.
Aber da auch etwas wie Angst manchmal eine Auszeit brauchte, gönnte sie sich und mir ab und zu eine Pause. Für mich bedeutete das dann eine Zeit ohne Furcht, die schönsten Momente des Tages. Leider waren sie meist viel zu kurz, um sie richtig zu genießen. Die Abende konnten erbarmungslos sein. Zu dieser Zeit war die Angst am stärksten und richtete ihre ganze Kraft gegen mich. Stundenlang machte sie mir das Leben zur Hölle, bevor sie in ihren wohlverdienten Feierabend verschwand und am nächsten Morgen wieder mit Vollgas in den Tag startete.
Manchmal – selten – fuhr sie auch für mehrere Wochen in eine Art Urlaub. Das kam mir wie der reinste Luxus vor, und ich konnte endlich einfach nur leben. Leben ohne Attacken, die mir die Kraft raubten und jedes Mal ein Stück Hoffnung mitnahmen. Leben ohne Panik vor dem nächsten Tag, ohne mir ständig Sorgen zu machen und von tausend Gedanken genervt zu sein, die im Kopf herumschwirrten. Das wünschte ich mir am meisten: ein Leben frei von Sorgen darüber, was andere von mir denken konnten. Den Mut zu finden, so zu sein, wie ich war.
Tja, dieser Mut fehlte mir momentan. Wenn ich könnte, dachte ich manches Mal, dann würde ich ihn mir herbeizaubern. Doch leider war ich keine Schülerin auf Hogwarts, und eine Narbe auf der Stirn hatte ich auch nicht. Was für ein Pech!
Aber ich hatte etwas gefunden, das mir half, meine Krankheit auszuhalten: das Schreiben. In dieser Beschäftigung ging ich auf. Es war die große Bestätigung, die ich mein Leben lang gesucht hatte.
Manchmal überkam mich in dieser schnelllebigen Zeit das Gefühl, nicht wirklich hier zu sein – in einer Welt, die eben nicht für jeden ein guter Ort war und auf der schreckliche Dinge passierten. Gerade in diesen Augenblicken war mein Kopf voll rasender Gedanken, die ich nur ordnen konnte, indem ich mich hinsetzte, die Musik aufdrehte und einfach drauflosschrieb. Dann ergab für mich einen Moment lang alles einen Sinn. Ich ergab einen Sinn.
Tagebucheintrag
Schwere Zeiten. Das sind sie, diese Tage, an denen eine riesengroße Regenwolke über einem hängt und einen auf Schritt und Tritt verfolgt. Die Sicht zum Himmel ist versperrt, kein Lichtstrahl findet seinen Weg hindurch. Der Nebel hüllt einen ganz ein, sodass jeder Schritt ins Ungewisse führt. Aus Angst, vom Weg abzukommen, setzt man sich hin und wartet.
Aber man ist nicht allein. Die Hoffnung ist stets bei einem. Die Hoffnung auf bessere Tage.
Kapitel 4
Am nächsten Tag hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ich ging über den Schulhof, den Blick stets nach unten gerichtet, damit ich bloß nicht auffiel. Nach der gestrigen Aktion mit Jan war ich garantiert das Gesprächsthema Nummer eins. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass um mich herum getuschelt wurde und einige mit dem Finger auf mich zeigten. Ich kam mir vor wie eine Schwerverbrecherin, die zur Todesstrafe verurteilt worden war.
»Hey, Ida. Na, wie geht’s dir heute?« Linda tauchte neben mir auf und legte einen Arm um meine Schulter. »Hast du dich vom Chaos gestern erholt?«
Immer mehr Schüler starrten mich an, was nur dazu führte, dass ich mich noch unwohler fühlte. »Wie denn? Seit gestern reden alle über mich«, sagte ich mit einem Zittern in der Stimme. »Ich wünschte, ich wäre zu Hause geblieben und hätte mich unter meiner Decke verkrochen.«
»Ich finde, du machst es genau richtig. Du stellst dich deinen Problemen, anstatt vor ihnen davonzulaufen.«
Inzwischen waren wir vor meinem Klassenraum angekommen. Mir graute es schon …
»Hast du was von Kathi gehört?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Nein, sie hat sich nicht bei mir gemeldet. Und heute habe ich sie auch noch nicht gesehen.«
»So wütend ist sie noch nie auf mich gewesen. Ich habe ganz schön Mist gebaut.«
»Ach, Quatsch. Kathi regt sich doch immer über die kleinsten Kleinigkeiten auf. Man kann’s ihr nie ganz recht machen.«
»Ja, ich weiß, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen!«
Kathi und ich hatten wirklich schöne Jahre miteinander geteilt, in denen unsere Freundschaft stetig gewachsen war. Im Laufe der Zeit hatten wir uns zwar oft in die Wolle bekommen – meist wegen Dingen, die es nicht wert gewesen waren. Dennoch kam es vor, dass wir uns mehrere Tage ignorierten. Letztendlich rauften wir uns immer wieder zusammen. Doch dieses Mal war es anders. Das spürte ich.
»Hör auf, dir Sorgen zu machen.«
»Mach ich doch gar nicht«, log ich.
»Natürlich. Das sehe ich an deinem Blick.«
»Echt?«
»Ja, genau. An deinem Oh-nein-ich-hab-Scheiße-gebaut-und-jetztgeht-die-Welt-unter-Blick.«
»Ich wusste gar nicht, dass ich den drauf hab. Ist … ist das denn sehr auffällig? Ich meine, sieht man mir an, dass –« Weiter kam ich nicht.
»Stopp, Ida. Jetzt hör aber auf, dir über so sinnlose Sachen den Kopf zu zerbrechen!«
»Das versuche ich ja. Aber … meine Krankheit hindert mich ständig daran!«
»Was ist das nur für eine beschissene Krankheit!« Linda war anzusehen, dass sie plötzlich Mitleid mit mir bekam.
»Weißt du, das frag ich mich jeden einzelnen Tag.«
Als es zur ersten Stunde klingelte, machte sich ein Gefühl starker Nervosität in meinem ganzen Körper breit, hüllte ihn ein und ließ so schnell sicherlich nicht los.
»Jetzt mach nicht so ein betretenes Gesicht, du schaffst das schon. Du musst es positiv sehen: Es sind nur Menschen – so wie du und ich.«
»Das stimmt nicht, Linda! Es ist … ein Raum voller Leute, die einen nach dem Aussehen beurteilen! Leute, für die man Luft ist, wenn man anders ist. Außerdem muss ich jeden Tag neben Sophie sitzen. Das allein ist schon Albtraum genug. Mit ihrem ›Ach Ida, dein Gesicht würde viel besser zur Geltung kommen, wenn du deine Haare offen tragen würdest‹ geht sie mir ziemlich auf die Nerven.«
Linda konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Ja, versteh ich. Aber da hat sie nun mal vollkommen recht. Übrigens solltest du deine Augen unbedingt stärker betonen und dir die Lippen schminken. Am besten in einem leuchtenden Rot«, äffte sie Sophie nach.
Ich lachte kurz auf und stieg dann mit ein. »Genau, und am besten zieh ich mir jetzt täglich einen knappen Minirock an, damit mein Arsch für mehr Aufregung sorgt.«
Linda bekam sich vor Lachen kaum noch ein. »Yeah, jetzt hast du’s kapiert. Das ist die Ida, die ich liebe.«
Nachdem wir uns wieder beruhigt und voneinander verabschiedet hatten, ging ich langsam ins Klassenzimmer und setzte mich neben Sophie.
Nach dem Realschulabschluss hatten Linda, Kathi und ich unterschiedliche Richtungen eingeschlagen, was unsere schulischen und beruflichen Laufbahnen anging. Während ich mich für ein FSJ im Kindergarten entschied, besuchten Linda und Kathi das Wirtschaftsgymnasium, welches direkt neben der berufsbildenden Schule lag, auf die ich nun ging. Ein kleiner Pluspunkt: So war ich nicht vollkommen allein und bekam die beiden wenigstens vor Schulbeginn und in den Pausen zu Gesicht. Denn obwohl ich schon seit zweieinhalb Wochen auf diese Schule ging, hatte ich mich noch kein bisschen eingelebt oder Anschluss bei Mitschülern gefunden. In der Klasse fühlte ich mich alles andere als wohl. Die meisten Lehrer waren ziemlich streng und erwarteten viel, was mich nur noch mehr unter Druck setzte. Ja, diese Schule war nichts für sensible Angsthasen wie mich. Sondern für starke Menschen, die dachten, sie könnten es mit der Welt aufnehmen.
Als ich die Mathesachen aus meinem Rucksack gekramt hatte, schielte ich zu Sophie herüber. Gar nicht ihre Art, mir keine Tipps für ein besseres Aussehen zu geben. Da könnte ich mich daran gewöhnen, dachte ich.
»Hey, Ida, ich habe noch mal über dein Styling nachgedacht.«
Aaah nein! Warum tat sie mir das an?
»Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es deine Entscheidung ist, wie du deine Haare trägst.«
Was? Hatte sie das gerade tatsächlich gesagt?
»Ach wirklich?« Ich starrte sie überrascht an.
»Ja, aber dafür habe ich einen andren Vorschlag.«
Ich wusste es!
»Wie wär’s mit rotem Lippenstift? Der würde dir bestimmt richtig gut stehen. Oder warte … ich hab eine noch viel bessere Idee: Zieh doch einfach mal ’nen Minirock an. Der würde deine Figur total gut betonen!«
Nachdem sie das gesagt hatte, konnte ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen. Es brach einfach aus mir heraus. Ohne dass mir der Gedanke kam, damit Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und die arme Sophie saß völlig verwirrt da und verstand die Welt nicht mehr.
Nachmittags schlenderte ich mit Linda zu den Bussen, wobei wir uns immer noch über Sophies Bemerkung amüsierten.
»Das hat sie wirklich gebracht?«
»Ja, kaum zu glauben«, lachte ich.
»Das bestätigt doch nur, dass in den Hirnen solcher Tussis nicht allzu viel vorgeht.«
»Jetzt sei nicht so fies. Sie hat’s ja nur gut gemeint«, versuchte ich, Sophie nun doch zu verteidigen.
»Ich bin nicht fies. Dass ist eine reine Feststellung«, erklärte Linda in äußerst sachlichem Ton. Ich musste mir ein weiteres Grinsen verkneifen.
Plötzlich riss uns ein Gedränge aus dem Gespräch. Vor uns versammelte sich eine Horde Schüler.
»Was geht da vor?«, fragte ich unsicher. Doch Linda hatte keine Antwort parat.
Vorsichtig drängten wir uns weiter nach vorn, um das Spektakel, das sich da abspielte, besser beobachten zu können. Als wir freie Sicht hatten, stockte mir der Atem. Mitten in dem Kreis an Gaffern stand Jan, aus dessen Nase ein roter Blutschwall floss. Und nicht allzu weit entfernt sah ich den mysteriösen Typen vom Vortag.
»Was ist denn hier los?«, fragte Linda erschrocken.
Wir spitzten die Ohren.
»Na, auf einmal so still, Jan? Bist du so schnell plattzukriegen? Ich habe dir doch erst ein Mal eine reingehauen! Dachte, du hättest mehr drauf!«
»Halt dein Maul, Ben!«, schrie Jan mit wutverzerrtem Gesicht.
Ben – so hieß er also!
»Warum denn? Verträgst du die Wahrheit etwa nicht? Ach, stimmt ja, ich habe total vergessen, dass du das gar nicht gewohnt bist. Deine Kumpels sind ja viel zu feige, um dir die Meinung zu geigen! Das ist echt armselig, wenn du mich fragst.«
»Dich hat aber niemand gefragt. Du bist ein Freak! Meinst du, irgendjemand ist an deiner Meinung interessiert? Außerdem habe ich im Gegensatz zu dir wenigstens Freunde.«
Jan setzte daraufhin eine selbstgefällige Miene auf, und in dem Moment hatte ich keinerlei Schuldgefühle mehr.
»Hast du den Typen schon mal gesehen?«, riss Linda mich aus meinen Gedanken.
Das Gedränge und Geschubse wurde heftiger. Immer mehr Schüler wollten erfahren, was hier vor sich ging.
»Jepp, das ist der Kerl, von dem ich dir gestern erzählt hab.«
»Was!? Mensch, Ida, warum hast du ausgelassen, dass der so verdammt gut aussieht? Der macht Jan noch Konkurrenz. Kein Wunder, dass er ihn nicht leiden kann.«
Linda konnte den Blick nicht mehr von Ben abwenden. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie angefangen hätte zu sabbern.
»Ich glaub nicht, dass es hier grad darum geht, wer der größere Weiberheld ist«, mutmaßte ich.
Linda seufzte. »Ach, Ida, manchmal ist deine Naivität echt süß. Bei Schlägereien geht’s doch immer darum, wer der Größte ist. Das brauchen Kerle für ihr Ego.«
Obwohl Ben ganz alleine dastand, ließ er sich nicht einschüchtern.
»Du hast’s immer noch nicht gecheckt, oder?«, stichelte er weiter. »Es geht nicht darum, wie viele Freunde man hat, wenn alles perfekt ist. Sondern darum, welche zu haben, wenn es einem echt beschissen geht. Von deinen gefakten Schoßhündchen wird keiner da sein. Das wirst du noch früh genug merken.«
Jans Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, seine sonst so sichere Haltung verschwand, als er zurückgab: »Kann ja nicht jeder so ein Glück haben wie du. Dein Daddy ist bestimmt immer für dich da, oder etwa nicht? Genau wie in einer richtigen Vater-Sohn-Beziehung üblich.«
Jetzt blickte ich überhaupt nicht mehr durch. Was hatte Bens Vater damit zu tun?
»Hä, haben wir irgendwas verpasst?« Linda schien genauso verwirrt wie ich.
»Glaub mir, ich versteh genauso wenig wie du!«, raunte ich.
Wahrscheinlich wusste Jan mehr über seinen Gegner, als wir ahnten, und versuchte, das jetzt gegen ihn zu verwenden. Ben, der nun vollkommen regungslos dastand, starrte stur vor sich hin, als Jan fortfuhr.
»Oooh, das habe ich ganz vergessen. Dein Papi kann ja gar nicht für dich da sein, er hat ja Besseres zu tun! So eine Schande aber auch.«
Daraufhin löste Ben sich aus seiner Starre und ging erneut auf Jan los.
Ich zuckte erschrocken zurück, weil mir bewusst wurde, dass Jan absichtlich Bens wunden Punkt getroffen hatte.
Ben verlor jetzt komplett die Kontrolle und schlug mehrmals zu, bis Jan am Boden lag. Es war, als wüsste er nicht mehr, was er tat. Wie wild schlug er einfach immer weiter, ganz mechanisch, als hätte ihn jemand darauf programmiert.
»Linda! Wir müssen irgendwas tun! Wir können doch nicht einfach hier stehen und zusehen?« Ich drückte leicht ihren Arm.
Doch gerade als sie etwas erwidern wollte, traten drei Schüler aus der Menge und zerrten Ben von seinem Opfer weg. Erst jetzt konnte ich sehen, was Jan zu spüren bekommen hatte. Mein Schlag mit dem Baseballschläger war nichts dagegen gewesen. Wohin ich auch sah, überall in Jans Gesicht klebte Blut. Sofort kamen seine Kumpels und halfen ihm auf die Beine.
Mir wurde flau im Magen. Ich war gerade Zeugin von etwas geworden, das ich nicht begreifen konnte und was mir wahnsinnige Angst einjagte.
»Ida, alles okay bei dir? Du siehst aus wie ’ne Leiche.«
Linda sah mich besorgt an.
»Ja, alles gut. Ich glaub, es dauert noch ein bisschen, bis ich kapiere, was hier gerade abging.«
Ben sah immer noch aus, als sei er nicht ganz bei sich. Plötzlich trafen sich unsere Blicke. Voller Feindseligkeit und Hass starrte er mich an. Ich wollte am liebsten wegsehen, doch ich hielt stand. Ich wollte Ben nicht das Gefühl geben, ihn für das, was er gerade getan hatte, zu verurteilen. Ich hatte ja keinen blassen Schimmer, wie es überhaupt dazu gekommen war.
Erst als er den Blick senkte, nutzte ich den Augenblick, um mich abzuwenden und meine Augen auf etwas anderes zu richten. Langsam setzten sich immer mehr Schüler in Bewegung. Die Show war vorbei. Doch ich hatte das Gefühl, festgewachsen zu sein.
»Komm, lass uns gehen. Sonst verpassen wir noch den Bus!«
Linda packte mich am Arm und zog mich hinter sich her, als wusste sie, dass ich es alleine nicht schaffen würde. Als wir ein Stück gegangen waren, hörte ich Jan hasserfüllt schreien:
»Herzlichen Glückwunsch, Ben! Du hast es wirklich geschafft, genau wie dein Vater zu werden. Er wär sicher stolz auf dich.«
Ich schaute über die Schulter. Diesmal ließ Ben sich nicht provozieren und wandte sich ab. Ein Stück weiter blieb er stehen, um auf den Bus zu warten. Er war nicht so übel zugerichtet wie Jan, doch auch er hatte ordentlich was abbekommen. Zwischen all den anderen Jugendlichen kam er mir ziemlich verloren vor, und irgendein Gefühl in mir wollte, dass ich zu ihm ging. Also wagte ich es.
»Bin gleich wieder da.«
»Moment mal, Ida, wo willst du hin?«, rief Linda. Doch sie verstand, bevor ich etwas sagen konnte, und hielt mich fest. »Nein, nicht dein Ernst! Du willst doch nicht wirklich zu diesem Irren gehen – mit dem stimmt was nicht!«
»Vermutlich hast du recht«, pflichtete ich ihr bei. »Aber mit mir doch genauso wenig.«
»Ida, bleib hier.«
Doch ich hatte mich gelöst und war schon auf dem Weg. Keine Ahnung, was mich dazu verleitete, normalerweise war ich nicht so mutig. Doch ich hatte das Gefühl, dass es sein musste.
Als ich vor ihm stand, fing ich jedoch an zu zweifeln. »Hey, äh, vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Wir kennen uns von gestern und …«
»Wie wär’s wenn du den Smalltalk abstellst und sagst, was du wirklich willst«, blaffte er.
Damit hatte ich nicht gerechnet. »T-tut mir leid, aber ich … ich weiß nicht, was du meinst. Ich will doch nur –«
Doch weiter kam ich nicht, denn er unterbrach mich schon wieder. Aus zu Schlitzen geformten Augen sah er mich herablassend an. »Ach, bitte, jetzt stell dich nicht so blöd. Wir wissen doch beide, was du sagen wolltest! ›Wie konntest du das nur tun? Das hat Jan doch nicht verdient! Und Gewalt ist doch nun wirklich keine Lösung!‹ Ganz ehrlich, so was kann ich grad nicht brauchen. Du kennst mich nicht, also sag mir nicht, was ich tun soll und was nicht. Und jetzt verpiss dich.« Sein Blick war vernichtend. »Worauf wartest du? Verschwinde!«
Mit Tränen in den Augen drehte ich mich um und machte mich davon.
Linda hatte alles beobachtet und nahm mich in die Arme.
»Ida, tu mir bitte einen Gefallen und halt dich von diesem Kerl fern«, flüsterte sie. »Es gibt Menschen, die wollen keine Hilfe.«
Aber das half mir nicht. Ich konnte nur denken: Das kann nicht sein! Jeder ist in schweren Zeiten dankbar für Hilfe, oder? Auch wenn man sich noch so sehr einredet, allein klarzukommen, weil man dann niemandem zeigen muss, wie verletzlich und verloren man in Wahrheit ist …
Ich fasste einen Entschluss.
Mir fiel es schon immer schwer, zu akzeptieren, dass die Schule ein mächtiger Bestandteil meines Alltags war. Ich machte mir selbst enormen Druck, eine gute Schülerin zu sein, und meine Krankheit war dabei keine besondere Hilfe. Im Gegenteil, sie erschwerte alles nur.
Wie groß war die Freude gewesen, als ich trotz meiner Angstattacken den Realschulabschluss in der Tasche hatte! Für mich ein Gefühl wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern zusammen. Ein richtiger Tag zum Feiern. Und da durfte ein Glas Sekt natürlich nicht fehlen.
Danach hatte ich meinen ersten Kneipenbesuch mit Linda und Kathi, den ich nicht unbedingt hätte erleben müssen. Die vielen angetrunkenen Leute, der Zigarettenqualm, und die enorme Lautstärke waren dafür verantwortlich, dass ich mir eingestand, dass Discos und Kneipen nicht mein Ding waren.
Statt wie andere in meinem Alter um die Häuser zu ziehen, verbrachte ich die Samstagabende am liebsten mit meinen Eltern vor dem Fernseher oder las ein gutes Buch im Bett. Natürlich konnte ich so nicht mit coolen Wochenend-Erlebnissen protzen, aber die Ruhe half mir dabei, die Intensität meiner Angstattacken wesentlich geringer zu halten. Mir wurde klar, dass ich niemals zu den unbeschwerten, feuchtfröhlichen Partygängern dazugehören würde. Genauso wurde mir bewusst, dass ich ein introvertierter Mensch war, der eben viel Zeit für sich selbst brauchte. Manchmal war es enorm hilfreich, sich Wahrheiten einzugestehen. Es konnte befreien, einen weiterbringen. Es konnte einem helfen, herauszufinden, wer zu Hölle man eigentlich sein wollte.
An diesem Abend festigte sich mein Entschluss vom Nachmittag, nicht mehr in die Schule zurückzukehren. Es ging nicht nur darum, dass ich mich dort unwohl fühlte. Ich hatte auch dieses tiefe Grundgefühl, dass es falsch wäre, dort weiter hinzugehen. Außerdem war ich mir schon länger nicht mehr sicher, ob Erzieherin der richtige Beruf für mich sein würde. Ich wusste, dass man dafür eine starke, stabile Persönlichkeit sein musste – und ich war alles andere als das. Wie sollte ich Kinder zu selbstbewussten Menschen erziehen, wenn ich selbst keiner zu sein schien!
Aber das war längst nicht alles. Ich hatte seit Schulbeginn bemerkt, wie die Angst immer öfter in mir hochstieg. Tag für Tag wurde sie mächtiger. Irgendwie hatte ich es in den letzten Wochen geschafft, sie im Zaum zu halten. Doch sie gewann immer mehr an Gewicht, und ich würde bald unter ihr zusammenbrechen. Manchmal war ich es einfach leid. Was hätte ich dafür gegeben, ganz normal zu sein! Mit einfachen Teenagerproblemen wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber man konnte es sich nun mal nicht aussuchen.
Jetzt musste ich das Ganze nur noch meinen Eltern beichten. Also, auf in den Kampf!
Unten im Wohnzimmer war der Fernseher laut aufgedreht, und ich konnte schon auf der Treppe hören, dass mein Bruder »Berlin Tag und Nacht« angeschaltet hatte, seine absolute Lieblingsserie. Ab und zu zappte auch ich mal hinein. Manchmal tat es gut, mir die Probleme anderer Leute anzusehen, auch wenn sie nur gespielt waren. So konnte ich die eigenen kurzzeitig vergessen.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)