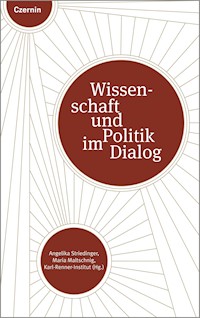
Wissenschaft und Politik im Dialog E-Book
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Inwiefern kann wissenschaftliche Forschung politisch umgesetzt werden? Und wie können politische Diskussionen und Handlungen durch die neuesten Erkenntnisse bereichert werden? In rund 20 spannenden Gesprächen über zukunftsweisende Themen wie Klimakrise, Arbeit oder Sozialpolitik zeigt »Wissenschaft und Politik im Dialog«, wie essenziell dieser Austausch ist. Von leistbarem Wohnen in Wien über Solidarität und Inklusion bis hin zu Rechtspopulismus. Von Digitalisierung und ihren Chancen über den Rechtsstaat als Spielball der Politik bis hin zur Steuerpolitik großer Konzerne: Ein Thema, das für die Gesellschaft essenziell ist, wird von einem Wissenschaftler erforscht und von einer Politikerin umgesetzt. Das vorliegende Buch lädt beide zu einem Gespräch ein und bringt so die unterschiedlichsten Perspektiven zusammen. Eine äußerst inspirierende Lektüre für all diejenigen, die an gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie deren wissenschaftlicher Basis interessiert sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Angelika Striedinger, Maria Maltschnig, Karl-Renner-Institut (Hg.)
WISSENSCHAFT UND POLITIK IM DIALOG
Angelika Striedinger, Maria Maltschnig, Karl-Renner-Institut (Hg.)
WISSENSCHAFT UND POLITIK IM DIALOG
Czernin Verlag, Wien
Striedinger, Angelika; Maltschnig, Maria; Karl-Renner-Institut (Hg.): Wissenschaft und Politik im Dialog; Angelika Striedinger, Maria Maltschnig, Karl-Renner-Institut
Wien: Czernin Verlag 2022
ISBN: 978-3-7076-0783-3
© 2022 Czernin Verlags GmbH, Wien
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
ISBN Print: 978-3-7076-0783-3
ISBN E-Book: 978-3-7076-0784-0
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
INHALT
Vorwort Doris Bures, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts
Einleitung Angelika Striedinger & Maria Maltschnig
I. ARBEIT & SOZIALSTAAT
Wohnen in Wien – zwischen Finanzmarktlogik und Sozialpolitik Justin Kadi, Waltraud Karner-Kremser
Solidarität in der Pandemie: Vom Balkonklatschen bis zur Pflegereform Barbara Prainsack, Birgit Gerstorfer
Arbeitszeit: Flexibilität für die Arbeitenden oder für die Unternehmen? Bettina Stadler, Barbara Teiber
II. WIRTSCHAFTSPOLITIK
Vermögen in Österreich: Wer hat, wer nicht, und was ist zu tun? Miriam Rehm, Renate Anderl
Wie in Medien über Reichensteuern berichtet wird Hendrik Theine, Jan Krainer
Wie Konzerne Steuern vermeiden – und was dagegen zu tun ist Konstantin Wacker, Evelyn Regner
III. KLIMAKRISE
Klima-Governance: Lokale Strategien für globale Herausforderungen Christoph Görg, Rainer Handlfinger
Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit: Wo bleibt effektive Klimapolitik? Felix Butzlaff, Julia Herr
Umbau der Autoindustrie: Arbeitsplätze vs. Umwelt? Ulrich Brand, Rainer Wimmer
IV. IDENTITÄT & DIFFERENZ
Solidarität: Wer sind »wir«, wer sind »die Unsrigen«? Jörg Flecker, Willi Mernyi
Transnationalität wertschätzen statt Migrant:innen abwerten Vedran Džihić, Nurten Yilmaz
Diversität, Verteilung und Klimapolitik zusammen denken Laura Dobusch, Mario Lindner
V. POLITIKMACHEN
Rechtspopulismus: Schamlose Normalisierung verstehen und bekämpfen Ruth Wodak, Sabine Schatz
Soziale Arbeit und Politik: Im Auftrag der Menschenrechte Anna Riegler, Roland Fürst
Strafrecht als Spielball der Politik? Alexia Stuefer, Selma Yildirim
Was Digitalität mit uns macht – und wie wir damit umgehen können Felix Stalder, Veronica Kaup-Hasler
Über die Herausgeberinnen
VORWORT
Doris Bures, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts
»Wissen ist Macht! Macht ist Wissen!« So lautet ein Leitspruch der Arbeiterbildungsbewegung. Was steckt in dieser Feststellung? Der erste Teil liegt auf der Hand, er entspricht dem bürgerlichen Bildungsideal der Aufklärung sowie – erweitert um wichtige Dimensionen von sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit – dem Fundament sozialdemokratischer Bildungspolitik, nämlich: den Zugang zu Wissen und Bildung möglichst breit zu gestalten, möglichst vielen Menschen alles zu ermöglichen. Auch für unsere politische Arbeit in Gewerkschaften, Interessensverbänden und der Partei ist das Wissen um gesellschaftliche Zusammenhänge und Naturverhältnisse eine wichtige Ressource im Kampf für eine bessere Welt.
Der zweite Teil – »Macht ist Wissen!« – ist weniger geläufig, jedoch um nichts weniger bedeutsam: Er drückt das Verständnis aus, dass Wissen nicht neutral ist, dass auch in Wissen selbst Macht- und Herrschaftsstrukturen stecken. Umso wichtiger ist ein emanzipatorisches Verständnis von Bildung und Wissenschaft. Sie sollen nicht nur dazu dienen, Produktivität und Leistungsfähigkeit zu optimieren, sondern dazu, die Verteilung von Macht, Glück und Lebenschancen in unserer Gesellschaft zu analysieren, kritisch zu hinterfragen und auch zu verändern.
Dieser bejahende und offene Blick sozialdemokratischer Bewegungen auf die Wissenschaft steht im starken Kontrast zur Wissenschaftsfeindlichkeit rechter Parteien und autoritärer Systeme, die zunehmend Verschwörungserzählungen in ihre politische Rhetorik einbauen. Und er grenzt sich auch klar ab vom elitären Bildungsund Wissenschaftsverständnis konservativer Politik, das vor allem darauf abzielt, Bildungs- und Wissensungleichheiten – und somit auch soziale Schieflagen – zu festigen.
Für eine lebendige, funktionierende Demokratie ist es wichtig, auf Augenhöhe in den Dialog miteinander zu treten und eine Sprache zu finden, in der wir uns verständigen können. Wenn wir in diesem Buch Wissenschaft und Politik miteinander ins Gespräch bringen, dann geschieht das mit der Absicht, diese Augenhöhe und diese gemeinsame Sprache zu finden und weiterzuentwickeln. Nicht nur für die beteiligten Politiker:innen und Wissenschafter:innen, sondern auch für die Leserinnen und Leser. In diesem Sinne wünsche ich eine anregende Lektüre!
EINLEITUNG
Angelika Striedinger & Maria Maltschnig
Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik
»Soziologie ist ein Kampfsport.« So drückte der französische Soziologe Pierre Bourdieu sein Verständnis einer engagierten Wissenschaft aus1 und beschrieb damit auch die Rolle, die die Sozialwissenschaften für die Politik haben sollen: zu zeigen, wie Macht, Geld, Ansehen, Lebenschancen in der Gesellschaft verteilt sind; zu erklären, welche Mechanismen dahinterstecken – und durch diese Einsichten zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse beizutragen. Diese Funktion von Wissenschaft ist auch ein wesentlicher Orientierungspunkt für unsere Arbeit im Karl-Renner-Institut, an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. Und mehr noch: Unsere Bemühungen, gute Räume für den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik zu schaffen, sind getrieben von der Überzeugung, dass in diesem Austausch etwas Neues entstehen kann.
Zwischen Wissenschaft und Politik, so betonen zahlreiche Artikel und Kommentare, »besteht seit jeher ein Spannungsverhältnis«2, ein »schwieriges Verhältnis«3, es »herrscht seit jeher nicht die große Liebe«4: »Wissenschaft und Politik empfinden gleichermaßen, dass sie eine schwierige Beziehung zueinander haben«5. Die hier angesprochenen gegenseitigen »Missverständnisse und Fehlwahrnehmungen«6 sind zu weiten Teilen darin begründet, dass in diesen beiden Welten grundverschiedene Logiken, Einverständnisse, Codes wirken. Unsere Aufgabe sehen wir hier aber nicht nur in einer Übersetzungsarbeit, mit dem Ziel, Politik durch verständliche wissenschaftliche Expertise besser zu machen – und auch umgekehrt: Wissenschaft durch Einblicke in politische Abwägungen zu bereichern. Sondern wir wollen die Momente der Innovation und Horizonterweiterung nutzen, die sich genau aus den Verschiedenheiten dieser Welten und in deren Begegnung ergeben.
Das ist die Motivation hinter der Wissenschaft-&-Politik-Gesprächsreihe, die in diesem Buch dokumentiert ist. Bei jedem Gespräch bringen wir eine:n Wissenschafter:in mit einem oder einer Politiker:in zusammen, die beide in ähnlichen thematischen Feldern tätig sind. Angelika Striedinger, Bereichsleiterin für Wissenschaft & Politik im Karl-Renner-Institut, plante und moderierte die Gespräche; sie dauerten jeweils etwa ein bis zwei Stunden; zwei Drittel wurden in der physischen Begegnung durchgeführt, ein Drittel coronabedingt online. Auf den folgenden Seiten wollen wir unseren Zugang zum Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik darlegen, der hinter dieser Gesprächsreihe steht, und wir illustrieren unsere Ausführungen mit Zitaten und Beispielen aus den Gesprächen.
Zum Einfluss von Wissenschaft auf Politik (und umgekehrt)
»Wenn man einen Report hat, in dem der Stand der österreichischen Klimawissenschaft zusammengefasst ist, dann ist das etwas, was man als Politik ernst nehmen sollte. Wenn das ignoriert wird, dann deswegen, weil man es nicht zur Kenntnis nehmen will.« (CHRISTOPH GÖRG ÜBER DEN KLIMA- UND ENERGIEPLAN, IM GESPRÄCH MIT RAINER HANDLFINGER)
»Würde die Politik evidenzbasiert vorgehen und sich von sachgerechten Motiven leiten lassen, würde sie auf die Wissenschaft und Forschung hören: Die Ursache des Problems liegt oft in der patriarchalen Gesellschaftsstruktur und in überkommenen Männlichkeitsbildern.«(ALEXIA STUEFER ÜBER SEXUALVERBRECHEN, IM GESPRÄCH MIT SELMA YILDIRIM)
»Die Sprachwissenschaft rennt Sturm, wir schreiben lange, differenzierte wissenschaftliche Gutachten, es gibt eine Sitzung – und Bildungsminister Faßmann kommt in die Sitzung hinein und sagt: ›Es gibt auch andere Experten. We agree to disagree.‹« (RUTH WODAK ÜBER DEUTSCHFÖRDERKLASSEN, IM GESPRÄCH MIT SABINE SCHATZ)
Diese Zitate verdeutlichen den Anspruch von Wissenschafter:innen, politikrelevantes Wissen zu produzieren – und ihren Ärger darüber, wenn Politiker:innen dieses Wissen zwar haben, aber ignorieren. Allerdings ist die dahinterstehende Frage alles andere als geklärt: In welchem Ausmaß und bei welchen Angelegenheiten soll die Politik wissenschaftlichen Empfehlungen folgen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich heute ein ganzer Forschungszweig der Wissenschafts- und Technikforschung. Ausgangspunkt ist dabei die »grundlegende Wissensproblematik von Politik«7. Diese besteht darin, dass einerseits von politischen Entscheidungsträger:innen erwartet wird, sich an den Einsichten von Expert:innen zu orientieren, statt an Machtkalkül und Bauchgefühl – andererseits aber große Skepsis gegenüber einem zu starken Einfluss von Expert:innen auf die Politik besteht und eine Expertokratie als undemokratisch abgelehnt wird.
Die demokratietheoretische Kritik an der Macht von Expert:innen in der Politik entstand als Reaktion auf das »goldene Zeitalter für die Experten«8. Unterstützt von einem weit verbreiteten Technologieoptimismus und Glauben an die Kontroll- und Steuerungsfähigkeit von Gesellschaft und Natur, herrschte in den Nachkriegsjahrzehnten ein weitgehend ungetrübtes Vertrauen an wissenschaftliche Expertise. Dieses Vertrauen wurde allerdings zunehmend infrage gestellt, als die aufstrebende, sozial-konstruktivistisch geprägte Wissenschafts- und Technikforschung untersuchte, wie wissenschaftliches Wissen überhaupt hergestellt wird. Welche Themenfelder und Fragestellungen dabei beforscht werden, welche Mechanismen in den Blick geraten, welche Theorien als plausibel angenommen werden: All das folgt nicht rein objektiven Kriterien, sondern ist geprägt von gesellschaftlichen Glaubenssätzen und den sozialen Prozessen wissenschaftlichen (Zusammen-)arbeitens9.
Mit der Dekonstruktion wissenschaftlicher Autorität ging der Ruf nach einer Demokratisierung von Wissenschaft einher. Welche Problemfelder beforscht werden, das sollte nicht mehr rein von wissenschaftsinternen Neigungen, sondern von gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungshaltungen (mit)bestimmt werden. Umgesetzt wurde dieser Anspruch erstens durch die Verbreitung eines neuen Selbstverständnisses von Wissenschaft, das anwendbares Wissen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme erarbeiten will, und das nicht nur für, sondern gemeinsam mit wissenschaftsexternen Personen.10 Zweitens wurde der politische Einfluss auf die Forschung gestärkt, indem sich die Forschungsförderung an politisch gesetzten thematischen Schwerpunkten orientiert und Beratungskreise aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Forschungsprozesse begleiten. Ob das geeignete Mittel sind, um Wissensproduktion zu steuern und gesellschaftliche oder politische Anliegen in Forschungsprozesse einzubringen, und in welchem Ausmaß das dann zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beiträgt, ist jedoch umstritten.11
Wenn es umgekehrt um den Einfluss von Wissenschaft auf Politik geht, so problematisierte die Wissenschaftsforschung ursprünglich, wie oben angesprochen, die Macht von Expert:innen in der Politik. Mittlerweile hat sich die Sorge der Wissenschaftsforschung allerdings verschoben:12 Heute werden vielmehr das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft und die Verbreitung von Fake News und Verschwörungserzählungen als demokratiepolitisches Problem angesehen.
Hinter diesem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft stehen langfristige und tiefgreifende gesellschaftliche Dynamiken; mit ein Grund liegt aber durchaus auch im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik selber, und zwar in einem im Fachjargon als »Epistemisierung des Politischen«13 beschriebenen Trend. Demnach werden viele politische Konflikte heute nicht mehr als solche, sondern als Wissenskonflikte diskutiert. Die Auseinandersetzungen behandeln dann nicht Interessen, Werte und Vorstellungen eines guten Lebens, sondern es geht vielmehr darum, wer die bessere Expertise aus dem Hut zaubern kann. Zu jeder Expertise lässt sich eine Gegen-Expertise finden; selbst bei Fragen, bei denen sich die Wissenschaft großteils einig ist, führt eine falsch verstandene Neutralität in den Medien immer wieder zu einer gleichwertigen Darstellung gegensätzlicher »Wahrheiten«. Der Vorwurf, dass Expertise als Feigenblatt eingesetzt wird, um interessengeleitete Politik als objektiv und alternativlos erscheinen zu lassen, ist sicherlich in vielen Fällen zutreffend, was wiederum zu einem Generalverdacht gegenüber jeglichen sachlichen Argumenten, Zahlen und Daten verleiten kann. Die Folge ist eine Ablehnung »etablierter« Wissenschaft und eine sinkende Bereitschaft, sich auf argumentbasierte Debatten einzulassen.
Hier können rechtspopulistische Bewegungen einhaken, um Anhänger:innen zu rekrutieren, und sie können dabei auch noch ihre Wissenschaftsfeindlichkeit als revolutionäres Aufbegehren gegen die Elite darstellen. Denn: Der Anspruch, dass die Einschätzungen von Wissenschafter:innen in politische Entscheidungen einfließen sollen, beruht ja darauf, dass Wissenschafter:innen in der Wissenshierarchie eine überlegene Rolle zugeschrieben wird: Sie sind die Expert:innen in ihrem Fachgebiet, andere sind Lai:innen. Diese »epistemische Asymmetrie«14 bringt aber auch mit sich, dass es als Selbstermächtigung, als Umsturz alter Hierarchien gedeutet werden kann, wenn der Glaube an bzw. die Loyalität gegenüber der Wissenschaft aufgekündigt wird. Besonders deutlich wurde das jüngst in den Protesten von Coronamaßnahmen-Gegner:innen, bei denen Verschwörungserzählungen oft für glaubwürdiger gehalten werden als der wissenschaftliche Konsens und in deren Hintergrund rechtsradikale Netzwerke wirken.15
Auch abseits dieser wissenschaftsfeindlichen oder zumindest-skeptischen Gruppierungen gilt die Vorstellung mittlerweile jedenfalls als reichlich naiv, dass es in Politik und Bevölkerung ein Wissensvakuum gebe, das die Wissenschaft einfach mit Fakten auffüllen müsse.16 Vielmehr treffen im Austausch zwischen Wissenschaft und Politik unterschiedliche Wissensformen, mehr noch, unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche aufeinander, die nach je eigenen Regeln funktionieren.
Was unterscheidet Wissenschaft und Politik voneinander?
»Das Wesentliche in einer Demokratie ist nicht, recht zu haben, sondern im Parlament die Mehrheit zu haben.« (JAN KRAINER ZUR VERMÖGENSSTEUER, IM GESPRÄCH MIT HENDRIK THEINE)
»Ob das Fake News sind, ist ja egal. Natürlich sind sie es. Aber so gewinne ich die Debatte nicht.«(WILLI MERNYI ÜBER MIGRATIONSDEBATTEN, IM GESPRÄCH MIT JÖRG FLECKER)
»Das ist Beschlusslage. Die gesamte Partei steht dahinter, alle Bundesländer und Teilorganisationen. Man muss es wollen. Wir wollen das.« (NURTEN YILMAZ ÜBER STAATSBÜRGER:INNENSCHAFT, IM GESPRÄCH MIT VEDRAN DŽIHIĆ)
Diese Aussagen verweisen auf wesentliche Bezugspunkte in der Welt der Politik: parlamentarische Mehrheiten, gefühlte Wahrheiten, Beschlüsse und politischer Wille. Das sind andere Bezugspunkte als jene in der Wissenschaft. Das wird besonders deutlich, wenn man in der Gesamtschau vergleicht, was Wissenschafter:innen und Politiker:innen jeweils in die Gespräche einbringen, die in diesem Band versammelt sind.
Wissenschafter:innen beziehen sich in erster Linie auf Forschungsergebnisse, vorrangig aus eigenen Studien, aber auch aus jenen anderer Wissenschafter:innen. Sie beschreiben Daten (z. B. Wohnproblemindex, Vermögensverteilung), Modelle (Schicht-Modell zu Arbeitszeit und sozialer Teilhabe), Systematisierungen und Typifizierungen (Dimensionen des Solidaritätsbegriffs, Arten gewerkschaftlicher Macht). Ihre Formulierungen sind meist sehr analytisch und verweisen darauf, wie Dinge entstehen und zusammenhängen (medialer Wandel durch digitale Technologien, Expansion multinationaler Konzerne, unerwünschte Exklusionseffekte von Organisationsformen). Sie verwenden präzise und gehaltvolle Begriffe zur Beschreibung von Phänomenen und Prozessen (Finanzialisierung, Dualisierung, ökologische Modernisierung, Katalysator); manche betonen, dass ihre Forschungsergebnisse nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden können und Daten oft nur begrenzt aussagekräftig sind.
Politiker:innen verweisen vor allem auf ihre eigenen politischen Forderungen (z. B. Einkommenstransparenz, mehr Ressourcen für die Justiz) und ihre eigenen politischen Maßnahmen (Wiener Wohnbau, Mindestlohn im Burgenland, Townhall-Meetings im Rathaus). Sie geben Einblick in das politische Alltagsgeschäft: in die Abwägungen zwischen unterschiedlichen Zielsetzungen und Notwendigkeiten (Bevölkerungsexpansion versus Schul-Infrastruktur), in Strategien und Hindernisse bei der Durchsetzung politischer Ziele (ÖVP blockiert Mietrechtsreform und Vermögenssteuer, ÖVP erschwert Antikorruptionsbemühungen) sowie in die Knackpunkte und versteckten Interessenslagen in politischen Auseinandersetzungen (Arbeitszeit-Flexibilität für Arbeitende oder für Unternehmen, Klassismus in der Umweltpolitik). Besonders häufig beziehen sie sich zur Illustration ihrer Argumente auf Anekdoten, großteils aus ihrem eigenen Leben (Diskussionen mit FPÖ-Wählern zu Klassen- versus »Rassen«-Solidarität, Vermittlung von gewerkschaftlichen Anliegen während der Regenbogenparade).
Was sagen uns diese Gegenüberstellungen über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik? In den Sozialwissenschaften gibt es mehrere große Theorien, die Gesellschaft als eine Sammlung bzw. ein Zusammenwirken unterschiedlicher Teilbereiche analysieren. Diese Theorien sind recht unterschiedlich in ihrem analytischen Fokus, sie beinhalten aber im Grunde ähnliche Ansätze zum Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. In Luhmanns Systemtheorie17 sind Wissenschaft und Politik je eigene Systeme. Jedes System folgt einem eigenen, systemspezifischen, binären Code. Der Code des Wissenschaftssystems ist »wahr / nicht-wahr«18, der des politischen Systems »Regierung / Opposition«19. Ähnlich sind in Bourdieus Feldtheorie20 Wissenschaft und Politik je eigene Felder. In jedem Feld herrscht ein spezifisches Einverständnis darüber, was wichtig ist, was als erstrebenswert gilt, worum gekämpft wird, wodurch Anerkennung erworben werden kann. Dieses besteht in der Wissenschaft im Glauben an das uneigennützige Streben nach Erkenntnis;21 in der Politik im Streben nach Macht über den Staat.22 Mit der Perspektive der Institutionellen Logiken23 wiederum können Wissenschaft und Politik als je eigene Logiken beschrieben werden. Diese Logiken strukturieren die Wahrnehmung der Menschen, bieten Sinn und Legitimität und bestimmen, was als selbstverständlich, als logisch angesehen wird und was nicht. In der wissenschaftlichen Logik werden Sinn und Legitimität durch wissenschaftliche Exzellenz erzeugt, in der politischen Logik durch demokratische Prozesse.
Diese systemeigenen Codes, feldspezifischen Einverständnisse, Sinn- und Legitimitätsquellen strukturieren also in all diesen theoretischen Perspektiven den jeweiligen Teilbereich, haben aber nur eine untergeordnete oder keine Bedeutung in anderen Teilbereichen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür liefert der Austausch zwischen Christoph Görg und Rainer Handlfinger zur Klimapolitik. Beide formulieren Notwendigkeiten, die sie als logische Folge aus den gegebenen Sachzwängen ableiten: Der Wissenschafter sagt, dass Emissionen sinken müssten und sich das Wirtschaftswachstum ohnehin nicht im nötigen Ausmaß fortsetzen ließe, es brauche daher eine Veränderung der gesamten Produktions- und Lebensweise. Der Politiker sagt, er stehe als Bürgermeister im Wettbewerb mit anderen Gemeinden um die Bevölkerung, er müsse lokale Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen generieren, und die dafür nötigen Einkaufszentren und Siedlungsstraßen gehen mit Bodenversiegelung einher. Dieser Bürgermeister ist sich der klimapolitischen Notwendigkeiten durchaus bewusst und versucht, diese innerhalb der Einverständnisse des politischen Feldes zu erfüllen: Er setzt auf Anreize und psychologische Tricks, er hofft auf technologischen Fortschritt.
Wie oben ausgeführt, berufen sich Wissenschafter:innen zur Untermauerung ihrer Argumente großteils auf Forschungsergebnisse, Politiker:innen auf Anekdoten. Politiker:innen erzählen in den Gesprächen häufig aus ihrem politischen Alltag und aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte, Wissenschafter:innen fast nie. Das lässt sich unter anderem auf die unterschiedlichen Selektionsmechanismen zurückführen, die im wissenschaftlichen und im politischen Feld wirken: Die Persönlichkeit von Politiker:innen steht täglich auf dem Prüfstand, Medien beurteilen laufend ihre Authentizität, Empathie und Führungsstärke, und dies wirkt sich unmittelbar auf Umfrage- und Wahlergebnisse aus. In der Wissenschaft hingegen gilt der Anspruch, dass Anerkennung und berufliches Fortkommen nur auf der wissenschaftlichen Leistung beruhen soll, nicht auf der Persönlichkeit der einzelnen Wissenschafter:innen.
Außerdem zeigt sich im unterschiedlichen Umgang mit Anekdoten, was in Wissenschaft und Politik jeweils als legitime Wissensquelle anerkannt ist. Die eigene Lebenserfahrung und der persönliche Blick auf die Welt ist in der Politik eines der überzeugendsten Argumente – und das umso mehr, wenn Politiker:innen selbst Teil der Gruppe sind, über die sie sprechen: Migrantin, Arbeiter:innenkind, schwuler Mann. In der Wissenschaft hingegen hat anekdotische Evidenz kein Gewicht. Jedes Uni-Seminar zu wissenschaftlichem Arbeiten vermittelt mehrere Methoden, die die eigene Forschung nachvollziehbar und reproduzierbar machen sollen; der Erkenntnisgewinn soll unabhängig sein von der individuellen Forschenden. Das ging bis vor einigen Jahren im deutschsprachigen Raum sogar so weit, dass der/die individuelle Wissenschafter:in, das »ich«, in Texten unsichtbar gemacht wurde. Im Doktoratsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien wurde in den frühen 2010er-Jahren noch gelehrt, dass wissenschaftliche Publikationen im Plural zu verfassen sind – »Wir untersuchen in dieser Studie …« –, selbst wenn die Autorin die Forschung alleine durchgeführt hat: Sie spricht hier ja nicht als individuelle Person, sondern als Vertreterin der Wissenschaft. Das hat sich mittlerweile geändert. Dennoch: Der Anspruch, durch wissenschaftliche Studien belastbare Aussagen über den Untersuchungsgegenstand zu treffen, statt sich selbst als Forscher:in abzubilden, ist weiterhin das Ziel wissenschaftlichen Arbeitens.
Begegnung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik
»Eine Studie der Volkshilfe hat vor Kurzem gezeigt, dass 93 Prozent der Bevölkerung sagen, dass Pflegekräfte besser entlohnt werden sollen und kürzere Arbeitszeiten brauchen.« – »Jetzt ist die Zeit, in der wir große strukturelle Änderungen andenken und anstoßen müssen, die vorher als undenkbar gegolten haben.« (BIRGIT GERSTORFER UND BARBARA PRAINSACK IM GESPRÄCH ÜBER DAS PFLEGESYSTEM)
»In den letzten beiden Jahren konnte das reichste Zehntel der Bevölkerung sein Vermögen noch um 30 Prozent vergrößern, jetzt hat eine neue Studie der Nationalbank gezeigt, dass das reichste Prozent in Österreich fast die Hälfte des Vermögens besitzt.« – »Wir brauchen ein Vermögensregister, wir brauchen eine progressive Vermögenssteuer, wir brauchen Erbschaftssteuern mit relativ hohen Freibeträgen.« (RENATE ANDERL UND MIRIAM REHM IM GESPRÄCH ÜBER VERMÖGENSVERTEILUNG)
»Es gibt kaum Räume, in denen diese parallelen Diskurse zusammenkommen. Weil sie ihre jeweils eigenen Nischen und Plattformen haben, in denen auch Gemeinschaft simuliert wird.« – »Das muss man zunächst einmal positiv sehen. Weil das macht einen ungeheuren Raum auf.«(VERONICA KAUP-HASLER UND FELIX STALDER IM GESPRÄCH ÜBER DIGITALE KOMMUNIKATION)
Die wissenschaftlichen Daten und Analysen in diesen Gesprächsauszügen stammen nicht etwa von den Wissenschafter:innen, sondern von den Politiker:innen. Die politischen Aufrufe und Forderungen wiederum wurden hier von den Wissenschafter:innen geäußert. Wie diese Zitate zeigen, sind die Trennlinien zwischen Wissenschaft und Politik doch nicht so scharf gezogen, wie im vorangegangenen Teil ausgeführt. Manchmal ist in den Gesprächen in diesem Band rein aus dem Gesagten nicht erkennbar, wer spricht. Beispiele dafür sind das ping-pong-artige Nennen von Beispielen für Steuervermeidung von Konstantin Wacker und Evelyn Regner, die abwechselnden Beschreibungen des neuen Selbstbewusstseins von Migrant:innen zwischen Vedran Džihić und Nurten Yilmaz, das gemeinsame Überlegen rund um Klima und Verzichtsdebatten von Felix Butzlaff und Julia Herr oder die fachliche Diskussion zwischen Anna Riegler und Roland Fürst zur Bedeutung von Sprache für Ungleichheitsverhältnisse.
Politiker:innen arbeiten eben auch mit wissenschaftlichem Wissen. Sie holen Beratung und Expertise von Wissenschafter:innen ein; oft geben politische Organisationen wissenschaftliche Studien in Auftrag, um mit den Ergebnissen ihre Argumente und Forderungen zu untermauern. So gewinnen Politiker:innen einen guten Einund Überblick über den aktuellen Wissensstand in ihren jeweiligen Themenbereichen und werden schließlich selbst zu Expert:innen. Manche der Politiker:innen, die in diesem Band sprechen, haben auch eine berufliche Vergangenheit in der Wissenschaft.
Und Wissenschafter:innen wiederum sind eben auch politische Menschen. Sie verfolgen das politische Geschehen, denken über politische Strategien nach, sammeln Alltagseindrücke und interpretieren diese politisch. Entsprechend bringen sie auch normative Statements und Anekdoten in die Gespräche ein. Insbesondere jene Wissenschafter:innen, die wir im Rahmen dieser Gesprächsreihe eingeladen haben, sind politische Menschen – das ist ja der Grund, warum sie Fragestellungen untersuchen und Forschungsergebnisse erarbeiten, die für die Politik relevant sind, weswegen wir sie wiederum für diese Gespräche angefragt haben. Einige der Wissenschafter:innen in diesem Band waren selbst in politischen Organisationen aktiv, manche engagieren sich auch heute noch in Interessensvertretungen und politischen Parteien. Und praktisch alle Wissenschafter:innen, die in diesem Band sprechen, bemühen sich, ihre Forschung in verständliche und umsetzbare politische Ableitungen zu übersetzen – nicht nur im Rahmen von Forschungsberichten, sondern auch in der Politikberatung, in Blogs und interaktiven Websites, in Policy Briefs, Interviews und Zeitungskommentaren.
Interessanterweise ist es bei vielen unserer Wissenschaft-&-Politik-Gespräche so, dass die Wortmeldungen der Gesprächspartner:innen zu Beginn recht eindeutig ihren jeweiligen Rollen als Wissenschafter:innen oder Politiker:innen entsprechen. Erst im Gesprächsverlauf werden die Unterschiede undeutlicher, die Trennlinien unschärfer. Wir deuten das als Auswirkung der direkten Interaktion, des persönlichen Austauschs. Sozialwissenschaftliche Theorien des sozialen Handelns sehen Interaktionen als jene Orte, in denen Normen und Bedeutungen reproduziert, ausgehandelt, verändert werden.24 Im Bemühen, Kommunikation zu ermöglichen, lassen sich die Gesprächspartner:innen aufeinander ein und greifen dabei auf ihre jeweils passenden eigenen Wissensvorräte zurück: Wissenschafter:innen auf ihr politisches Wissen, Politiker:innen auf ihr wissenschaftliches Wissen, beide auf ihre Alltagserfahrungen. Die direkte Interaktion fördert dadurch das gegenseitige Verständnis von Menschen, die sich in den unterschiedlichen Welten von Wissenschaft bzw. Politik bewegen.
Darin liegt eine Absicht hinter der Gesprächsreihe: Wir schaffen damit Räume, in denen gegenseitiges Verständnis erzeugt und Übersetzungsarbeit geleistet werden kann, in denen Wissenschaft und Politik einander durch Einsichten bereichern können. Wissenschaftliches und politisches Wissen sehen wir dabei nicht in einem hierarchischen Verhältnis zueinander, sondern als unterschiedliche, sich ergänzende Wissensformen. Unser Anliegen ist es, Gespräche und Begegnungsräume so zu gestalten, dass sie einen Austausch auf Augenhöhe fördern. Wissenschaftliche Forschung kann an Relevanz gewinnen, wenn Wissenschafter:innen besseren Einblick in die Abwägungen, Herausforderungen und Wissensbedürfnisse von Politiker:innen gewinnen. Politisches Handeln kann zielgerichteter und wirkungsvoller werden, wenn es auf den Erkenntnissen wissenschaftlicher Analysen aufbaut.
Eine weitere, ebenso bedeutsame Absicht hinter der Gesprächsreihe liegt in der Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven, mit dem Ziel, Innovation zu fördern. In diesem Gedanken lassen wir uns anleiten von der oben angesprochenen Theorieperspektive der Institutionellen Logiken. Ihr zufolge werden soziale Situationen meist von mehreren unterschiedlichen, oft auch widersprüchlichen institutionellen Logiken gleichzeitig strukturiert,25 wodurch widersprüchliche Selbstverständlichkeiten, Sinn- und Legitimitätsquellen aufeinandertreffen. Das kann zu Konflikten führen, wie auch zum Hinterfragen von als logisch, als selbstverständlich angenommenen »Tatsachen«. Geschieht dies öfter, so führt das zu einer Verschiebung der Wirksamkeit unterschiedlicher institutioneller Logiken im jeweiligen sozialen Kontext und weitergehend zu gesellschaftlichem Wandel. Wenn wir Wissenschafter:innen und Politiker:innen miteinander ins Gespräch bringen, schaffen wir damit einen Rahmen, in dem unterschiedliche Logiken aufeinandertreffen. Dabei kann es vorkommen, dass das, was für die eine Person ganz klar – logisch – ist, für die andere Person keinen Sinn ergibt, keine Relevanz hat, unlogisch ist. Wenn sich die beiden Gesprächspartner:innen aufeinander einlassen, kann das wiederum dazu führen, dass sie ihre eigenen Logiken, ihre eigenen Selbstverständlichkeiten, Sinn- und Legitimitätsquellen infrage stellen. Genau durch solche Momente werden Horizonte erweitert und Neues wird denkbar.
In den Gesprächen in diesem Band finden sich nur wenige explizite Momente des Zweifels, der Infragestellung, des noch unentschiedenen Abwägens widersprüchlicher Ziele und Dilemmata (Ausnahmen gibt es bei schwierigen und ambivalenten Themenbereichen wie Klimapolitik und Migrationspolitik sowie bei Überlegungen zu gewerkschaftlicher Organisation). Das ist durchaus verständlich: Politiker:innen und Wissenschafter:innen sehen diese Gesprächssituationen in den meisten Fällen wohl erst einmal als Auftrittsmomente. Politiker:innen sind es gewohnt, in Zeitungsinterviews und bei Diskussionsveranstaltungen Sicherheit und Orientierung zu vermitteln sowie bei jeder Gelegenheit ihre Forderungen zu platzieren. Wenn Politiker:innen Unsicherheiten und Ambivalenzen ausdrücken, so werden sie dafür von Medien und öffentlicher Meinung tendenziell abgestraft.26 Unsere moderierten Gespräche, die zu interviewförmigen Texten verarbeitet wurden, haben durchaus Ähnlichkeiten mit anderen, öffentlicheren Auftrittsmomenten. In der Wissenschaft wiederum ist der Umgang mit Unsicherheit zwar integraler Teil des fachlichen Diskurses; im Austausch mit Politik und Öffentlichkeit sind Wissenschafter:innen aber mit der Erwartung konfrontiert, für unterschiedlichste Phänomene eindeutige Erklärungen und Prognosen parat zu haben. Diese Erwartung an die Wissenschaft ist wahrscheinlich auch in unseren Gesprächssituationen spürbar.
Um unsere innovationsorientierte, Selbstverständlichkeiten infrage stellende Absicht hinter den Gesprächen besser zu erfüllen, werden wir bei zukünftigen Begegnungen dieser Art mehr Raum dafür schaffen, dass Unsicherheiten und Uneinigkeiten offen angesprochen werden. So könnten wir etwa durch gezieltes Nachfragen die Widersprüche zwischen den wissenschaftlichen und politischen Logiken stärker in den Fokus nehmen.
Dennoch: Die beteiligten Wissenschafter:innen und Politiker:innen haben durchgehend ihre Wertschätzung für diesen Austauschraum zum Ausdruck gebracht. Für die Politiker:innen war es ein Genuss, ohne Agenda in den Dialog zu treten, sich mit ausreichender Zeit und analytischer Tiefe dieser Auseinandersetzung widmen zu können. Wissenschafter:innen schätzten die Einblicke in politische Strategien und Abwägungen sowie die Gelegenheit, ihre Einschätzungen direkt an die Politik kommunizieren zu können.
Wir werden diese Räume der Begegnung von Wissenschaft und Politik weiterhin schaffen und im Sinne unserer beiden Absichten – gegenseitiges Verständnis und Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven – weiterentwickeln. Jetzt hoffen wir erst einmal, dass die Gespräche in diesem Band auch den Lesenden spannende Einsichten und Inspiration bieten.
Anmerkungen
1 Film »Pierre Bourdieu: Soziologie ist ein Kampfsport«. Regie: P. Carles, Produktion: C-P Productions. Frankreich, 2001. https://www.absolutmedien.de/film/883/Pierre+Bourdieu%3A+Soziologie+ist+ein+Kampfsport (16.5.2022)
2 Demokratie21 (2020): Expert*innen Rundruf – Wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage? #2, Juni 2020. https://demokratie21.at/expertinnen-rundruf-2/ (30.6.2022).
3





























