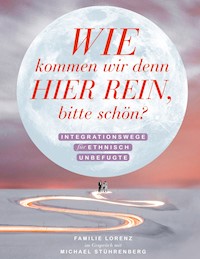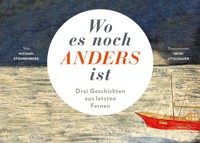
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch setzt sich zusammen aus drei Reportagen, die eines gemeinsam haben: Sie führen die Leser/innen in Welten, die völlig im Abseits liegen, zumindest aus der Sicht europäischer Medien. Nichts passiert dort, was eine Headline etwa in der FAZ, einen Artikel im Spiegel oder einen Bericht in der Tagesschau rechtfertigen könnte. Ob und warum diese Geschichten dennoch wichtig sein können, muss eine jede, ein jeder für sich allein in Kopf und Herz entscheiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Dana, Lea und Lou
Inhaltsverzeichnis
Der SULTAN vom TSCHADSEE
Das DORF der Horizontbewohner
Die Geschichte vom PARADIES
Der SULTAN vom TSCHADSEE
Abakar Adoum Mbodou Mbami, der Herrscher von Kinasserom, sitzt auf seinem Thron und wartet. Es ist Dienstag, Markttag auf seiner Dorfinsel im Tschadsee, an der Grenze zwischen Sahel und Sahara. Ganz Kinasserom wartet auf die Ankunft der Großhändler. Sie kommen aus der tschadischen Hauptstadt N’Djamena, von den nahen Ufern Kameruns und, zahlreicher noch, aus dem reichen Nachbarland Nigeria, um die Bäuche ihrer bis zu 20 Meter langen Pirogen mit Räucherfisch aus Kinasserom zu füllen. Wichtige Leute also.
Und sie alle werden an diesem Morgen den Weg benutzen, der die Bootsanlegestelle am Ostufer mit dem Marktplatz am Westufer verbindet. Das heißt: Sie müssen am Palast vorbei! Dort, wo sich Abakar seit Sonnenaufgang fragt, wer unter all den angereisten Händlern wohl auf die kluge Idee kommen könnte, ihm, dem Herrscher von Allahs Gnaden, seine Aufwartung zu machen.
»Wir empfangen Besucher mit offenen Armen«, mahnt Abakar die 14 Berater zu seinen Füßen. »So ist es«, ruft Ibrahim Adam, der Wesir, mit rauer Stimme aus, während Adam Saïd, der Palastschreiber, das Gesagte mit ernstem Nicken bestätigt. Wahrscheinlich aber richten sich die Worte des Herrschers in erster Linie an mich, der ich ebenfalls auf der Matte hocke und zu ihm aufschaue. Weise lächelnd fügt der Herrscher hinzu: »Käme uns niemand besuchen, würde dies doch bedeuten, dass wir für niemanden wichtig sind, oder?«
Ich nicke. Schließlich hat er auch mich mit offenen Armen in seinem Reich empfangen.Auf jeden Fall ist Abakar empfangsbereit. Der Herrscher trägt sein bestes Gewand, einen weißen Boubou mit Stickereien am Halsausschnitt, dazu echte Socken und Lederschuhe. Er ist der einzige, der im Palast Schuhe tragen darf. Alle anderen müssen sich, wie beim Betreten der Moschee auf der gegenüberliegenden Seite des weiten Sandplatzes, ihre Sandalen abstreifen, bevor sie mit einem winzigen Schritt die Palastmauer überschreiten.
Der Palast? Eigentlich besteht er nur aus dem Schatten einer Akazie. Da diese einzige Oase im grellen Tag von Kinasserom jedoch längst nicht mehr ausreicht für die Bedeutung des Herrschers und die Anzahl seiner Berater, hat Abakar den Schatten durch ein von 17 Pfählen gestütztes Schilfdach erweitern lassen. So entstand ein durchsichtiger Thronsaal von sechs mal zehn Metern. Zur Rechten ist er begrenzt von einer rissigen Hofmauer, auf der, einer Sphinx ähnlich, ein zahmer Fischadler wacht. Die übrigen Mauern des Palastes bestehen aus drei Reihen auf dem Boden aneinandergelegter Lehmziegel.
Jeden Morgen wird der Palast gefegt und mit Seewasser getränkt, damit sich der Staub in Schlamm verwandeln kann. Kurz darauf, gegen halb sieben, erscheint der Herrscher und lässt sich auf seinem Thron nieder: ein Campingstuhl aus weißem Plastik, den Abakar mit seinem Gewicht etwa zehn Zentimeter tief in den aufgeweichten Boden drückt. Dank der Hitze trocknet der Stuhl rasch fest und garantiert dem Herrscher für die kommenden Stunden Stabilität.
Palast? Thron? Ortsfremde könnten die Szene unter der Akazie von Kinasserom für eine dubiose Satire halten. Für derben Spott, der Afrikas Gegenwart mit Vokabeln aus einer Vergangenheit schmückt, die so fern wirkt wie ein Märchen vom Hofe des Harun al-Raschid. Zu bodenlos scheint hier der Abgrund zwischen verbalem Glanz und der Armseligkeit dessen, was er bezeichnet.
Dennoch kann sich der Mann auf dem Plastikstuhl in der Tat fürstlicher Abstammung rühmen. Abakar Adoum Mbodou Mbami ist der älteste Enkel des letzten Sultans vom Tschadsee, der noch in Amt und Würden regieren konnte, bevor ihn die Franzosen zu einem subalternen Beamten in der Verwaltung ihres Kolonialreiches degradierten.
Sein Herrschergeschlecht blickt auf Jahrhunderte zurück. Auf Zeiten, in denen es in dieser Gegend keine Staaten wie Tschad, Niger, Kamerun oder Nigeria gab.
Das Sultanat Tschadsee, bewohnt vom Volk der Buduma, »Jene vom Schilf«, umfasste einst den See mit all seinen Inseln sowie das Westufer mit der Stadt Bol, wo bis heute der Palast des Herrschers steht. Im Osten grenzte das Sultanat an das Kalifat Kanem, im Westen ans Königreich Bornu. Für die Menschen im Abendland war Bornu der klarste Bestandteil einer sagenhaften Sahel-Geographie. Das im Mittelalter zum Islam bekehrte Land war durch den Transsaharahandel arabischer Karawanen mit Sklaven, Gold und Straußenfedern zu Reichtum gelangt. Der Herrscher von Bornu, berichtete der Entdeckungsreisende Heinrich Barth, der die Reichshauptstadt Maiduguri 1853 erreichte, throne, unsichtbar für seine Untertanen, in einem Käfig aus Schilf. Und mächtig sei Bornu einst gewesen: Im 13.
Jahrhundert habe seine Kavallerie 40 000 Reiter umfasst.
800 Jahre später besitzt Abakar Adoum Mbodou Mbami nicht einmal ein Moped.
Acht Uhr, und noch immer macht kein Großhändler seine Aufwartung. Der Herrscher strengt sich an, in Würde zu warten.
Mit durchgedrücktem Kreuz sitzt er auf dem Campingstuhl, stoisch wie der Adler auf der Mauer, den Blick in die flirrende Hitze über dem Sandplatz getaucht. Zaghaft schlage ich ein Thema vor: »Sage, Abakar, wie bist du nach Kinasserom gelangt?« Mit einer leichten Kopfbewegung wendet sich der Herrscher seinem Wesir zu: »Ibrahim! Erzähle von den Anfängen!« Ibrahim Adam, der sein Alter auf 80 Jahre schätzt, ist von erstaunlich kräftiger Statur.
Seine breiten Hände ruhen majestätisch auf dem Knauf seines geschnitzten Gehstocks, auch wenn dieser flach vor ihm auf der Matte liegt. »Vor langer Zeit«, hebt der Greis an, »besaß ich einen Laden für Netze und Angelhaken am Nordufer. Aber dann ließ Allah den See vor meiner Tür austrocknen. Ich verließ meinen Laden und folgte dem fliehenden Ufer.« Dem Verständnis abendländischer Zuhörer soll hier mit dem Hinweis gedient sein, dass die Sahel-Dürren der 1970er und 80er Jahre sowie massive Wasserabfuhr für landwirtschaftliche Zwecke an seinem Hauptzufluss Chari den Tschadsee auf ein Zehntel seiner Fläche der 1960er Jahre haben schrumpfen lassen. Wo einst Ibrahim Adams Laden für Fischereizubehör stand, ziehen heute Kamele durch den Sand. An seiner tiefsten Stelle ist der See noch gerade sieben Meter tief.
»Mit Restbeständen aus meinem Laden machte ich mich selbst zum Fischer«, fährt Ibrahim fort. »Eines Tages paddelte ich weit hinaus, da entdeckte ich neues Land.« Eine Insel, die sich durch das Sinken des Wasserspiegels aus dem Wasser hob. »Ich beschloss, mich niederzulassen und baute eine Schilfhütte.«
So nahm Ibrahims Leben eine neue Richtung, die eher seinem zweiten Namen, Adam, gerecht wurde. Mit seiner Frau und einem Kind lebte er wie allein auf der Welt, als erster Mann in einem Garten, der kein Eden war –dazu gab es zu viele Schlangen und Mücken –, aber weit entfernt lag von jener Hölle am Nordufer, wo der Sahel zur Sahara verkam. Das war ein großes Glück, zumal sich in der Nähe seiner neuen Hütte reiche Fischgründe befanden. Ein Triumph sozusagen, weshalb Ibrahim die Insel Kinasserom taufte: »Das ist der Sieg!« in der Sprache der Buduma.
Nach überliefertem Recht gehört »Jenen vom Schilf« alles Land im Tschadsee. Vorausgesetzt natürlich, man versteht die Welt noch so, wie sie war, bevor sie modern wurde. Für Ibrahim Adam, den die Annehmlichkeiten neuzeitlichen Komforts ohnehin nie erreicht hatten, war das kein Problem.
In einem Gefühl sanfter Vertrautheit richtete er seine neue Wohninsel nach alter Ordnung ein: im Namen des Sultans und als dessen Willensvollstrecker auf Kinasserom.
Binnen kurzem zog die Insel des Sieges zahlreiche Fischer an. Sie kamen aus verschiedenen Regionen des verbrannten Sahel, sogar aus dem fernen Mali siedelte ein Mann vom Nigerfluss nach Kinasserom über. Bald standen auf der Insel 14 voneinander getrennte Hüttenhaufen, konnte man an ihrer Anlegestelle 14 verschiedene Idiome hören, und das tschadische Arabisch als verbindende Lingua franca. Denn Ibrahim wies jedem Volk eine Parzelle zu, damit die Leute ihr Leben nach eigenem Brauch und Gutdünken gestalten konnten. Verstieß jemand gegen die für sie alle gültigen Vorschriften, legte Ibrahim den Schuldigen gefesselt ins Boot und brachte ihn zum Palast nach Bol. Auf dass der Sultan Recht sprechen möge.
Für das Sultanat wurde das Schrumpfen des Sees zu einer lohnenden Katastrophe: Immer mehr Inseln tauchten im Laufe der Jahre auf, und ihre Siedler waren, ob Buduma oder nicht, Untertanen des Sultans vom Tschadsee. Als schwierig erwies sich nur, dass der Palast weit entfernt lag von den wichtigsten seiner neuen Besitzungen. Gewiss, manche Aufgaben konnten Statthalter erledigen, resolute Männer vom Schlage eines Ibrahim Adam. Doch zeigten nicht die Erfahrungen verflossener Jahrhunderte, dass die Ausübung von Macht zwangsläufig die Frage der Legitimität aufwarf? Und dass es den Untertanen oft nicht ausreichte zu wissen, dass ihr ferner Sultan von Allahs Gnaden herrschte? Brauchten die Bewohner der neuen Inseln nicht die Präsenz eines weisen Führers in ihrer Mitte?
»Monsieur Saïd«, ruft der Herrscher im Schatten. »Erzähle, wie Kinasserom regier