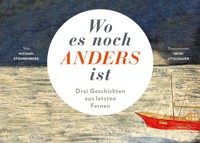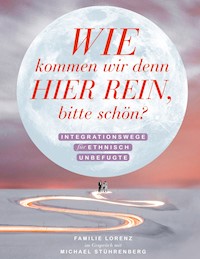
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sind wir endlich in der Zukunft angekommen? Diese Frage stellen sich noch immer zahllose Russlanddeutsche, die nach dem Zerfall der Sowjetunion ins Land ihrer Vorfahren übersiedelten. Wie Jakob und Maria Lorenz und ihre Kinder Wjatscheslaw und Tatjana. In einem ebenso lehrreichen wie humorvollen Buch beschreiben hier vier Anpassungskünstler einen kurvenreichen Weg, der von Kasachstan über Lettland in die bundesdeutsche Integration führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Yves, Lenard und Lea
„Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.“
Александр Сергеевич Пушкин
„Respekt vor der Vergangenheit
ist das Merkmal, das Bildung von Barbarei
unterscheidet.“
Alexander Sergeevich Puschkin
Inhalt
VORWORT
Apropos „Gute Faschisten“
KASACHSTAN Liebesgrüße aus Pokornoje
KAPITEL 1
Das Wohnzimmer am Schwarzwald
KAPITEL 2
MyHeritage in Kasachstan? No way!
KAPITEL 3
Rote Stiefel mit Pferd, Nutschi-Briefe im Eismeer
KAPITEL 4
Von Rot nach Rosa
KAPITEL 5
Und das Beste für zuletzt
KAPITEL 6
Dürfte ich jetzt auch mal was sagen?
LETTLAND Das Vorgefühl von Europa
KAPITEL 7
Aufbruch in die Zukunft
KAPITEL 8
Jakob und die Grenzen von Lothar Matthäus
KAPITEL 9
Jakob und der Trick von Jemeljan Pugatschow
KAPITEL 10
Maria Alexandrowna? Vollzeitbeschäftigt in Daugavpils!
KAPITEL 11
Slawa & Friends im Wald vor der Stadt
KAPITEL 12
Tanja und der lettische Vincent
KAPITEL 13
Die letzten Tage
DEUTSCHLAND Im Zuge der Intergration
KAPITEL 14
Am Nullpunkt
KAPITEL 15
Nicht so doof, wie ich aussehe?
KAPITEL 16
Das Haus
KAPITEL 17
Slawa: Wie besiegt man deutsche Sprache?
KAPITEL 18
Tanja: Willkommen in der bunten Welt
KAPITEL 19
Im Wohnzimmer am Schwarzwald
IMPRESSUM
Vorwort
Apropos „GUTE FASCHISTEN“
Lebenswege sind wie Wanderwege – oft gradlinig und bequem, manchmal aber auch erschöpfend, schwindelerregend vor lauter Kurven, vor Auf-und-Abs. Der meine macht da keine Ausnahme. Nur mag er, aus der ruhigen Distanz eines Wohnzimmersessels betrachtet, noch unsteter wirken als bei den meisten. Weil sich dieser Weg durch sehr unterschiedliche Länder schlängelt: von Russland über Lettland nach Deutschland. Hinzu kommt, dass es sich bei meinem offiziellen Geburtsland, der Sowjetunion, genauer genommen um Kasachstan handelte. Dort bin ich aufgewachsen, habe meine Frau Maria geheiratet und unsere beiden Kinder Wolfgang und Tatjana aufwachsen sehen – zu einer Zeit, als das riesige Land, das sich über zwei Millionen Quadratkilometer quer durch Zentralasien vom Kaspischen Meer bis zur Grenze Chinas erstreckte, nur als „Kasachische Sozialistische Sowjetrepublik“ existieren durfte.
Offensichtlich waren wir, das heißt meine Familie und die meisten unserer Nachbarn, keine Kasachen. Und in den Augen vieler Russen waren wir auch keine Russen. In meinem sowjetischen Inlandspass stand unter Nationalität Nemez – deutsch – vermerkt. Manchmal kam mir das vor wie eine sowjetische Variante des nazideutschen Judensterns. Natürlich ist das stark übertrieben. Dennoch: Musste ich, aus welchem Grund auch immer, meine Papiere vorweisen, stellte ich mich automatisch darauf ein, von meinem staatsamtlichen Gegenüber nichts Gutes geschweige denn Freundliches erwarten zu dürfen. Waren doch die Deutschen bei den Sowjets generell mit dem Makel des „Faschismus“ behaftet. Nach den schlimmen Verbrechen der Nazizeit gab es für einen russischen Kommunisten kein schlimmeres Schimpfwort als dieses: Faschist!
Dazu fällt mir eine Anekdote aus meiner Wehrdienstzeit ein. 1972 wurde ich eingezogen und der „Nordflotte“ zugewiesen. So lernte ich gleichzeitig auch etwas über die schiere Unendlichkeit der sowjetischen Geografie. Mein Stützpunkt Seweromorsk lag bei Murmansk, also jenseits des Polarkreises und damit rund 3000 Kilometer von meinem kasachischen Dorf Pokornoje entfernt. Obwohl, für das riesige Sowjetreich war das eigentlich gar nicht so viel. Am Tag, als der dortige Kommandant seine neuen Rekruten begrüßte, musste jeder von uns vortreten und seine Papiere vorzeigen. Wie zu befürchten, war ich – allein schon aus Gründen der „staatlichen Sicherheit“ – der einzige Deutsche in der Truppe. Der Offizier blickte säuerlich amüsiert auf meinen Pass, dann in die Runde und meinte: „Ein Faschist hat hier gerade noch gefehlt!“ Gewiss war seine Bemerkung irgendwie als Scherz gemeint und das Lachen meiner neuen Kameraden ebenso. Für mich hingegen fühlte es sich überhaupt nicht komisch an!
Zum Glück endet meine Anekdote nicht schon an dieser Stelle. Das Interessanteste kommt nämlich erst noch: Mein Militärdienst als „Faschist“ wurde für mich zu einer Lektion fürs ganze Leben! Mir leuchtete ein, dass es keinen Sinn haben würde, die auf mich gerichteten Vorurteile und Ressentiments mit ebenso negativen Gefühlen und Parolen zu beantworten. Ich wusste: Russen meiner Generation waren noch immer geprägt von Stalin und seinen Tiraden über den „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen Hitler-Deutschland. „Deutscher“ war oft gleichbedeutend mit Feind und Faschist. Dies zu verstehen, wirkte mitunter wie Aspirin bei Kopfschmerzen. Aber es löste nicht meine Probleme im Umgang mit dem sowjetischen Alltag.
Dafür bedurfte es vielmehr einer Langzeit-Therapie. Sie bestand darin, im geteilten Alltag mit meinen russischen Kameraden und Kollegen nicht nur „gut“ zu sein, sondern „besser“. Ohne dies an die große Glocke zu hängen! Also ließ ich meinem bescheidenen Ehrgeiz freien Lauf, war stets der Eifrigste im Marschieren, der Präziseste bei Schießübungen, der Gewissenhafteste beim Erfüllen meiner Aufgaben als Elektriker auf dem Schiff und in der Werft. Die Belohnung folgte auf den Fuß: Ich war bei allen beliebt und wurde geschätzt, auch wenn das Lob für mich oft in der Verpackung des typisch russischen Humors daherkam: „Du bist zwar Faschist, aber ein guter Faschist!“
Diese Lektion war ebenso einfach wie lehrreich: Zeige ich mich Anderen gegenüber offen und ehrlich und löse die mir gestellten Aufgaben zufriedenstellend, dann laufen gegen mich gerichtete Vorurteile schnell ins Leere. Dies hat sich auch in meiner zweiten Lebenshälfte, das heißt seit der Übersiedlung der Lorenz-Familie nach Deutschland, immer wieder bestätigt. Denn obwohl unser Leben hier in jeder Hinsicht einfacher und befriedigender ist als damals in der Sowjetunion, so genießen wir dennoch nicht bei jedermann den besten Ruf. Die Ironie dabei: Beschimpften die Russen uns als „Deutsche“, so lautet nun die abfällige Bezeichnung für uns in Deutschland in der Regel „die Russen“.
Aber all das ist längst frei von Tragik. Und wenn es mich heute drängt, in meinem kurvenreichen Lebenslauf besonders den Aspekt des Akzeptiert-Werdens hervorzuheben, so hat dies gewiss mit dem gegenwärtigen Thema Nummer eins in der öffentlichen Diskussion in unserer Heimat zu tun. Nicht ein Tag vergeht, ohne dass in den Medien, in den Reden von Politikern und Experten oder im alltäglichen Gespräch auf der Straße und über den Nachbarzaun hinweg die Worte „Immigration“ und „Integration“ auftauchen. So, als hinge von der Harmonie zwischen diesen fast gleichklingenden Begriffen die Zukunft Deutschlands, wenn nicht der gesamten Europäischen Union ab.
Heimat ist nicht allein der Boden, auf dem wir unser Haus bauen. Sondern wohl in erster Linie jene im Laufe langer Zeit in uns entstehende Landschaft des Vertrauten, Geliebten, Ersehnten. Heimat ist keine feste Adresse, und sie besteht auch nie aus einem einzigen Guss. Manches, das mir heute ein Gefühl von Zuhause vermittelt, mag seine Wurzeln in einem kasachischen Dorf haben. Oder auf einem lettischen Volleyballfeld, das ich seit Ewigkeiten nicht betreten habe. Oder in der russischen Sprache, die so perfekt mein eigenes Wesen widerzuspiegeln scheint, wenn ich sie in den Zeilen von Puschkin oder Tolstoi finde.
Für mich liegt die Heimat in allererster Linie in meinem engsten Familienkreis. Er besteht aus meiner geliebten Maria, die auch als ewiger Anker der Vernunft im Durcheinander meiner Leidenschaften wirkt. Und aus unseren schon längst erwachsenen Kindern. Beide sind erfolgreich und „viel deutscher“, als ihre Eltern es jemals hätten werden können. Wolfgang ist Lehrer für Mathematik, Physik und Sport an einer Realschule bei Freiburg. Tatjana (Tanja), die an der Kunstakademie Stuttgart studiert hat, ist schon seit Jahren Art-Direktorin des Magazins GEO Epoche in Hamburg.
Von ihnen haben Maria und ich inzwischen auch drei Enkelkinder, die „noch deutscher“ anmuten als ihre Eltern. Für sie, denke ich, ist dieses Buch in erster Linie bestimmt. Damit Yves, Lenard und Lea irgendwann, wenn so etwas einmal wichtig wird in ihrem Leben, die Spuren der Eltern und Großeltern nachverfolgen und entdecken können, welche Bedeutung diese für ihre Vorstellung von Heimat haben. Darüber hinaus hoffe ich selbstverständlich auf zahlreiche Leser unter den Russlanddeutschen, sei es in der alten Heimat oder in der noch relativ neuen.
Mein besonderer Dank für das Zustandekommen dieses familiärliterarischen Unternehmens gebührt unserer Tanja. Sie hat das Lorenz-Buch nicht nur professionell und geschmackvoll gestaltet. Sondern hat nach anfänglichem Widerstreben auch akzeptiert, sich auf den kommenden Seiten als Co-Autorin zu verewigen. Daher nun schnell zu unserer Geschichte. Zu Fragen wie, woher wir kommen, wie wir uns die Welt wünschen, wer und was wir eigentlich sind. Gute Faschisten? Gewiss nicht. Wohl eher gute Nachbarn – wo und mit wem auch immer.
Denzlingen am Schwarzwald, 6. September 2020
Jakob Lorenz
KASACHSTAN
Mai 1954 – August 1984
LIEBES GRÜSSE aus Pokornoje
KAPITEL1
Das Wohnzimmer am SCHWARZWALD
Jakob: Also Maria, lass uns jetzt mit dieser Geschichte anfangen. Wir haben es unserer Tanja versprochen, also machen wir’s jetzt auch. Und glaube mir, nichts könnte mich mehr freuen, als dieses erste Kapitel mit dir im Duett zu verfassen. Wie ja so ziemlich alles in den vergangenen 50 Jahren.
Maria: Na ja, wie wenig begeistert ich anfangs von diesem Plan gewesen bin, weißt du doch. Ich kann es aber auch gerne noch einmal wiederholen: Warum sollen wir heute, 30 Jahre nach unserer Ankunft in Deutschland, den ganzen Russland-Kram von damals noch einmal aufrollen? Wichtig ist doch, dass es uns hier und jetzt gut geht. Unsere Kinder Slawa und Tanja haben schon längst eigene Kinder. Und wir beide, Jakob, sind gesund, fröhlich und in Rente. Keine finanziellen Nöte, keine Schulden, mit niemandem haben wir Probleme. Warum also selbst welche schaffen? Du kennst doch meine Einstellung: Vergangenes soll man ruhen lassen! Vorsicht ist klug. Und wie man im Russischen sagt: Glück mag Stille!
Jakob: Ich bin sicher, die Geschichte, die wir zu erzählen haben, kann nichts Schlechtes nach sich ziehen. Tanjas erste Bitte an uns lautet doch nur, unsere Kindheit in Kasachstan zu erzählen. Das ist ganz unkompliziert, also los: Maria und ich wurden 1954 in dem kasachischen Dorf Pokornoje geboren. Ich bin der Ältere von uns beiden – um zwei Monate, die man mir, so Maria, deutlich ansieht. Ja, da lachst du, Maria. Du weißt, ich mache gern Scherze, das liegt in meiner Art. Humor zählt für mich zu den besten Eigenschaften. Es ist wichtig, die Dinge nicht immer so ernst zu nehmen. Und man muss auch mal über sich selbst lachen können. Aber nun zu der Frage, wie unser junges Leben im kasachischen Dorf gewesen ist. Tanja, denke ich, hat diesbezüglich kaum eigene Erinnerungen. Als wir Pokornoje verließen, war unsere Tochter erst sechs Jahre alt. Und seither ist in ihrem Leben so vieles geschehen, verbunden mit derart gründlichen Ortswechseln, dass die wenigen Kasachstan-Bilder in ihrem Kopf wohl sehr blass sein müssen. Das für sie Wichtige, Schöne, Erinnernswerte findet erst später in ihrem Leben statt, angefangen mit Lettland.
Blicke ich zurück in meine eigene Kindheit in Pokornoje, verbinden sich die meisten meiner Gedanken mit glücklichen Gefühlen. Kinder können ja noch nicht in Vergleichen denken, vieles in ihrem Leben geschieht gerade zum ersten Mal. Daher dachten wir Dorfkinder nie in komparativen Kategorien wie fehlender Komfort und wenig Konsum. Oder gar, dass ein Alltag im Süden von Baden-Württemberg weit angenehmer sein könnte als im Herzen der zentralasiatischen Steppe.
Bevor ich detaillierter auf unser Dorfleben zu sprechen komme, möchte ich kurz den historischen Rahmen jener Jahre erwähnen. Maria kennt ja mein leidenschaftliches Interesse für Geschichte. Also: Nach sowjetischer Zeitrechnung fiel unsere kasachische Kindheit in die Ära Chruschtschow. Das heißt, alle Macht über alle Völker in den 15 Republiken der UdSSR lag in den Händen von Staats- und Parteichef Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Und das war eher gut so. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 – Maria und ich waren noch keine zwei Jahre alt – hielt er seine berühmte „Geheimrede“ zum Thema „Personenkult und seine Folgen“. Es war der Auftakt zur Entstalinisierung daheim und zu ein bisschen Tauwetter im Kalten Krieg mit dem Westen. Chruschtschow ließ auch die Gulags öffnen und viele unschuldig Inhaftierte nach Hause schicken. Allerdings setzte seine Reformpolitik im ganzen Ostblock Kräfte frei, die sich schwer kontrollieren ließen. Ein Ergebnis davon war der Volksaufstand in Budapest, den der Kreml dann durch sowjetische Panzer niederschlagen ließ.
Im eigenen Land musste sich der Parteichef eines Putschversuchs im Politbüro erwehren, angeführt von seinem Hauptkonkurrenten Malenkow. Chruschtschow siegte auch an dieser Front. Und er ließ seine geschlagenen Gegner nicht, wie Stalin es gewiss getan hätte, bei Nacht und Nebel erschießen, sondern schob sie elegant auf Nebengleise. Malenkow zum Beispiel ernannte er zum Direktor eines Kraftwerks ... in Kasachstan.
Maria: Du hast dich schon immer für Geschichte interessiert, Jakob. Und ich finde es wirklich toll, wie viel du zu diesem Thema weißt, im Gegensatz zu mir. Aber du hast dir dieses Wissen doch bestimmt nicht in Pokornoje angeeignet. Und schon gar nicht in jenen fernen Fünfzigerjahren!
Jakob: Natürlich hast du da recht, Maria, wie immer. Es stimmt, dass ich mich schon früh für Geschichte interessiert habe. Aber das meiste von dem, was ich heute über historische Geschehnisse in der UdSSR weiß, stammt natürlich nicht aus Schulbüchern in Pokornoje, sondern aus dem heutigen Internet. Da gibst du auf dem Computer einfach Chruschtschow oder Sowjetunion ein. Und schon spulen endlos Wikipedia-Seiten mit Kleingeschriebenem auf dem Bildschirm herunter. Übrigens brauche ich bald eine schärfere Brille!
Aber woran erinnere ich mich nun wirklich? Zunächst einmal an den Lauf der Jahreszeiten – absehbar nicht nur an der Natur, sondern auch an dem jeweiligen Zustand unserer nie geteerten Dorfstraße. Diese verwandelte sich bei Frühlingsbeginn von einer Eisbahn in eine Schlammschneise, bevor sie für den Rest des Jahres zu einer wenig befahrenen Staubpiste mutierte. Von ihr zweigten im rechten Winkel Wege oder auch nur Trampelpfade ab. Sie führten zu einfachen Häusern aus Lehmziegeln und Holzbrettern. Daneben standen Schuppen, meist voller Gerümpel, denn niemand wollte etwas wegwerfen. Und überall gab es gut bewirtschaftete Gemüsegärten, denn die Bewohner von Pokornoje waren in der Regel Selbstversorger. Zu diesem Punkt kann Maria bestimmt noch mehr erzählen.
Maria: Zunächst einmal möchte ich wiederholen, dass wir Dorfkinder über lange Zeit keine konkrete Vorstellung vom Leben in der Stadt hatten. Pokornoje war unsere ganze Welt. Das ist wichtig. Denn wie hätten wir uns nach etwas sehnen können, das wir nicht kannten? Sehnsüchte entstehen aus Vergleichen, und die Leute von Pokornoje konnten sich höchstens untereinander vergleichen. Da die materiellen Differenzen gering waren, spielten charakterliche Eigenschaften eine umso größere Rolle. Und Familie Lorenz, denke ich, war besonders für Fröhlichkeit und Gastfreundschaft bekannt. Wir kamen mit allen gut aus und missgönnten niemandem etwas.
Jakob: Verzeih, wenn ich mich hier schon wieder einmische. Ich möchte nur sagen, dass es für uns unvorstellbar war, irgendwem im Dorf die Pest zu wünschen. Pokornoje, muss man wissen, war aus heutiger und vor allem aus westlicher Sicht kein gewöhnliches Dorf. In Kasachstan gab es über 100 verschiedene Nationalitäten. Es erklärt sich aus der Geschichte: Ursprünglich waren die Kasachen ein Volk von Kriegern und Nomaden, die in so genannten „Horden“ lebten. Um dem Expansionsdrang ihres östlichen Nachbarn China zu entgehen, stellten sich die Kasachen Mitte des 18. Jahrhunderts unter den Schutz des russischen Kaiserreichs. Das ging solange gut, bis der Zar Anfang des 19. Jahrhunderts die Auflösung sämtlicher Horden befahl und den kasachischen Widerstand mit Waffengewalt brechen ließ.
Nach der Oktober-Revolution versuchten die Bolschewiken, die Steppe auf ihre Art zu entwickeln: über Zwangskollektivierung und „Entkulakisierung“ – also Enteignung aller Großbauern. Hinzu kamen Kommandowirtschaft und Massendeportationen. Das Ergebnis waren Hungerkatastrophen von ungeheurem Ausmaß. In den Jahren 1928-33 starben schätzungsweise 1,5 Millionen in Kasachstan den Hungertod.
Ein weiteres Resultat stalinistischer Politik waren die besagten „über 100 Nationalitäten“, aus denen sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung der Kasachischen Sowjetrepublik zusammensetzte. Neben den zur Sesshaftigkeit gezwungenen Kasachen und den Russen, die in der Steppe die ersten Städte bauten, landeten hier nämlich auch jene, die Stalin verdächtigte, mit Hitler-Deutschland zu sympathisieren. Das waren nicht nur Wolga-Deutsche, sondern auch Ukrainer, Weißrussen, Moldauer, Balten, Tschetschenen, Krimtataren, Koreaner und so fort. Sogar Pontos-Griechen aus Südrussland und dem Kaukasus gab es in diesem neuen Kasachstan.
Maria: Stimmt. Meine Mutter erzählte, in Pokornoje habe man sie einmal sogar für eine Griechin gehalten. Aber um zu dem Thema dörfliche Nachbarschaft zurückzukehren: Jakobs geschichtliche Erklärungen machen klar, aus welch einem durch Politik, Wahnsinn, Grausamkeit und Not zusammengewürfelten Haufen von Menschen verschiedenster Herkunft unser Dorf entstanden ist. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass wir nicht dazu neigten, uns das Leben miteinander unnötigerweise zu komplizieren. Wir alle sprachen Russisch und verstanden uns ausgezeichnet. Nur wenn auf Dorffesten, etwa zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zu viel Alkohol floss, gab’s Prügeleien. Männer hauten sich die Schädel ein, bevor sie sich wieder umarmten – eine uralte und, wie ich befürchte, ewige russische Unsitte. Jakob, dem es vor jeglicher Brutalität graut, hat wohl allein schon aus diesem Grund nie mit dem Alkohol übertrieben. Solange jedoch im Dorf alle nüchtern blieben, gab es keinen Grund zu Streit.
Was auch damit zu tun hatte, dass die Bewohner von Pokornoje nicht nur Nachbarn, sondern auch Arbeitskollegen waren. Das werde ich nun etwas eingehender erklären, vor allem für unsere Enkelkinder Yves und Lenard. Die heute 5-jährige Lea, vermute ich, wird auf ihrem noch langen Bildungsweg alles Mögliche lernen und studieren. Aber wohl kaum, wie es einst im „realen Sozialismus“ der UdSSR ausgesehen hat. Weil diese Dinge zu jenem Zeitpunkt niemanden mehr interessieren werden, außer Historiker. Um unseren Alltag in Pokornoje zu verstehen, muss man wissen, was eine Sowchose war: ein landwirtschaftlicher Großbetrieb in Staatsbesitz. Daher waren die Dorfbewohner auch angestellte Lohnarbeiter. Jakobs Mutter zum Beispiel hat lange als Melkerin gearbeitet. Pokornoje war eine Firma – der Chef war die UdSSR. Wir produzierten Fleisch, Milch, Getreide, Gemüse und Obst. Das meiste davon ging per Lastwagen an ein nahe gelegenes Stahlwerk.
Jakob: Das ist ja die Bedeutung von Hammer und Sichel, dem gelben Emblem auf der roten Flagge der Sowjetunion. Es steht für die Einheit von Arbeiter- und Bauernklasse. Wobei die Arbeiter, vor allem jene in den Bereichen Bergbau und Schwerindustrie, vom Staat bevorzugt wurden. Sie wurden besser bezahlt, besser ernährt, bekamen vorrangig knappe Konsumgüter wie Autos zugeteilt.
Maria: Die Leute vom Lande haben es oft verstanden, aus der Not eine Tugend zu machen. Besonders die Frauen, glaube ich. Denn Marxismus-Leninismus hin oder her, in erster Linie leben wir ja für unseren familiären Alltag und müssen Antworten finden auf Fragen wie: Was bringe ich heute auf den Essenstisch, damit der Mann und die Kinder nicht Hunger leiden? Oder: Wie steht es mit unserer Kleidung? Haben wir genug zum Anziehen, um sicher durch den Winter zu kommen? In Kasachstan können die Temperaturen im Januar/Februar bis auf – 50 Grad sinken. Und oft fehlte es im Dorf an genügend Feuerholz. Deshalb brauchten wir warme Kleidung. Und jede gute Mutter und Ehefrau wusste, wie man Pullover, Schals, Socken und Handschuhe strickt. Auch Filzstiefel, ohne die man im Winter gar nicht auskam, wurden zwar in Fabriken produziert. Aber viel bequemere und schönere entstanden bei uns in privater Herstellung. Und Jakobs Mutter konnte tolle Kleider nähen!
Was ich damit sagen will: Wir Frauen mussten Fähigkeiten beherrschen, die den dörflichen Mangel an Kaufkraft ausgleichen konnten. Nichts war notwendiger als das Wissen, wie ein Gemüsegarten angelegt wird. Am wichtigsten waren immer die Kartoffeln, unser absolutes Grundnahrungsmittel. Außerdem pflanzten wir Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Radieschen, Karotten. Unverzichtbar auch der Weißkohl, denn er war unsere einzige Vitamin-C-Quelle in den kalten Monaten. Vermutlich gab es kein Haus in Pokornoje, wo nicht im Keller ein Fass mit eingelegtem Kraut stand. Und daneben eine zweite Tonne mit eingelegten Gurken und Tomaten.
Jakob: Jetzt möchte ich doch eine Episode aus der Geschichte der Lorenz-Familie hinzufügen, die ich ursprünglich auslassen wollte. Weil sie keine guten Gefühle erzeugt. Andererseits jedoch können jene Ereignisse mit erklären, was aus mir geworden ist und wer ich heute bin. Wie ich auf diesen Gedanken komme? Durch das eben erwähnte Thema „Hammer und Sichel“. Für mich nämlich, ein Kind vom Lande und somit Teil der „Sichel“, fühlt sich die sowjetische Geschichte an, als hätte der Hammer vor allem dazu gedient, auf uns draufzuschlagen.
Maria: Nimmst du uns jetzt wieder mit auf einen längeren historischen Spaziergang?
Jakob: Ja, völlig richtig! Also: Nach der Oktoberrevolution 1917 und dem darauffolgenden Bürgerkrieg ging die Macht an eine Gruppe Bolschewiken, die einen ausgeprägten Hass auf Bauern entwickelt hatten. Zu ihnen zählte Joseph Stalin. Unmittelbar auf seine Machtübernahme nach Lenins Tod im Januar 1924 folgte der Entschluss zur forcierten Industrialisierung der Sowjetunion. Diese konnte jedoch nur glücken, wenn parallel dazu eine Kollektivierung der Landwirtschaft stattfinden würde.
Zum Verstehen der damaligen Lage in der UdSSR sollte man am besten in marxistisch-stalinistischen Bahnen denken. 1924 lebten fast 85 Prozent der Sowjetbürger auf dem Land. Etwas besser gestellte Bauern, die sogenannten Kulaken, setzte die Propaganda nun mit „Ausbeutern“ gleich. Man stempelte sie – angeblich „Inhaber der größten ökonomischen Potenz“ und gefährliche Rivalen der Partei – als dörflichen „Klassenfeind“ ab.
Was einen Bauern zum Kulaken machte, wurde dabei nie ganz klar. Tatsache war, dass der Einfluss der Bolschewiken auf dem Land gering blieb und dass Abermillionen von Bauern sich der Kollektivierung in Kolchosen und Sowchosen jahrelang widersetzt haben. 1929 forcierte Stalin die Repression. Die Getreideernten waren schlecht in jenem Jahr, in den Städten kam es zu Versorgungsengpässen. Also legte die Partei für jedes Dorf eine monatliche Abgabemenge fest. „Requisitionsaktivisten“ aus den Städten trieben diese Mengen ein.
Die Bauern leisteten Widerstand. Viele schlachteten ihr Vieh, vergruben ihr Korn oder verbrannten es. Aber sie hatten keine Chance. Im Gegenteil, sie lieferten ihren Gegnern den Vorwand für einen Vernichtungszug. Im Dezember kündigte Stalin die „Liquidierung des Kulakentums als Klasse“ an und rief zur „Offensive gegen die kapitalistischen Elemente des Dorfes“ auf.
Dann ging alles sehr schnell. Schon einen Monat später, im Januar 1930, teilte das Politbüro der KPdSU die Kulaken in drei Kategorien ein. Die erste enthielt 60 000 „konterrevolutionäre“ Elemente. Sie wurden als Zwangsarbeiter in Gulags interniert oder ohne Gerichtsverfahren erschossen. Die dritte Kategorie umfasste jene, die in ihrer Heimatregion – also meistens im Wolgagebiet – zwangsumgesiedelt wurden. Im Klartext: Diese Bauern wurden von den Kolchosen abgedrängt in Gegenden mit schlechten Böden, ein Teil ihres Eigentums wurde konfisziert.
Wenn ich Kategorie Nr. 2 ans Ende dieser Reihenfolge stelle, so hat dies natürlich einen Grund. Obwohl ich diesbezüglich über keine offiziellen Dokumente verfüge, bin ich mir dennoch sicher, dass meine Vorfahren zu jenen 150 000 Familien zählten, die von den Bolschewiken als die reichsten Kulaken und „Halb-Gutsbesitzer“ eingestuft wurden. Ihr Los nämlich war die Deportierung, samt allen Angehörigen, in unwirtliche und menschenleere Regionen wie Sibirien und Kasachstan.
Der letzte Akt dieses Trauerspiels fand 1937/38 statt und ging als „Der große Terror“ in die sowjetische Geschichte ein. Es war die Zeit der Troikas. Dieser Ausdruck bezeichnete Kommissionen von jeweils drei glaubensfesten Stalinisten, die ohne Gesetzbuch Strafen gegen Verdächtige verhängten. In der Regel machten sie kurzen Prozess. Hunderttausende wurden von ihnen zum Tode verurteilt; die Strafe wurde unverzüglich vollstreckt.
So kamen mein Urgroßvater und mein Großvater zu Tode, beide 1938. Von meinem Urgroßvater Johann Jakob Lorenz, geboren 1876, weiß ich, dass er mit regimekritischen Ansichten nicht hinterm Berge hielt. Und das allein reichte aus, um abgeurteilt und erschossen zu werden. Sein Sohn Jakob, mein Großvater also, hatte bei der Post gearbeitet. Eines Tages waren ihm die Pferde und die Postsäcke geklaut worden, dafür kam er drei Jahre ins Gefängnis. Nach der Freilassung unterlief ihm wieder irgendein Malheur. Dafür ließ ihn die Troika dann direkt an die Wand stellen.
So viel zu den bitteren Kapiteln in der Geschichte meiner Vorfahren. Hinzufügen kann man noch das Los meines Vaters. Er wurde als 16-Jähriger in eine Bergarbeiterlehre geschickt. Gründlich gelernt hat er in seiner Kindheit und Jugend wohl nur den Umgang mit Gewalt und Brutalität. Dies hat mein Verhältnis zu ihm belastet. Wie Maria ja schon früher in diesem Kapitel betont hat, ist mir jede Form von Gewalt zutiefst zuwider. Aber im Nachherein entdecke ich auch die guten Seiten meines Vaters, etwa die Liebe und Freundlichkeit gegenüber seinen Enkelkindern. Und ich sage mir, dass Jakob Lorenz Senior vielleicht nie wirklich eine Wahl gehabt hat, was die Orientierung seines Lebens und den Umgang mit Anderen betraf. Die Saat der durch „Völkervater“ Stalin erlittenen Grausamkeit saß einfach zu tief in ihm drin.
KAPITEL2
MyHeritage in KASACHSTAN? NO WAY!
Meine geliebten Eltern! Wie deutlich ich diese Zwei doch in den vorangehenden Zeilen wiedererkennen kann! Jedes Lachfältchen, jedes Stirnrunzeln, jedes Augenzwinkern in diesen Gesichtern scheint mir seit ewig vertraut. Nicht etwa als Merkmale ihrer unterschiedlichen Charaktere. Sondern vielmehr als Garanten einer unzertrennlichen Gemeinsamkeit. Jakob und Maria, das ist wie Tag und Nacht, Sonne und Regen, Herz und Hirn – scheinbar konträr, in Wahrheit komplementär. Ohne das Eine kann es das Andere nicht geben, jedenfalls nicht in unserer Familie.
Und nun haben wir beschlossen, unsere Erinnerungen, die gemeinsamen wie die alleinigen, zu einer einzigen Familien-Geschichte zu verrühren. Völlig ohne Rezept! Was natürlich das Risiko beinhaltet, dass manche Ingredienzen in diesem Eintopf sich nicht automatisch als für alle Lorenz-Mägen und -Geschmäcker verdaulich erweisen könnten. Wir werden ja sehen. Was mich selbst betrifft, so hatte ich noch bis vor kurzem nicht das geringste Interesse an einem „seelisch-kulinarischen“ Abenteuer dieser Art – vielleicht ähnele ich in dieser Hinsicht meiner Mutter. Andererseits, wohl eher vom Vater geerbt, fühle ich in mir jedoch auch jenen Mix aus ... nennen wir es „künstlerischer Verspieltheit“ und „kindlicher Sinnsuche“.
Hinzu kommt, dass ich dieser Tage ein neues Hobby für mich entdeckt habe: Genealogie! Das hört sich sehr wissenschaftlich an, wird jedoch von meiner Seite absolut laienhaft betrieben. Über einen Freund gelangte ich zu MyHeritage. Auf deren Website bestellte ich einen „Kit“ mit zwei Stäbchen, die für Speichabstriche in den Mundhöhlen dienten, und schickte sie per Post an ein Labor in Texas. Das Ganze für 50 Dollar. Ein paar Wochen später konnte ich online das Ergebnis abrufen – die geografische Herkunft meiner Gene. Ehrlich gesagt, war ich nicht wirklich überrascht, dass laut dieser „Ethnizitätsschätzung“ 86,6 % „Nord- und Westeuropäerin“ in mir stecken. Gefreut habe ich mich über 10,5 % „Italienerin“; unter dem oft bleiernen Himmel Hamburgs kann ein solcher Gedanke durchaus tröstend wirken. Auf die in meinem Gen-Cocktail noch verbleibenden 2,9 % „Balkanbewohnerin“ konnte ich mir allerdings nicht den geringsten Reim machen.
Doch der echte Knaller kommt erst noch. Da MyHeritage seine Kundschaft auch zur Erstellung eines Stammbaums auffordert, habe ich auch bei diesem Spiel begeistert mitgemacht und in dem mächtigen Geäst Lorenz-Walter alle mir bekannten Zweige eingetragen, bis hin zu einem zarten Blättchen Lea, meiner 5-jährigen Tochter. Und dann erhielt ich digitale Post! Ein entfernter Cousin namens Eugen Lorenz, der wohl sehr intensiv Stammbaumforschung betreibt, teilte mir seine bisherigen Ergebnisse mit. Demnach ist es ihm gelungen, die Lorenz-Linie zurückzuverfolgen bis in die Renaissance, wo er auf die Gräfin Maria Ursula von Salm Kyrburg stieß!
Vor lauter Lachen stiegen mir fast die Tränen in die Augen. Seit dem 28. Februar 2021 weiß ich, dass in meinen Adern blaues Blut fließ. Klar, es mögen nicht mehr als ein paar Tröpfchen sein. Und auch diese dürften sich seit den fernen Tagen (1532 –1601) jener Hochadeligen arg verdünnt haben. Nichtsdestotrotz schwelgte ich gedanklich bei „unserer“ Gräfin Maria, die – wer wollte das schon ausschließen? – mit genialen Zeitgenossen wie Shakespeare, Galilei, Rubens, El Greco korrespondiert haben könnte. Und bestimmt nicht mit Iwan dem Schrecklichen, gerade damit beschäftigt, in seinem Zarenreich Abertausende ermorden zu lassen.
Und ließe ich meiner Fantasie und eingebildeten Allmacht völlige Freiheit, könnte ich gleich auch noch entscheidend in den frühen Verlauf der Lorenz-Linie eingreifen: Mal angenommen also, die Vorfahren meines Vaters hätten die Gräfin von Salm-Kyburg beerbt, dann würde ich heute womöglich – irgendwo im Grünen zwischen Hessen und der Pfalz – mit Sonnenschirm und Butler in meinem Schlossgarten promenieren. Anstatt mir vor einem Hamburger Computer den Kopf zu zerbrechen über das siebte oder achte GEO-Epoche-Layout dieses Tages! Denn natürlich wären meine väterlichen Vorfahren als Schlosserben der Gräfin niemals so arm geworden, dass sie vor 250 Jahren dem Ruf von Katherina der Großen gefolgt wären, mit Sack und Pack an die Wolga überzusiedeln. Und mein Ur- und Ur-Urgroßvater hätten ihr Leben nicht unter Stalins Kugeln lassen müssen. Womit wir ja endlich beim Thema Kasachstan angelangt wären.
Okay, nicht ernstnehmen, alles nur fröhlicher Quatsch! Richtig ist freilich, dass ich dieser Tage oft an Kasachstan denke. Auch das mag ein bisschen mit MyHeritage zu tun haben. Immerhin bin ich dort geboren, Ende der Siebzigerjahre, und habe bis zum sechsten Lebensjahr in Pokornoje, dem „Dorf der Bekehrten“, gelebt. Meine ersten Eindrücke von dieser Welt stammen also aus einem abgeschiedenen Nest in der zentralasiatischen Steppe. Wie sollte ich so etwas Einschneidendes aus meiner Erinnerung tilgen können?
Oder überhaupt wollen? Denke ich nämlich an Kasachstan, sehe ich als erstes einen Himmel, der sich in unmessbarer Weite über mir wölbt. Der Blick über unseren Dorfrand führte ins Unendliche. Vor allem im Sommer, wenn die Luft klar, die Steppe gelb, der Himmel blau waren. Dies vermittelte ein ganz anderes Gefühl für die Welt. Natürlich ist mir dies erst später im Leben bewusst geworden, durch den Vergleich mit anderen Umgebungen.
In Deutschland zum Beispiel ist Land immer in erster Linie „Boden“, der sich durch seine Nutzbarkeit definiert: Ackerboden, Forstboden, Bauplätze. In Pokornoje hingegen gab es einfach nur Land, himmelweit. Tauchten in der Tiefe dieses Raumes einzelne Menschen oder Autos auf, wirkten sie oft ein wenig fehl am Platz. Keine Feindschaft trennt sie von dieser Erde, kein Woher?, Wohin?, Was will der hier? reizte die Neugier der Kleinen am Dorfrand. Nur jene Beziehungslosigkeit zwischen Mensch und Land fällt ihr auf – aber wohl auch erst im Rückblick aus ihrem Hamburger Heute.