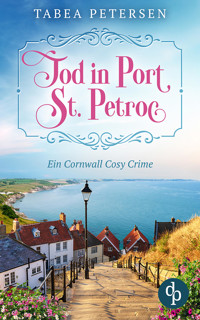9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für einen kurzen Abstecher ist kein Umweg zu weit ... Großer Lesegenuss: Drei liebenswerte Figuren und ein klappriger Bücherbus auf einer Fahrt entlang der malerischen dänischen Ostseeküste Der junge Bibliothekar Henrik ist entsetzt: Ausgerechnet er, der mit Büchern so viel besser zurechtkommt als mit Menschen, wird dazu verdonnert, mit dem klapperigen Bücherbus die süddänische Ostseeküste entlangzufahren. Als wäre das nicht genug, soll er auch noch die verdächtig stille Praktikantin Elina beaufsichtigen, die Sozialstunden ableisten muss. Als sich dann auch noch die 90-jährige deutsche Urlauberin Else als blinde Passagierin in den Bücherbus einschleicht und auf die nahegelegene Insel Alsen gefahren werden möchte, gerät die Reise vollends außer Kontrolle – und zu einem liebenswerten wie atmosphärischen Roadtrip entlang sandiger Buchten und hyggeliger Dörfer. Warmherziger Roadtrip mit einem Bus voll Bücher in die dänisch-deutsche Vergangenheit. Die deutsche Autorin Tabea Petersen lebt seit Jahren in Dänemark und hat sich in die süddänische Ostseeküste mit ihren grünen Hügeln, sonnigen Buchten und hyggeligen Dörfern verliebt. Eine Gegend, die gerade bei deutschen Urlaubern sehr beliebt ist. Auch weil hier eine große deutschsprachige Minderheit lebt, oftmals Nachkommen von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein eher unbekannter Aspekt deutsch-dänischer Geschichte, der lebendig wird, wenn die 90-jährige Else in den klapprigen Bücherbus steigt … Für Fans von Katharina Herzog und Dänemark
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Wohin das Meer uns trägt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Clarissa Czöppan
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
Elina
Juni 2019
2
Henrik
August 2019
3
Elina
August 2019
4
Henrik
August 2019
5
Elina
August 2019
6
Else
August 2019
7
Else
Februar 1945
August 2019
8
Henrik
August 2019
9
Else
Februar 1945
August 2019
10
Elina
August 2019
11
Else
Februar 1945
August 2019
12
Else
März 1945
August 2019
13
Henrik
August 2019
14
Elina
August 2019
15
Else
August 2019
16
Else
Juni 1945
August 2019
17
Henrik
August 2019
Epilog
Elina
Oktober 2019
Nachwort der Autorin
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Elina
Juni 2019
Die Kleinstadtstraße erstreckte sich wie ein schnurgerades, grau-grün-rotes Band: Vorgarten an Vorgarten, Haus an Haus aus rotem oder gelbem Backstein. Ab und an fuhr ein Auto vorbei, sonst war alles menschenleer. Es war ein sonniger, warmer Junimorgen, und zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Elina sicher die frühe Stunde genutzt, um sich die Gärten anzuschauen. Ihr gefielen die dänischen Vorgärten mit ihren sauber gestutzten Hecken, Staudenbeeten und Korkenzieherweiden darin. Manche Hausbesitzer hissten sogar an sorgfältig gestrichenen weißen Fahnenmasten Tag für Tag den rot-weißen Dannebrog, die dänische Flagge. Die Häuser strahlten Zufriedenheit aus, fand Elina, und manchmal malte sie sich aus, wie es wäre, selbst in einem solchen Häuschen zu leben. Das gelang ihr allerdings nur, solange keiner der tatsächlichen Eigentümer in Sicht war. Heute jedoch hatte sie keinen Blick für die Schönheit des Frühsommermorgens. Sie hatte die Kapuze ihres schwarzen Hoodies tief in die Stirn gezogen und die Hände in den Hosentaschen vergraben. Ab und an blieb sie stehen und kontrollierte die Uhrzeit auf ihrem Handy, bevor sie weiterhastete. Eigentlich hatte sie genug Zeit, um die eineinhalb Kilometer vom Studentenwohnheim am Ingemannsvej bis in die Innenstadt von Sønderborg auch in Ruhe zurückzulegen. Trotzdem brachte Elina es nicht fertig, ihre Schritte zu verlangsamen. Seit sie vor ein paar Tagen die Nachricht mit dem offiziellen Logo des Jobcenters in ihrem elektronischen Postfach gesehen hatte, lauerte die Panik am Rande ihres Bewusstseins – bereit zuzuschlagen. Genau genommen war die Angst für Elina nie weit entfernt, war ihr unsichtbarer Begleiter, solange sie zurückdenken konnte. Auf den Termin beim Jobcenter hatte sie sich so gut vorbereitet, wie es eben möglich war. Anstatt ihrem ersten Impuls zu folgen und die Nachricht ungelesen zu löschen, hatte sie sich dazu gezwungen, den Bescheid sorgfältig zu lesen. Hatte sicherheitshalber die Adresse im Internet nachgeschlagen, um die Entfernung auf den Meter genau zu berechnen. Sogar das Online-Formular für ihren Lebenslauf hatte sie im Voraus ausgefüllt. Viel war ohnehin nicht einzutragen gewesen: Elina Jansen, geboren 1999, Staatsbürgerschaft dänisch, Ausbildung: abgeschlossene 10. Klasse an der dänischen Minderheitenschule in Flensburg – immerhin. Sprachkenntnisse: Deutsch und Dänisch. Welche davon ihre Muttersprache war, konnte Elina selbst nicht sagen. Früher war das ganz auf die Laune ihrer Mutter angekommen: War diese nüchtern und mit sich und der Welt zerfallen gewesen, hatte sie dänische Flüche und wüste Beschuldigungen gegen alles und jeden vor sich hin gemurmelt. Manchmal hatte sie auch gebrüllt. War sie dagegen bierseliger Laune gewesen, hatte sie deutsche Schlager oder 80er-Jahre-Gassenhauer geträllert: »Ich will Spaß, ich will Spaß!« Die Mutter war seit beinahe einem Jahr tot. Dennoch spürte Elina noch immer jedes Mal die bittere Galle im Hals hochsteigen, wenn sie einen der alten Deutschrock-Hits im Radio hörte, und dänische Flüche waren ihr allemal lieber als deutsche Schlager. Was ihr die Dame im Jobcenter in einer knappen Stunde auf Dänisch zu erzählen hatte, würde ihr dagegen ganz und gar nicht schmecken, das wusste Elina jetzt schon. Beim Gedanken daran begann ihr Herz noch stärker zu hämmern, der Mund wurde trocken, und in ihrem Magen rumorte es. Inzwischen rannte sie, obwohl ihr das Atemholen schwerfiel. Ihr Hals brannte bis hinunter in die Lunge, aber sie hielt erst inne, als eine rote Fußgängerampel sie zum Stehenbleiben zwang. Auf der anderen Straßenseite ragte die Fassade des mehrstöckigen Einkaufszentrums wie eine bedrohliche grau-weiße Festung auf. Diese Art von Beton-und-Glas-Bauten, von denen es leider selbst in der dänischen Provinz inzwischen einige gab, war Elina aus tiefster Seele zuwider, und ausgerechnet hier im Obergeschoss befand sich das Jobcenter. Das Gymnasium auf der anderen Straßenseite dagegen war ein roter Backsteinbau unter vielen, und früher einmal hatte Elina es sehr gemocht. Die Schüler, die während der Pausen auf der breiten, von alten Bäumen überschatteten Freitreppe vor dem Eingang saßen, schwatzten, lachten und aßen, waren ihr glücklich vorgekommen. Sie hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als eine von ihnen zu sein. Heute jedoch kam ihr auch dieses Gebäude düster und streng vor. Der fröhliche Lärm, den die Jugendlichen veranstalteten, wirkte wie blanker Hohn. Elina lief über die Straße, noch bevor die Ampel grünes Licht zeigte.
Sie betrat das Einkaufszentrum durch die kleine Seitentür, die es ihr ersparte, die riesige gläserne Drehtür benutzen zu müssen. So früh am Morgen war hier nicht viel los, die meisten Geschäfte waren noch mit metallenen Rollläden verschlossen. Das Neonlicht, das sich in dem blanken Marmorfußboden spiegelte, ließ dennoch das altbekannte Schwindelgefühl in Elina aufsteigen, und das Rumoren in ihrem Magen wurde stärker. Sie musste unbedingt als Erstes zur Toilette. Die war im ersten Stock, das Jobcenter im zweiten. Krampfhaft klammerte Elina sich am Geländer der Rolltreppe fest, während sie nach oben fuhr. Als Kind hatte sie Albträume von Rolltreppen gehabt. In ihren Träumen war sie stets mit dem Fuß am Absatz der obersten Stufe hängen geblieben, war langsam und unbarmherzig in das mahlende Getriebe der Treppe eingesogen worden. Sie hatte um Hilfe geschrien, aber die Menschen um sie herum waren gesichtslos und stumm geblieben, hatten sich weiter und weiter von ihr entfernt, bis es dunkel geworden war um sie herum und sie schweißgebadet erwacht war.
Ihr Verstand wusste natürlich längst, dass das Unsinn war, doch ihr Körper sprach eine andere Sprache. Mit zitternden Knien stürzte sie in die erstbeste freie Toilettenkabine und ließ sich auf den Sitz fallen.
Später schob sie widerwillig die Kapuze zurück und betrachtete sich in dem riesigen Spiegel über der Waschbeckenreihe: Ein schmales, spitzes Gesicht schaute unter einer Masse kurzer dunkler Haare hervor, und ein Paar blauer Augen wurde halb von zottigen Ponyfransen verdeckt. An Hals, Wangen und Stirn hoben sich hektisch rote Flecken von der blassen Haut ab. Sie sah genauso elend aus, wie sie sich fühlte – aber das war wohl nicht zu ändern. Elina spritzte sich etwas kaltes Wasser ins Gesicht und schob die feuchten Ponysträhnen aus der Stirn. Die Jobcenter-Leute waren sicher schlimmere Anblicke gewöhnt.
Irgendwie überstand Elina auch die Fahrt mit dem gläsernen Fahrstuhl in den zweiten Stock. Die Böden des Jobcenters waren mit dünnem grauem Linoleum ausgelegt. Unbarmherzig hart hallte jeder Schritt darauf wider. An den strahlend weißen Wänden hingen hier und da farbenfrohe Kunstdrucke von Landschaften, die wohl dazu gedacht waren, die strenge Atmosphäre etwas aufzulockern. Auf Elina hatten sie den gegenteiligen Effekt, sie wirkten so grell, dass es förmlich in den Augen schmerzte. Die schwarzen Plastikstühle im Warteraum waren genauso unbequem, wie Stühle in öffentlichen Gebäuden anscheinend per Naturgesetz zu sein hatten. Elina hockte mit gesenktem Blick da und versuchte, die anderen Wartenden zu ignorieren. Sie hob den Kopf erst, als ihr Name aufgerufen wurde. Die Dame, die ihr jetzt die Hand entgegenstreckte, wirkte wie der Inbegriff von Effektivität und Tüchtigkeit. Alles an ihr schien energisch zu sein: von der gepflegten, aber kräftigen Hand, die Elina mit klammen Fingerspitzen leicht berührte – nur gerade so, dass der Höflichkeit Genüge getan war –, über die schlanken Beine, die in schwarzen Pumps endeten, hin zu der überdimensionalen dunklen Hornbrille und dem sorgfältig gestylten blonden Kurzhaarschnitt. Bürodamenbrille und Bürodamenfrisur. Das Namensschild, das die Dame an ihrer leopardengemusterten Bluse trug, glänzte natürlich wie frisch poliert: Ulla Ottosen. Abteilungsleiterin, Team Jugendliche, stand darauf.
Abteilungsleiterin, auch das noch, dachte Elina. Anscheinend hielt man sie für einen so schweren Fall, dass man sofort die Chefin auf sie hetzen musste. Irgendjemand sollte Madame Ottosen mal erklären, dass Leopardenmuster nur Leoparden steht.
Doch Elina behielt ihre rebellischen Gedanken für sich und trottete brav hinter der Dame namens Ulla her. Rechts und links von dem langen Korridor gingen die Büros der Sachbearbeiter ab. Alle hatten zum Flur hin gläserne Wände, wie riesige Terrarien. Wie konnte jemand freiwillig acht Stunden täglich in diesem verfluchten Zoo verbringen? Elina schüttelte sich unwillkürlich. Ulla Ottosen hatte offenbar den richtigen Glaskasten erreicht und hielt die Tür auf.
Elina ließ sich auf den Besucherstuhl fallen – schwarz und hart wie die anderen –, während die Sachbearbeiterin sich hinter ihren Computerbildschirm klemmte. Anscheinend arbeitete sie im Stehen. Wie an jedem Arbeitsplatz, der gern modern erscheinen wollte, waren die Schreibtischplatten auch hier höhenverstellbar. Bisher hatte Elina noch nie bemerkt, dass irgendjemand diese Funktion tatsächlich nutzte, aber zu Frau Ottosen passte sie. So kann sie besser auf ihre Besucher hinuntergucken, dachte Elina verdrießlich. Ihr magerer Lebenslauf lag bereits ausgedruckt auf dem Schreibtisch, und Ulla Ottosen hatte irgendetwas mit Kugelschreiber hinzugefügt. Die einzelnen Wörter konnte Elina aus der Entfernung nicht erkennen, aber sie sah ein energisches Ausrufungszeichen.
»Elina!« Verdammt, sogar die Stimme der Dame war energisch. Mit gerunzelten Brauen musterte Frau Ottosen sie über den Rand ihres Brillengestells hinweg. Elina wusste, was jetzt kommen würde. Sie hatte es die ganze Zeit über gewusst.
»Du hattest dich zum Sommersemester für einen Abitur-Kurs an der Abendschule angemeldet, ist das richtig?«
Elina hatte immer wieder Deutsche – meist Urlauber – davon schwärmen hören, wie nett sie es fänden, dass in Dänemark alle einander mit »Du« und Vornamen ansprachen. Aber die hatten keine Ahnung! An Ulla Ottosens »Du« war jedenfalls nichts Nettes. Es war nüchtern und kalt wie die gläserne Wand ihres Büros. Wahrscheinlich dachte die Frau insgeheim schon darüber nach, wie sie dem dänischen Staat unnötige Kosten ersparen konnte, indem sie Elina wieder nach Flensburg abschob, wo diese – Staatsbürgerschaft hin oder her – immerhin den größten Teil ihres bisherigen Lebens verbracht hatte. Dort würde man sie jedoch ebenso wenig haben wollen.
»Mhm«, murmelte Elina und begann an ihrer Unterlippe zu kauen. Was sollte sie sagen? Sie war ja zu den Abendschulkursen erschienen. Genau eine Woche lang hatte sie jeden Abend auf dem hintersten Platz eines zugigen, vollgestopften Klassenzimmers gehockt und versucht, die anderen dreißig Teilnehmer zu ignorieren, während sie gleichzeitig auf die Erklärungen des Lehrers gelauscht hatte. Es hatte nicht funktioniert. Die meiste Zeit hatte sie steif und stumm dagesessen, unfähig, irgendetwas anderes zu tun, als dem endlos langsamen Kreisen der Zeiger auf der Wanduhr über der Tür zuzusehen. Die Stimmen von Lehrern und Mitschülern waren miteinander verschmolzen, verschwommen wie das Rauschen vorbeiströmenden Wassers. Eine Zeit lang hatte sie noch versucht, wenigstens die Hausaufgaben zu erledigen und online einzureichen, aber irgendwann hatte sie auch das aufgegeben.
»Elina, du weißt schon, dass du nicht in dem Wohnheimzimmer bleiben kannst, wenn du keine Ausbildung machst?« Die strenge Stimme der Sachbearbeiterin riss Elina aus ihren Gedanken. Wie sollte sie dieser Frau, die bestimmt jeden einzelnen Aspekt ihres Lebens ganz genau unter Kontrolle hatte – Job, Ehe, Kinder, Haus mit Vorgarten –, erklären, warum sie nicht einmal imstande war, ein paar läppische Stunden am Tag in Gesellschaft anderer Menschen zu verbringen und etwas Sinnvolles zu tun? Sie verstand es ja selbst nicht. Damals an der Realschule hatte sie es doch auch irgendwie geschafft, am Unterricht teilzunehmen, zumindest so, dass es am Ende zu einem Dreier-Durchschnitt gelangt hatte. Jetzt, da sie nicht mehr die ständige Sorge um die unberechenbaren Launen der Mutter im Hinterkopf haben musste, hätte es ihr eigentlich leichter fallen müssen, sich zu konzentrieren, aber das tat es nicht. Im Gegenteil, die Angst schien in ihrem Inneren mehr und mehr Raum einzunehmen, und sie fühlte sich dem Rest der Menschheit ferner denn je. Natürlich war ihr klar, dass die Wohnheimplätze nur an Studenten und Auszubildende vergeben wurden. Sie kannte die verfluchte Hausordnung Wort für Wort auswendig, so oft hatte sie sie gelesen in der Hoffnung, irgendein Schlupfloch zu finden.
»Ich melde mich für das neue Schuljahr wieder an. Sofort im August, versprochen!« Elina verabscheute den schrillen Klang ihrer eigenen Stimme, in der nur allzu deutlich Panik mitschwang. Aber sie musste es tun, musste um Hilfe bitten. Betteln, falls nötig. Das war ihre einzige Chance.
»Bitte, wenn Sie mir … wenn du mir nur hilfst, dass ich bis dahin …«
»Du meinst, ich soll dir helfen, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen?«
»Ja bitte, ich …«
»Und wie lange willst du beim nächsten Mal am Unterricht teilnehmen? Zwei Wochen? Drei? Findest du es fair, jemand anderem den Platz wegzunehmen? Jemandem, der sich Mühe gibt, etwas aus seinem Leben zu machen?«
»Ich gebe mir Mühe! Verdammt, Sie haben überhaupt keine Ahnung!« Elinas Augen brannten vor mühsam zurückgehaltenen Tränen.
Diese Frau hat doch bestimmt alles, dachte sie. Sicher ist ihr Leben rundherum perfekt. Ein Teil von ihr beneidete Ulla Ottosen, ein anderer Teil hasste sie. Warum gönnt sie mir nicht einmal ein Zehn-Quadratmeter-Zimmer mit Gemeinschaftsküche auf dem Gang? Die Übelkeit brach so heftig über Elina herein, dass sie ihr beinahe den Atem nahm. Verzweifelt sprang sie von ihrem Stuhl auf und presste die Arme vor den Bauch. Sie musste hier raus! Wenn sie nur den Warteraum wiederfand, dort gab es eine Gästetoilette. Hektisch sah sie sich nach allen Seiten um. Da war die Tür, doch die war zu. Ulla Ottosen versperrte ihr den Weg.
»Wo willst du hin? Wir haben keine Zeit für solchen …«
Elinas Ellenbogen traf die schlanke Frau in die Magengrube, Elina spürte einen kurzen Widerstand, als sie sie zur Seite schob. Dann, endlich, war die Tür frei. Ulla Ottosen schwankte, ein halb ersticktes Keuchen drang aus ihrem Mund. Elina hörte noch einen dumpfen Aufprall, doch da war sie schon draußen auf dem Korridor. Sie drehte sich nicht um, sondern sprintete los in die Richtung, in der sie den Ausgang vermutete. Es war die falsche Richtung. Der lange Gang machte ein paar Biegungen, dann endete er in einer Sackgasse. Gerade wollte Elina sich umdrehen, da spürte sie, wie eine starke Hand sie an der linken Schulter packte.
»Nicht so hastig, junges Fräulein.« Eine andere Hand schloss sich fest um ihren rechten Oberarm. Es waren zwei Männer in der dunklen Uniform des Kaufhaus-Sicherheitsdienstes. Anscheinend bewachten die auch das Jobcenter, daher also die gläsernen Wände. Die Männer hatten sich nicht einmal anstrengen müssen, um Elina einzuholen. Sie war ganz von selbst in die Falle getappt.
2
Henrik
August 2019
»Wiebke, das ist nicht dein Ernst! Verdammt, das kommt überhaupt nicht infrage!«
Irritiert sah Henrik von seinem Schreibtisch auf. Es war nicht ungewöhnlich, dass es nebenan im Büro der Büchereileiterin etwas lauter wurde. Seine Chefin hatte eine etwas cholerische Ader. Vor allem, wenn sie gestresst war, ging ab und zu das Temperament mit ihr durch. Anfangs hatten ihre gelegentlichen Ausbrüche ihn sehr erschreckt. Trotz seiner fünfundzwanzig Jahre hatte Henrik noch kaum praktische Arbeitserfahrung, dies war seine erste richtige Anstellung, nachdem er sein Bachelorstudium der Bibliothekswissenschaft beendet hatte. Nach einigen Monaten im neuen Job fühlte er sich inzwischen einigermaßen sicher bei seinen alltäglichen Aufgaben und hatte gelernt, die Launen der Chefin hinzunehmen. Bisher war er auch – Gott sei Dank! – noch nie derjenige gewesen, der angebrüllt wurde. Er zog die Brille von der Nase, holte ein Putztuch aus seiner Schreibtischschublade und wischte einen Fleck fort, der wahrscheinlich nur in seiner Einbildung existierte. Heute fiel es ihm schwerer als sonst, sich trotz der lautstarken Debatte im Nebenraum auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er war dabei, neu erworbene Bücher und CDs mit dem Strichcode-Label der Deutschen Zentralbücherei Apenrade zu versehen und in den Online-Katalog aufzunehmen. Es kam dabei auf Genauigkeit an, jede Ziffer musste stimmen. Da war Lärm nun wirklich das Letzte, was er gebrauchen konnte.
»Was soll das heißen, du hast schon zugesagt? Was denkst du dir eigentlich? Herrgott noch mal, macht hier eigentlich jeder, was er will?«
Im Grunde genommen ja, dachte Henrik. Aber das würde er nicht laut sagen, im Leben nicht! Normalerweise ließ Büchereileiterin Renate Wollweber den Laden laufen – er lief ja. Im Alltag wusste jeder, was er zu tun hatte, und Renate hatte alle Hände voll damit zu tun, sich um Jahreshaushalt, Vorstandsberichte, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungspläne zu kümmern. Von Zeit zu Zeit sah sich die Chefin dennoch bemüßigt, einmal hart durchzugreifen und mit der Faust auf den Tisch zu hauen. An der Veteranin Wiebke Fischer, die schon mehr als ihr halbes Leben lang in der Bücherei arbeitete, schien die Standpauke jedoch abzuprallen.
»Was war denn los?«, fragte Henrik die Kollegin später vorsichtig.
»Alles Tüddelkram, min Jung, da sei du mal nich bang vor«, erwiderte Wiebke in schönstem Platt und lachte ihr typisch raues Lachen. Ihre gute Laune war unverwüstlich. Henrik mochte sie von allen Kollegen am liebsten. Beinahe ein Jahr war es nun schon her, dass er aus Flensburg auf die dänische Seite der Grenze nach Aabenraa gezogen war. Dennoch hatte er hier außer seinen Arbeitskollegen bisher kaum jemanden kennengelernt. Wenn nicht ab und an ein amtliches Schreiben in seinem Briefkasten landen oder ein Leser ihn auf Dänisch ansprechen würde, könnte er fast vergessen, dass er sich im Ausland befand. Er arbeitete für die deutsche Minderheit in einer deutschen Bücherei. Die Kollegen sprachen Deutsch, die meisten Leser ebenfalls. Die Stadt wurde unterschiedlich genannt, je nachdem, welche Sprache man verwendete: Aus dem dänischen Aabenraa wurde auf Deutsch Apenrade. Mit dem Landesteil war es noch verzwickter: Die Angehörigen der deutschen Minderheit nannten ihre Heimat Nordschleswig. »Haus Nordschleswig« hieß das freundliche zweistöckige Gebäude aus gelbem Backstein, das die Bücherei beherbergte. Damit wies man auf die historische Verwandtschaft mit Schleswig-Holstein hin. »Sønderjylland« sagten dagegen die Dänen – Südjütland. Schließlich gehörte man zur dänischen Halbinsel Jütland, der Volksentscheid von 1920 hatte es so ergeben.
Büchereileiterin Renate Wollweber berief sich gern auf das friedliche Zusammenleben der Minderheiten. Dennoch wurde sie nie müde, ihre Kollegen zur Vorsicht zu mahnen. Man müsse das Nationalgefühl der dänischen Bürger respektieren und dürfe nie vergessen, dass es hier einmal einen Grenzkonflikt gegeben habe. Sie selbst wurde, trotz aller Bemühungen, sich international zu geben, ihren deutschen Akzent nicht ganz los, wenn sie Dänisch sprach. Henrik versuchte gar nicht erst, seine Herkunft zu verbergen. Auch wenn die dänische Grammatik ihm inzwischen geläufig war und Wiebke in jeder Pause mit ihm sprechen übte – eine fehlerfreie Aussprache würde ihm wohl nie gelingen, geschweige denn, dass er mit dem hiesigen Dialekt warm werden würde. Wiebke dagegen bewegte sich so unbekümmert zwischen dem derben Plattdeutsch und dem breiten Sønderjysk, dem Südjütland-Dialekt, hin und her wie ein Fisch im Wasser. Manchmal wechselte sie sogar mitten im Satz die Sprache und verlor dennoch nie ihre unerschütterliche Sicherheit, dass sie jedes Wort, das sie sagte, auch genau so meinte. Wiebke war ein Fels in der Brandung.
Bereits wenige Tage später aber geschah etwas, das nicht nur Henrik, sondern auch sämtliche Kollegen fassungslos machte: Wiebke erschien morgens nicht zu ihrem Dienst! Niemand konnte sich erinnern, dass so etwas bei ihr jemals vorgekommen wäre. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht, darin waren sich alle einig. Auf ihrem Handy erreichten sie Wiebke jedoch nicht. Genau wie die anderen saß Henrik wie auf Kohlen. Doch als der erlösende Anruf endlich kam, wünschte er sich dennoch insgeheim, ein anderer hätte an seiner Stelle abgehoben. Wie reagierte man, wenn eine Kollegin, die man zwar mochte, von der man aber kaum Persönliches wusste, aus der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses anrief, um mitzuteilen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall gehabt hatte? Henrik hatte keine Ahnung.
Ausgerechnet Wiebke hatte einen Autounfall mit ihrem Pkw gehabt, die sonst den schweren Bücherbus der Bücherei geschickt in jede noch so enge Parklücke zwängte und auf jedem noch so schmalen Feldweg wenden konnte, wenn sie die weit verstreute Leserschaft ansteuerte.
»Jo, da heff ick wohl wat nachzuholen gehabt. Man kann ja nich immer Glück haben«, murmelte sie. Ihre sonst so kräftige Stimme war kaum zu verstehen. Vielleicht hatte sie ein Schmerzmittel bekommen.
»Wie … geht es dir denn?«, fragte Henrik unsicher. Die darauf folgende Pause war quälend lang. Das war absolut kein gutes Zeichen. Henrik überlegte, ob er die Frage wiederholen sollte. Hatte Wiebke ihn vielleicht nicht verstanden? Andererseits, was sollte sie schon antworten? Dass er aus ihrem Mund niemals das Wort »schlecht« hören würde, hätte ihm eigentlich klar sein müssen. Bisher hatte sie noch jeder Situation irgendetwas Nützliches abgewonnen. »Wer weiß, wozu’s gut ist«, war normalerweise ihr Lieblingsspruch, wenn irgendetwas schiefging und alle anderen sich ärgerten. Jetzt jedoch bekam sie nach einer Weile, die wie eine Ewigkeit schien, nur ein müdes »Ihr werdet wohl ’ne Zeit ohne mich auskommen müssen« heraus.
Irgendwie, er konnte sich hinterher selbst kaum erinnern, wie, brachte Henrik das Gespräch zu Ende. Was er eigentlich hätte sagen müssen, fiel ihm erst später ein. Warum hatte er sie nicht gefragt, ob sie etwas brauchte, Wechselkleidung aus ihrer Wohnung zum Beispiel? Jeder normale, einigermaßen hilfsbereite Mensch hätte so etwas gefragt, oder? Andererseits kannte er nicht einmal ihre Adresse. Hatte sie Familie? Soweit er sich erinnerte, hatte sie nie einen Ehemann, Kinder oder Enkel erwähnt. Henrik seufzte. Er war einfach nicht geübt in derartigen Dingen – in jeglicher Art von zwischenmenschlichen Dingen, um genau zu sein. Obwohl er seit beinahe einem Jahr hier im Haus Nordschleswig arbeitete, musste er sich noch immer jeden Morgen aufs Neue zu der obligatorischen Begrüßungsrunde aufraffen. Denn wollte man nicht als unfreundlich oder überheblich gelten, war es offenbar zwingend notwendig, jedem einzelnen Mitarbeiter des Hauses persönlich einen guten Morgen zu wünschen, angefangen von der jungen Frau an der Rezeption bis hin zu den Verwaltungsangestellten für die Organisationen der deutschen Minderheit, die in ihren Büros im gegenüberliegenden Flügel des Hauses residierten und mit den Mitarbeitern der Bücherei lediglich die Kantine teilten. Anfangs hatte Henrik das Guten-Morgen-Sagen regelmäßig vergessen, und dass man ihm diese schwere Sünde verziehen hatte, verdankte er nur Wiebkes diplomatischem Geschick. Selbst der tägliche Kontakt zu den Lesern überforderte ihn manchmal. Wenn Kindergarten- oder Grundschulkinder lärmend durch den Lesesaal tollten, ein Buch nach dem anderen aus dem Regal zogen, um es kurz darauf achtlos beiseitezulegen; wenn Teenager sich mit Schwung auf das Sofa vor der Playstation warfen und johlend ihre Controller schwangen; wenn alte Damen ihm Rat suchend ihre Verdauungsbeschwerden in allen Einzelheiten schilderten – dann wünschte sich Henrik insgeheim, er hätte sich für einen anderen Beruf entschieden. Gewiss, er hatte Bücher immer geliebt. Wenn man als Erwachsener unbedingt »etwas werden« musste, das hatte er sich schon in der Grundschule überlegt, dann sollte es wenigstens etwas mit Büchern sein. Er las auch gern Bücher über das Leben anderer Menschen, aber wenn ihm besagte Menschen in natura gegenüberstanden, wurde es kompliziert. Glücklicherweise konnte er den Gesprächen der anderen Kollegen, denen er von Wiebkes Anruf berichtete, entnehmen, dass diese mehrere Geschwister, Neffen und Nichten hatte, mit denen sie sich gut verstand und die ihr ganz bestimmt helfen würden. So weit, so gut.
Als ihn die Chefin am Nachmittag in ihr Büro bat, schwante Henrik trotzdem nichts Gutes. Würde er jetzt kommen, der gefürchtete Anschiss? Was hatte er falsch gemacht? In Gedanken ging Henrik die Ereignisse des Tages durch, aber bis auf das Telefonat mit Wiebke kam ihm nichts in den Sinn, was er vermasselt haben könnte. Renate Wollweber war eine zierliche Mittfünfzigerin mit Brille und Pagenkopf. Henrik konnte sich vorstellen, dass sie, abgesehen von einigen grauen Strähnen im kräftigen dunklen Haar, bereits als Schulmädchen genauso ausgesehen hatte wie jetzt. Bestimmt hatte sie sich schon damals gegen alles und jeden durchzusetzen gewusst. Obwohl er mindestens zwanzig Zentimeter größer war als sie, schrumpfte Henrik förmlich unter ihrem Blick. Sie lächelte zu ihm hinauf, aber das hatte nichts zu bedeuten. Henrik hatte im Archiv Zeitungsfotos von ihr gesehen, sie lächelte auf allen. Auch auf dem Bild von dem großen Handballturnier im vorletzten Monat, bei dem die von Renate trainierte Jugendmannschaft eine schmähliche Niederlage hatte einstecken müssen, lächelte sie, während ihre Spielerinnen wie ein Häuflein Elend um sie herumstanden. Die armen Mädels hatten wahrscheinlich geahnt, was ihnen im Umkleideraum noch bevorstand.
»Henrik, dir ist klar, was Wiebkes Ausfall bedeutet, nicht wahr?«, kam die Chefin ohne Umschweife zur Sache.
Okay, darum ging es also. Henrik atmete auf. Überstunden waren für ihn kein Problem. Seit seinem Umzug auf die dänische Seite der Grenze beschränkten sich seine Kontakte zu anderen Menschen als seinen Kollegen oder den Lesern auf ein wöchentliches Telefonat mit seinem Vater in Flensburg. Dabei ging nach ein paar Floskeln meist beiden der Gesprächsstoff aus, und sie schwiegen sich so lange an, bis Henrik sich dazu durchrang, das Gespräch zu beenden. Nein, es gab niemanden, mit dem er seine Arbeitszeiten hätte abstimmen müssen.
»Wir anderen müssen Wiebkes Dienste mit abdecken, das geht klar«, hörte Henrik sich zu Renate Wollweber sagen. »Du kannst mich ruhig einplanen.«
»Sehr schön.« Schon wieder dieses Lächeln. Erneut wurde Henrik nervös. Warum hatte er das Gefühl, er hätte soeben einen Riesenfehler begangen?
»Dann übernimmst du also den Bücherbus.«
Was?
»Aber ich habe noch nie …«
Bereits während er verzweifelt nach einem Ausweg suchte, wusste Henrik, dass seine Einwände zwecklos sein würden. Die Chefin hatte ihn nicht gefragt, sie hatte einen Befehl erteilt.
»Ich habe in deiner Personalakte nachgeschlagen.« In Renate Wollwebers Stimme lag jetzt die erste Spur von Schärfe. »Du hast als Einziger von uns einen Lkw-Führerschein. Bundeswehr, richtig?«
Henrik nickte gottergeben. Sein Wehrdienst – sechzehn Monate in der Hölle! Warum er sich als frisch gebackener Flensburger Abiturient freiwillig zur Bundeswehr gemeldet hatte, wusste er bis heute nicht genau. War es ein letzter verzweifelter Versuch gewesen, seinem Vater zu beweisen, dass er zwar ein Bücherwurm, aber trotzdem ein ganzer Kerl war? In diesem Fall war der Beweis kläglich gescheitert. Der bestandene Lkw-Führerschein war das einzig Nützliche gewesen, was bei der irrsinnigen Aktion herausgekommen war. Im Moment frage sich Henrik allerdings, warum um Himmels willen er die Zeile Führerschein der Klassen B und C1 nicht aus seinem Lebenslauf gelöscht hatte.
»Was die Leserzahlen angeht, lässt sich dieser Sommer bisher vernünftig an«, erklärte die Chefin gerade. »Wenn wir wie geplant weiterhin die Urlauber in den Ferienhaussiedlungen anfahren, dann können wir zur Jahressitzung im Oktober vielleicht endlich ein paar Statistiken präsentieren, mit denen wir den alten Sparfüchsen vom Vorstand den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn wir den Bücherbusbetrieb allerdings für Wochen, vielleicht Monate einstellen müssen …«
Henriks Schicksal war besiegelt. Er hatte das zähe Ringen um den Jahreshaushalt bereits im letzten Jahr miterlebt und wusste: Wenn die Bücherei es nicht schaffte, eine Steigerung der Leserzahlen schwarz auf weiß zu belegen, würden unbarmherzig die Messer gewetzt und Sparmaßnahmen beschlossen. Bei dieser düsteren Zukunftsaussicht konnte er sich schlecht mit der Begründung herausreden, er traue sich die »Hausbesuche« mit dem Bücherbus nicht zu.
»Schon gut, ich … kriege das irgendwie hin«, murmelte er.
»Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann.« Die Chefin strahlte schon wieder und drehte sich mit Schwung auf ihrem Schreibtischstuhl um. Dabei streifte sie versehentlich mit dem Ellenbogen einen der Aktenordner, die sich auf ihrer Schreibtischplatte stapelten. Ein Gebirge aus Ordnern, Büchern, Zeitschriften und losen Zetteln geriet bedenklich ins Wanken, und nur Henriks beherztes Zugreifen verhinderte eine Katastrophe von geologischem Ausmaß. Renate Wollweber nickte ihm kurz zu und richtete dann ihre Aufmerksamkeit auf ihren Computerbildschirm. Anscheinend war die Audienz beendet. Gerade wollte Henrik sich unauffällig entfernen, da fügte Renate beiläufig über die Schulter gewandt hinzu: »Ach ja, noch was, du bekommst Hilfe. Wiebke hatte ja einer Praktikantin zugesagt, die fünfzig gemeinnützige Arbeitsstunden bei uns ableisten will. Die junge Dame fängt am Montag an.«
»G…gemeinnützige Arbeitsstunden?«, stotterte Henrik. Die einzigen Praktikanten, die er kannte, waren Schüler der oberen Realschulklassen, die man eine Woche lang auf die Betriebe ihrer Heimat losließ – aber jetzt waren Sommerferien.
»Ja, hat Wiebke dir das nicht erzählt?«
»Äh, nein.«
»Die Bekannte eines Lesers, dem Wiebke gern einen Gefallen tun möchte, ist zu fünfzig gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt worden, weil sie offenbar eine Jobcenter-Mitarbeiterin k. o. geschlagen hat.« Die Art, wie Renate Wollweber heftig den Atem durch die Nase ausstieß, zeigte Henrik, dass die Chefin kurz davor war, sich ernsthaft aufzuregen. Vorsichtshalber trat er einen Schritt zurück, dann noch einen, bis er die Türklinke im Rücken spürte. Es gelang ihm, die Klinke herunterzudrücken, ohne sich dabei umzudrehen.
»Aber keine Sorge, das war natürlich nur ein Missverständnis – sagt Wiebke. Also ist doch alles in bester Ordnung, oder?« Bei diesen Worten lachte Renate hart auf und gestikulierte mit den Armen. Das Akten-Gebirge auf ihrem Schreibtisch kam erneut ins Rutschen, und ein Ordner nach dem anderen polterte zu Boden. Die Flüche seiner Chefin klangen Henrik in den Ohren, als er die Flucht ergriff.
3
Elina
August 2019
Der Regen trommelte auf das halbrunde Dach, und in der Ferne war Donnergrummeln zu hören – ein Spätsommergewitter. Umständlich schälte sich Elina aus ihrer Bettdecke. Als sie sich von dem schmalen Wandbett erhob, um in ihre Sachen zu schlüpfen, traf ein Tropfen sie an der Nasenspitze. Sie schüttelte sich. Ach ja, das Dach … Der strahlende Frühsommer war einem trüben, regnerischen August gewichen, und inzwischen wurde Elina beinahe täglich von den Tropfen geweckt, die mit schöner Regelmäßigkeit durch die undichte Stelle des dünnen Daches drangen. Trotzdem war sie jeden Tag aufs Neue dankbar: Sie hatte Glück gehabt, beinahe unfassbar viel Glück. In den wenigen Wochen, die sie hier lebte – die meisten anderen würden es wohl »hausen« nennen –, war der kleine, in verblichenem Grün gestrichene Bauwagen ihr bereits mehr zu einem echten Zuhause geworden als jede Wohnung, die sie in ihrem Leben gekannt hatte, einschließlich des Wohnheimzimmers in Sønderborg. Wie oft sie früher umgezogen waren, als die Mutter noch gelebt hatte, konnte Elina nicht mehr zählen. Hier jedoch konnte sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben vorstellen, freiwillig zu bleiben – wenn der Zustand des Wagens es denn zuließ. Sie musste Urs fragen, ob er ihr helfen konnte, Dachpappe und Teer zu besorgen. War das Material erst zur Hand, würde sie den Rest allein schaffen. Vielleicht besaß der alte Mann ja irgendwo auch eine Leiter. Am besten, sie fragte ihn heute noch, nahm Elina sich vor und kämpfte die Mischung aus Nervosität und schlechtem Gewissen nieder, die sie regelmäßig überkam, wenn sie darüber nachdachte, was Urs alles für sie tat. Ohne ihn wäre sie verloren und könnte mit ihren Siebensachen im Dauerregen auf einer Sønderborger Parkbank kampieren, wenn man sie überhaupt aus dem Arrest entlassen hätte. Vielleicht wäre sie nach ihrem Ausraster im Jobcenter auch geradewegs in den Knast oder in die Jugendpsychiatrie gewandert, aber daran wollte sie lieber gar nicht denken. Urs hatte sie gerettet.
Sie hatte den älteren, leicht zerstreut wirkenden Mann auf Anhieb gemocht, schon damals in der neunten Klasse, als er in Flensburg ihr Musiklehrer geworden war. Eigentlich hätte der gebürtige Schweizer Urs Leitner, der in Dänemark lebte und an mehreren Schulen im deutsch-dänischen Grenzland Musik unterrichtete, längst in den Ruhestand gehen können, aber er blieb: »Solange die Kinder mich brauchen, bleibe ich«, sagte er. Elina brauchte ihn, auch wenn sie es nicht sofort verstand. Anfangs spottete sie genau wie ihre Mitschüler darüber, dass der alte Mann sie »Kinder« nannte. »Der Typ ist nicht von dieser Welt«, sagten die anderen aus ihrer Klasse halb belustigt, halb genervt. Sie hatten recht, aber es war genau das, was Elina insgeheim am besten gefiel. Alles an Urs war sanft: die rundliche Gestalt, die blauen, kurzsichtigen Augen hinter der runden Brille, die ihm stets auf die Nasenspitze hinabrutschte. Die Stimme mit dem Schweizer Akzent, die tief und ruhig sprach und klangvoll singen konnte, aber nie laut wurde. Auch seine Hände waren sanft. Zwar waren sie erstaunlich groß, und sein Klavierspiel zeugte von einer Kraft und Geschmeidigkeit, die mancher dem tapsigen kleinen Mann wohl nicht zugetraut hätte. Doch grob hätten diese Hände niemals sein können.
Elina wusste kaum etwas von Musik, aber dass Urs die Klänge liebte, spürte sie sofort, als sie ihn das erste Mal spielen hörte. Damals sagte er ihr, dass sie eine schöne Altstimme habe, und er versuchte, ihr den Schulchor schmackhaft zu machen. Eine Unterrichtspause lang spielte Elina tatsächlich mit dem Gedanken, sie könne singen lernen. Doch schon die Aussicht darauf, irgendwann dicht gedrängt zwischen den anderen Schülern auf einer Bühne stehen zu müssen, holte sie unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielleicht verstand Urs sogar, warum sie Nein sagte. Der Musikunterricht blieb trotzdem einer der wenigen Lichtpunkte in Elinas Alltag. Einmal, kurz vor dem Abschluss der Realschule, lud Urs die ganze Klasse zu sich nach Hause ein. Elina erinnerte sich genau: Sie fuhren mit dem Linienbus von Flensburg los, über die Grenze und den Fjordvej hinauf, der sich am Ufer der Flensburger Förde entlangschlängelte. Als sie an den beiden Ochseninseln vorbeifuhren, die wie ein bewaldetes Märchenreich inmitten der blauen Förde lagen, presse Elina das Gesicht an die Scheibe des Busses, um ja nichts von der Schönheit da draußen zu versäumen. Im Dörfchen Rinkenæs stiegen sie an der Hauptstraße aus und gingen durch den Ort, vorbei an der weiß gekalkten Kirche mit dem roten Ziegeldach zum Nederbyvej, einem gewundenen Weg, an dessen Seiten die Häuser spärlicher und die Wiesen größer wurden. Aus irgendeinem Grund wusste Elina sofort, welches Haus Urs gehörte: Das kleine weiße Häuschen mit dem Reetdach, das dort an der Wegbiegung eingebettet in einer Senke lag und sich an den dahinterliegenden Hang anlehnte, musste es sein. Das Haus passte zu Urs’ Wesen wie seine Stimme und die runde Brille in seinem Gesicht. Dass das Haus in früheren Jahrhunderten die Dorfschule beherbergt hatte, bevor es in Privatbesitz übergegangen war, wie Urs später erzählte, machte es als Heim des älteren Lehrers nur umso perfekter. Die niedrigen Fenster, die zur Straße hinausgingen, ließen ein behagliches Dämmerlicht in die hinter ihnen liegende Stube fallen. Der große hölzerne Esstisch darin sah genauso freundlich aus wie das Klavier, der gusseiserne Ofen und das ein wenig schiefe rote Sofa in der Ecke, auf dem eine weißhaarige Frau saß und beim Licht einer Stehlampe strickte. Die Frau, die so zierlich wirkte wie eines der altertümlichen Porzellanpüppchen, die Elina einmal in einem Museum gesehen hatte, war Urs’ Mutter. Zu ihren Füßen ausgestreckt lag ein großer schwarz-weiß-brauner Hund, der beim Eintreten der Schüler die Ohren spitzte, den Kopf hob und sich dann in die Ecke hinter der Stehlampe zurückzog. Elina begegnete dem aufmerksamen Hundeblick noch mehrmals. Doch im Gegensatz zu ihren Klassenkameradinnen äußerte sie nicht den Wunsch, die Hündin namens Leonie, die laut Urs’ Aussage neben Berner Sennen noch mehrere andere Rassen in sich vereinigte, möge hervorkommen und sich streicheln lassen. Im Gegenteil, Elina bedauerte lediglich, dass sie selbst zu groß war, um sich in einer Ecke zu verkriechen. Bei aller Gemütlichkeit, auf Dauer hielt sie es in dem dicht bevölkerten Raum nicht aus. Während ihre Klassenkameraden jeden verfügbaren Sitzplatz, inklusive des Teppichs vor dem Kaminofen, mit Beschlag belegten, verzog Elina sich nach draußen und hoffte, dass in dem allgemeinen Durcheinander niemandem ihr Fehlen auffallen würde. Sie erklomm den steilen Hang hinter dem Haus, bis sie zu einer kleinen ebenen Fläche gelangte, und blickte hinab auf die Wiesen und die Dächer der verstreut liegenden Häuser unter ihr. Von hier oben aus konnte sie sogar das Meer sehen: einen winzigen blauen Zipfel Flensburger Förde. Irgendwo dort draußen lagen die beiden Inseln, an denen sie zuvor vorbeigefahren waren. Dieser Gedanke ließ das beklemmende Gefühl, das sich im Wohnzimmer ihrer bemächtigt hatte, von Elina abfallen. Irgendwann spürte sie etwas Feuchtes an ihrer Handfläche: Die Hündin Leonie, die Urs hinausgelassen haben musste, hatte sich zu ihr gesellt und stupste sie mit der Nasenspitze an.
»Na, ist dir da drinnen auch zu viel Trubel?« Sie kraulte die Hündin hinter den Ohren. Als kurz darauf Stimmen von unten laut wurden und ihre Klassenkameraden sich zum Aufbruch rüsteten, gelang es Elina, ihren Aussichtsposten unbemerkt zu verlassen und sich wieder zu den anderen zu gesellen. Nur Urs hob den Kopf und lächelte leicht, als sie mit Leonie im Schlepptau den Hang hinuntergeschlichen kam, doch er sprach sie nicht auf den kleinen Ausflug an.
Am letzten Schultag bot er seinen Schülern an, sie könnten ihn auch nach dem Abschluss jederzeit besuchen kommen. Elina nickte wie die anderen, aber tatsächlich bei ihrem ehemaligen Lehrer an der Tür zu klingeln wäre ihr niemals eingefallen. Wer machte so etwas schon? Dass sie ihn ausgerechnet in der Sønderborger Innenstadt wiedertreffen musste, genau in dem Augenblick, als sie von zwei Sicherheitsbeamten aus dem Einkaufszentrum abgeführt wurde, erschien ihr im ersten Moment schlimmer als die Strafe, die ihr vielleicht später drohen würde. Instinktiv zog sie den Kopf ein und hoffte, dass er sie nicht erkannte. Doch der sonst eher kurzsichtige Mann zögerte nur einen Atemzug lang, bevor er auf sie zukam.
»Elina, bist du das?«, sprach er sie an, und ihr blieb nichts anderes übrig, als stumm zu nicken.
»Du kennst die rabiate Kleine wohl?«, wurde Urs von einem der beiden Wachleute gefragt. Der Schweizer bejahte.
»Was ist denn passiert«, wandte er sich dann an Elina. »Du hast doch nichts gestohlen, oder?«
Elina schüttelte den Kopf.
»Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf«, mischte sich der Wachmann erneut ein. »Du hättest deine Enkelin, oder was auch immer sie ist, besser erziehen sollen.« Der Mann schien ganz selbstverständlich davon auszugehen, Elina und Urs seien nahe Verwandte, und Urs widersprach ihm nicht. »Geklaut hat sie zwar nicht, aber da oben«, der Mann deutete vielsagend auf das Logo des Jobcenters, das in einem der Fenster im zweiten Stock prangte, »ein heilloses Durcheinander angerichtet. Ich kann ja verstehen, dass man manchmal ’ne Mordswut auf die Behörden hat«, fuhr er in belehrendem Ton fort. »Aber man muss sich schon zusammenreißen. Die Leute da tun schließlich nur ihre Arbeit.«
Erst jetzt kam Elina die Sachbearbeiterin wieder in den Sinn. »Die Frau, Ulla Ottosen, was ist mit ihr?«, wagte sie vorsichtig zu fragen. »Ist sie okay? Es war nicht mit Absicht, ich …«
»Wer’s glaubt!«, fuhr der zweite der beiden Wachmänner grob dazwischen, doch sein Kollege antwortete in beschwichtigendem Ton: »Sie wird wohl ein paar blaue Flecken davontragen, aber schlimmer war es nicht, soweit ich sehen konnte. Die Polizei einschalten müssen wir leider trotzdem, so sind die Regeln. Es sei denn, die Kleine ist minderjährig? Dann könnte man eventuell ein Auge zudrücken.« Wieder hatte sich der Mann an Urs gewandt, aber der konnte nur bedauernd den Kopf schütteln.
So kam es, dass Elina auf das nahe gelegene Polizeirevier geführt wurde und zunächst im Arrest landete. Wie Urs es schaffte, als Besucher vorgelassen zu werden, wusste Elina nicht. Vielleicht hatte er einfach weiterhin seine Rolle als ihr Großvater oder Onkel gespielt, und niemandem war es in den Sinn gekommen, seine Identität infrage zu stellen. Er war einfach da, auch als sie am nächsten Tag entlassen wurde. Wie selbstverständlich ging er neben ihr her, und während sie langsam durch die Stadt wanderten, erzählte Elina ihm alles: vom Tod ihrer Mutter, der abgebrochenen Abendschule und dem drohenden Rausschmiss aus dem Wohnheim. Zuerst kamen die Worte langsam und stockend, dann schneller, ohne dass Urs weiter nachfragen musste. Elina konnte sich nicht daran erinnern, jemals so lange Zeit am Stück mit jemandem geredet zu haben. Sie hatte auch nie das Verlangen danach verspürt, jetzt jedoch tat es gut. Schließlich schwiegen sie beide.
»Meine Mutter lebt auch nicht mehr«, sagte Urs irgendwann leise.
Ende der Leseprobe