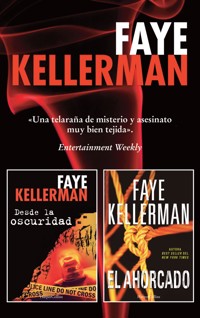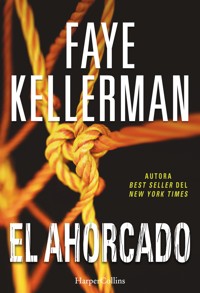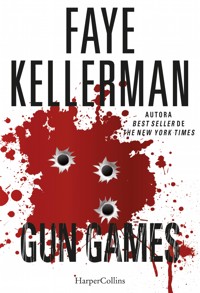8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Decker/Lazarus-Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach 30 Jahren in L.A. will Detective Peter Decker die Zeit bis zur Pensionierung etwas ruhiger angehen lassen. Aus diesem Grund ziehen er und seine Frau Rina Lazarus nach Greenbury in der Nähe von New York. Bis auf ein paar Führerscheinkontrollen bei betrunkenen Studenten passiert in dem kleinen College-Städtchen kaum etwas – und Decker langweilt sich. Als aus einer Familiengruft wertvolle Artefakte entwendet und gegen Fälschungen ersetzt werden, beginnt Decker voller Elan zu ermitteln und stößt im Umfeld der Kunstakademie auf einen Kunstfälscherring – dann wird die Leiche einer verdächtigen Studentin aufgefunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Nach dreißig Jahren in L.A. will Detective Peter Decker die Zeit bis zum Ruhestand etwas ruhiger angehen lassen. Aus diesem Grund ziehen er und seine Frau Rina Lazarus nach Greenbury in der Nähe von New York. Bis auf ein paar Führerscheinkontrollen bei betrunkenen Studenten passiert in dem kleinen College-Städtchen kaum etwas – und Decker langweilt sich. Als aus einer Familiengruft wertvolle Artefakte entwendet und durch Fälschungen ersetzt werden, beginnt Decker voller Elan zu ermitteln und stößt im Umfeld der Kunstakademie auf einen Kunstfälscherring – dann wird die Leiche einer verdächtigen Studentin aufgefunden …
Zur Autorin
FAYE KELLERMAN war Zahnärztin, bevor sie als Schriftstellerin mit ihren Kriminalromanen international und auch in Deutschland riesige Erfolge feierte. Sie lebt zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann, dem Psychologen und Bestsellerautor Jonathan Kellerman, in Los Angeles.
FAYE KELLERMAN
WOHIN DIE GIER DICH TREIBT
EIN DECKER/LAZARUS-KRIMI
Aus dem Amerikanischen von Frauke Brodd
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Murder 101 bei William Morrow, New York.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung April 2016
Copyright © 2014 by Plot Line, Inc.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 bei btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Giulio Musardo/Arcangel Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16595-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Besuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
Für Jonathan
Und für Lila, Oscar, Eva und Judah
1
Als er die fertige Arbeit noch einmal überprüfte und gegen eine nackte Glühbirne hielt, wurde er von dem leuchtenden Farbspektrum in allen Schattierungen des Regenbogens geblendet. Das opalisierende Glas war eine hübsche Sache, aber erst die mundgeblasenen klaren Einschübe in Smaragdgrün, Rubinrot und Saphirblau machten das Stück zu einem echten Knaller, da durch sie sensationelle Lichtstrahlen auf seine Wände und Möbel fielen.
Das Buntglas war erstklassig: die Ausführung der Arbeit … eher nicht. Die Lötnähte zwischen den Scherben sahen schlampig aus, und das bisschen Malerei auf dem Glas lag nur leicht über dem Durchschnittsniveau eines Volkshochschulkurses. Doch an seinem momentanen düsteren und nasskalten Ort würde sowieso niemandem der Unterschied zwischen dem Original und seinem trügerischen Platzhalter auffallen. Die dämlichen Wärter stellten gar kein Problem dar. Und deshalb sollte der Austausch der reinste Spaziergang werden, denn er konnte die Arbeit in einer Aktentasche verstecken. Sogar sein Werkzeugkoffer war größer und sperriger. Er hatte es schon mal geschafft. Und er würde es wieder hinkriegen.
Manchmal fragte er sich wirklich, warum er sich noch mit diesem Kleinkram abgab. Vielleicht nur, um sein Hirn wach zu halten, denn dieses kleine Ränkespiel war nichts im Vergleich zu seinen Zukunftsplänen. Doch um eine so große Sache durchzuziehen, brauchte man Zeit. Ihm sollte es recht sein. Er würde geduldig abwarten.
Die Glocken läuteten zwei Uhr in der Nacht: Es ging los. Zuerst schminkte er sich mit einem Make-up-Schwämmchen das Gesicht dunkelbraun. Dann rief er Angeline auf einem Wegwerfhandy an und befahl ihr, draußen auf ihn zu warten, er wäre in fünf Minuten da. Sorgfältig wickelte er die Arbeit in Luftpolsterfolie ein und schob sie in seine Aktentasche aus Leder. Sein Werkzeugkoffer war bereits im Auto.
Er sah noch mal auf die Uhr. Dann zog er die schwarzen Handschuhe über und bedeckte seinen Kopf und sein Gesicht mit einer schwarzen Skimaske. Danach wickelte er sich den schwarzen Schal um den Hals: eine gute Tarnung, aber bei der Kälte absolut notwendig. Ein letzter prüfender Blick in den Spiegel – alles sah perfekt aus. Er war nur mehr ein tiefschwarzer Schatten, der durch die Nacht schwebte.
Hüte dich vor deinen Wünschen.
Nach drei Jahrzehnten Polizeiarbeit als Detective Lieutenant in Los Angeles hatte Peter Decker geplant, es ab sechzig ruhiger angehen zu lassen, irgendwas zwischen Vollpensionierung und der Achtzig-Stunden-Woche aus seinem früheren Leben. Er wusste, dass er mit seinem wachen Verstand und seinem Hang zur Ruhelosigkeit noch nicht bereit war, die Uniform schon ganz an den Nagel zu hängen. In seiner Fantasie bot eine ideale Anstellung geregelte Arbeitszeiten mit freien Abenden und Wochenenden.
Die gute Nachricht lautete, dass er jetzt einen überschaubaren Schreibtischjob hatte mit Einsätzen, bei denen er zu älteren Mitbürgern mit Schmerzen in der Brust, vermissten Haustieren und zur Überprüfung betrunkener Teenager nach Samstagnacht-Saufgelagen gerufen wurde. In die Nähe richtiger Verbrechen war er in den letzten sechs Monaten höchstens mal durch die Anrufe wegen einer Einbruchsserie gekommen, bei der die Diebe Elektronisches stibitzt hatten – Handys, Laptops und Tablets. Keiner dieser Diebstähle war verwunderlich, denn Greenbury war eine Stadt, in der es ab September von Studenten nur so wimmelte, die sie dann im Juni wieder entließ.
Die Five Colleges of Upstate New York war ein Konsortium liberaler geisteswissenschaftlicher Hochschulen, jede mit einer eigenen Ausrichtung. Ein College hatte sich auf Mathematik und Naturwissenschaften spezialisiert, ein anderes auf Betriebswirtschaft und Ökonomie. Ein drittes war ein reines Mädchen-College, und das vierte legte den Schwerpunkt auf bildende Künste, Theater und Sprachen. Das fünfte College – Duxbury – galt als Eliteakademie, gegründet 1859, ein paar Jahre vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Die weitläufigen Campusse mit ihren Gebäuden aus Ziegel- und Backstein verteilten sich auf hunderten Quadratmetern einer dicht und üppig bewachsenen Landschaft aus Parkanlagen, natürlichen Wasserquellen und lichtem Wald. Das Ganze bildete eine Welt für sich, mit einer eigenen Polizei, wodurch Deckers Wirken als Polizist noch eingeschränkter war.
Zwischen den Einheimischen und den Studenten kam es selten zu Zwischenfällen, da in Greenbury Rentner und Familien aus der arbeitenden Mittelschicht lebten. Ihnen gehörten die meisten unabhängigen Geschäfte und Restaurants, die die Wirtschaft der Stadt ankurbelten. Die Studenten kamen meist aus stinkvornehmen Familien und wussten sich ganz gut zu benehmen, auch wenn sie gerne die Nächte durchfeierten.
Der alte Teil von Greenbury war eine typische Collegestadt, dessen Straßen man nach Harvard, Yale und Princeton benannt hatte. In den Straßen befanden sich haufenweise Franchise-Geschäfte: Outsider Sportswear, Yogurtville, Rentaday-Autovermietung, Quikburger. Es gab ein Triplex-Kino, ein halbes Dutzend billige Klamottenläden, mehrere Nagelstudios, Fahrradverleihe, einen Bioladen und unendlich viele Bars und Restaurants. Jede angesagte Essensrichtung war vorhanden, sogar ein koscheres Café mit Take-away-Service, das Rina nahezu täglich aufsuchte.
Decker dachte an seine Frau.
Wenn jemand Eingewöhnungsprobleme haben würde, davon war Decker ausgegangen, dann Rina. Doch in Wahrheit hatte sie sich viel schneller zurechtgefunden als er. Sie stürzte sich in die Arbeit bei der örtlichen Hillel, die für alle fünf Colleges zuständig war, und bot an, für interessierte Studenten bei sich zu Hause freitagabends ein Essen auszurichten. Als zu viele Studenten ihr Interesse bekundeten, wurden die Abendessen in einen Speisesaal in der Hillel verlegt. Das Essen wurde von den Studenten zubereitet, aber Rina war fast jeden Donnerstag und Freitag da und packte beim Kochen und Backen mit an. Weil das ihre freie Zeit immer noch nicht ausfüllte, erklärte sie sich bereit, ehrenamtlich als Thora-Lehrerin zu arbeiten, wenn die Hillel ihr einen Raum zur Verfügung stellen würde. Sie machte einen Aushang mit einer Einschreibeliste und rechnete mit höchstens fünf Kindern.
Es kamen sieben.
Die Sache sprach sich herum, und einen Monat später waren es achtzehn Kinder. Daraufhin fragte man sie, ob sie Lust hätte, einen Einführungskurs in Hebräisch zu unterrichten. Sie sagte zu. Meistens hatte sie abends mehr vor als er. Decker gab es nur ungern zu, aber er langweilte sich. Schlimm genug, dass seine Tage quälend ereignislos waren, aber dann bat ihn der Captain, Mike Radar, auch noch, mit dem Bengel als Partner loszuziehen. Daraufhin wurden seine Tage noch länger und noch quälender.
Tyler McAdams, sechsundzwanzig Jahre alt und Harvard-Absolvent, war knapp eins achtzig groß und keine siebzig Kilo schwer. Er hatte haselnussbraune Augen und dunkelbraune, teuer frisierte Haare. Zu seinen adlergleichen Gesichtszügen gehörte eine römische Nase. Er war nicht schmächtig, aber auch nicht muskulös. Er sah aus wie das, was er war – ein Ivy-League-Bengel aus einer wohlhabenden Familie. Er trug teure Kleidung, einen Mantel aus Kaschmir, und die goldenen Uhren an seinem Handgelenk wechselten täglich.
Innerhalb kürzester Zeit war es McAdams gelungen, jeden auf dem Revier mit seiner endlosen Meckerei, er sei schlauer, attraktiver und besser ausgebildet als alle anderen in seiner nächsten Umgebung, vor den Kopf zu stoßen. In seiner Nörgelei lag ein Körnchen Wahrheit – er war schlau und sah gut aus –, aber das ständige Gejaule minderte seine erkennbaren Vorzüge umgehend. McAdams behauptete, er hätte den Job ursprünglich nur aus Neugier auf die Polizeiarbeit angetreten, obwohl er ja an der Harvard Law School angenommen worden sei. Er hatte trotzdem beschlossen, den Studienbeginn um ein paar Jahre zu verschieben, denn er ging davon aus, dass die Arbeit ihm einen Vorsprung vor all den anderen Strebern und Idioten verschaffte.
So lautete zumindest die offizielle Version.
Decker hakte nicht nach, denn es interessierte ihn kein bisschen.
McAdams’ Anstellung war purer Nepotismus. Sein Vater war einer der Hauptgeldgeber des Duxbury College. Der Dekan hatte einen Gefallen beim Bürgermeister, Logan Brettly, eingefordert, der wiederum im Gegenzug einen Gefallen bei Radar abrief. McAdams brachte keinerlei Erfahrung im Polizeivollzugsdienst mit, aber die brauchte er auch nicht, denn es passierte nicht viel, wofür man ein tiefschürfendes Know-how besitzen müsste.
Also war Decker damit einverstanden, den Bengel mit auf seine Runde zu nehmen, und hörte ihm beim Meckern und Jammern zu. Diesmal beschwerte er sich über ihren nächsten Einsatz auf der Liste: eine ältere Dame mit Schmerzen in der Brust. Die Feuerwehr absolvierte gerade ihre monatliche Pflichtübung, deshalb war der Anruf bei der Polizei gelandet. Ein Streifenwagen hätte das erledigen können, aber Decker meldete sich freiwillig. Er erwähnte den Anruf McAdams gegenüber nicht, aber als er aus der Tür ging, sprang der Bengel auf und schnappte sich seinen Schickimicki-Mantel, um ihn zu begleiten. Das machte er jedes Mal. Vielleicht lag es daran, dass Decker ihm kommentarlos zuhörte.
Lucy Jamison war sechsundachtzig, eine blasse und schmächtige Witwe. Als Decker ihr vorschlug, sie ins Krankenhaus zu fahren, zögerte sie, denn es ging ihr bereits besser. Decker brachte ihr ein Glas Wasser und sorgte dafür, dass sie es ganz austrank. Der Winter war trügerisch, und alte Leute dehydrierten leicht, weil es drinnen und draußen trocken war.
Die alte Dame erzählte aus ihrem Leben als junges Mädchen in Michigan. Sie zeigte Decker und Tyler Fotos ihrer Kinder, ihrer Enkel und Urenkel. Decker senkte die Heizung von knapp siebenundzwanzig auf dreiundzwanzig Grad. Irgendwann meinte sie, alles sei wieder in Ordnung, und Decker gab ihr seine Visitenkarte. Sie brachte die beiden zur Haustür und winkte ihnen hinterher, als sie über den knirschenden Schnee unter ihren Stiefeln zurück zum Auto gingen.
Unterwegs zum Revier drehte Decker die Heizung im Auto auf, Adams rieb sich die Hände vor der warmen Lüftung. Der Bengel trug einen Mantel und Handschuhe, aber nichts auf dem Kopf. Was nicht hieß, dass er unbedingt einen Hut brauchte. Die Temperatur lag knapp über null, es war sonnig, und der Himmel war blau. Durch die Stadt zog der Geruch nach Pinien und brennendem Holz. Weiß bedeckte Hügel lagen wie Wellen in der Ferne. Zum Hudson war es nicht sehr weit, doch zwischen hier und der nächsten Küste lagen zig Kilometer, und daran musste Decker sich erst noch gewöhnen.
»Wie halten Sie das seit dreißig Jahren aus, alter Herr?«
Decker hasste es, wenn der Bengel ihn »alter Herr« nannte. Er war nicht mehr jung, aber auch nicht reif fürs Schlachthaus. Immerhin hatte er noch dichtes graues Haar, einen ansehnlichen Bart mit Überbleibseln seiner einst roten Haare und einen wachen und scharfsinnigen Verstand. Anstatt also die rhetorische Frage zu beantworten, sagte er: »Das waren diese Woche die dritten Schmerzen in der Brust. Sie müssen endlich Ihr Herz-Lungen-Wiederbelebungstraining absolvieren.«
»Ganz sicher berühren meine Lippen nicht die dieser alten Spinatwachtel. Sie hatte Mundgeruch.«
»Azeton«, erwiderte Decker, »von einer schlecht eingestellten Diabetes.«
»Völlig egal«, moserte McAdams, »und außerdem würden sowieso Sie die Wiederbelebung übernehmen, wenn wir beide vor Ort wären.«
»Darum geht’s nicht. Sie sollten diese Qualifikation einfach haben. Jeder erwartet von einem Polizisten, dass er eine Mund-zu-Mund-Beatmung beherrscht, genauso, wie jeder davon ausgeht, dass ein Polizist mit einer Waffe umgehen kann.«
»Wir tragen keine Waffen.«
»Wir tragen keine, aber wir haben welche, falls wir sie brauchen. Sie wissen doch, wie man schießt … oder hat man Ihnen das auch durchgehen lassen?«
»Wenn Sie mich ausstechen wollen, haben Sie eh schon verloren.«
»Klar, Sie haben den Vorteil der Jugend und eine bessere Erziehung auf Ihrer Seite. Ich habe die Erfahrung. Das sind ein paar Pluspunkte.«
»Niemand verwendet heute noch den Begriff ›Pluspunkte‹, und außerdem gibt’s keinen Grund, abfällige Bemerkungen zu machen, bloß weil ich hier draußen mit Ihnen im Schützengraben unterwegs bin.«
»Schützengraben?«
»Hören Sie einfach auf, mich Ihren Rang spüren zu lassen, okay? Ich komme Ihnen immer zuvor.« McAdams blickte aus dem Fenster. »Ich will Sie nicht runterputzen, Decker, aber sollte ich tatsächlich verrückt genug sein, hier meine Karriere zu absolvieren, dann wäre ich wahrscheinlich in … sagen wir, vier oder fünf Jahren ein hohes Tier bei der Polizeibehörde in New York.«
»Glauben Sie?«
»Ich weiß es. Es geht nicht um Erfahrung oder darum, Prüfungen zu bestehen und sich Sporen zu verdienen. Man muss nur checken, wie das System funktioniert, und darin bin ich Weltmeister. Ich lerne genau das, was ich brauche, um den Job zu erledigen. Mir den Kopf mit überflüssigem Wissen vollzustopfen, finde ich ineffizient. Zum Beispiel die Kenntnis von Wiederbelebungsmaßnahmen. Wir werden irgendwohin gerufen, und ich weiß, dass Sie die Sache übernehmen. Sie oder Roiters oder Mann oder Milkweed …«
»Nickweed.«
»Von mir aus. Wenn wir einen Anruf bekommen und eine Mund-zu-Mund-Beatmung ansteht, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Warum sollte ich also meine Zeit damit verschwenden, etwas zu lernen, das ich niemals brauchen werde?«
»Weil es durchaus passieren kann, dass keiner von uns in der Nähe ist, und dann stehen Sie da wie ein Vollidiot. Wäre ich Ihr Vorgesetzter, würde ich Sie glatt zwingen.«
»Sind Sie aber nicht. Und da ich Sie nicht um Ihre Meinung gebeten habe, schlage ich vor, Sie sparen sich Ihre Spucke. Muss ich Sie daran erinnern, dass einem Typen in Ihrem Alter nicht mehr viel davon übrig bleibt?«
Decker verbiss sich ein Grinsen. Er ärgerte den Bengel mit voller Absicht und genoss jede Minute. »Bei Ihnen brennen leicht die Sicherungen durch. Daran sollten Sie ebenfalls arbeiten.«
»Erinnern Sie mich noch mal daran, warum ich freiwillig mit Ihnen auf Tour gehen wollte.«
»Lassen Sie mich raten«, Decker schmunzelte, »ich glaube, Sie gehören zu den Kerlen, die darauf hoffen, etwas von meiner enorm vielseitigen Erfahrung in der Polizeiarbeit mitzubekommen. Ich glaube, Sie stellen sich vor, dass ich Ihnen vielleicht irgendwas wahnsinnig Originelles oder Faszinierendes erzählen werde, und dann können Sie daraus einen Roman basteln. Oder noch besser, ein Drehbuch. Ich kann Sie mir gut in Hollywood vorstellen. Sie passen da bestens rein.«
»Jetzt sind Sie ganz schön herablassend, aber das geht klar. Echt hart, bei jemandem, der so jung ist wie ich, Juniorpartner und intellektuell unterlegen zu sein.«
»Nä, daran bin ich gewöhnt. Sie kennen meine Kinder nicht.«
»Aber Sie arbeiten nicht mit Ihren Kindern zusammen.«
»Stimmt. Und ich arbeite auch nicht mit Ihnen zusammen, McAdams. Wir fahren bloß zusammen im Auto herum, und besonders geistreich unterhalten wir uns auch nicht.«
»Wenn Sie über Proust reden wollen, bin ich dabei.«
»Klar, erzählen Sie mir was über Proust. Ich mag Madeleines, meine Frau backt sie manchmal.«
»Er war ein Langweiler, und ich hasse Philosophie. Ist mir zu mathematisch, da lag noch nie meine Stärke. Ich hatte zwar 720 Punkte im SAT-Test, aber das ist in Harvard Durchschnitt.« Als Decker nichts erwiderte, rutschte der Bengel auf dem Sitz herum und fragte schließlich: »Was war denn Ihr Lieblingsfall?«
»Fehlanzeige, Harvard. Sie müssen schon Ihre eigenen Erfahrungen für Ihren Film benutzen, obwohl … der liebe Gott stehe uns beiden bei, sollten wir je einen echten Fall abkriegen. Keinen gewöhnlichen Totschlag, sondern einen richtigen Mord mit unbekanntem Täter.«
»Mord oder Totschlag? Ist das nicht alles dasselbe?«
»Nein. Haben Sie überhaupt die geringste Ahnung, wie man eine Ermittlung führt?«
»Nur aus dem Fernsehen … läuft das denn so viel anders?«
»Sie reißen Witze, oder?« Als McAdams still wurde, bekam Decker ein geringfügig schlechtes Gewissen. Warum spielte er das eigentlich durch? Der Bengel schwieg zum Glück den Rest ihrer Tour über und schmollte weiter, bis er um fünf Feierabend machte.
Wäre er nicht so ein Fatzke, hätte Decker eventuell sogar Mitleid mit ihm. Der Bengel passte nicht zu seinen Kollegen; tatsächlich passte er nirgendwohin. Er war kein Student mehr, aber im Vergleich zu den übrigen Bewohnern Greenburys war er trotzdem zu jung. Was für ein soziales Leben bot sich ihm denn schon? Wäre er ernsthaft an der Arbeit eines Polizisten interessiert, hätte Decker ihn zum Abendessen eingeladen. Aber Decker arbeitete nicht als ehrenamtlicher Sozialhelfer. Man erntet, was man sät. Punkt. Aus. Ende.
Das Leben in einer Kleinstadt hatte seine Vorteile, vor allem, wenn man eine Immobilie in Los Angeles zu verkaufen hatte und in Greenbury etwas suchte. Rina und er waren mit einem hübschen finanziellen Polster von dannen gezogen. Ihr neues Haus in der Minnow Lane war um 1900 erbaut worden, mit einem erstaunlich flachen Dach, drei Schlafzimmern, zweieinhalb Bädern und einem Kamin zur Unterstützung der launischen Zentralheizung. Das schlagende Argument für den Kauf waren die Umbauarbeiten des Vorbesitzers. Er hatte die Decke geöffnet und die Balken sichtbar gemacht. Es sah nicht nur toll aus, sondern erlaubte Decker mit seinen eins fünfundneunzig, sich im Haus zu bewegen, ohne sich ständig den Kopf an Türrahmen zu stoßen. Im Moment war der Garten braun und tot, aber sie hatten das Haus im Herbst gekauft, als das Laub feuerrot und das Klima frisch und angenehm gewesen war. Der hiesige Frühling würde sich wie ein echter Frühling anfühlen, nicht so wie der in Los Angeles, mit Nebel und Smog.
Zum Haus gehörte nur eine Garage, in der Decker seinen Porsche parkte, während Rinas alter Volvo in der Einfahrt stand. Decker enteiste jeden Morgen Rinas Windschutzscheibe und fuhr ihren Wagen auf die Straße, damit er freie Bahn hatte. Das war das Mindeste, was er tun konnte, nachdem er sie hierherverschleppt hatte, um seinem Traum nachzujagen.
Der Hauptvorteil ihres neuen Wohnortes lag darin, dass ihre vier biologischen Kinder – zwei von ihr, eins von ihm, ein gemeinsames – und ihr Pflegesohn Gabe Whitman, der als klassischer Konzertpianist meistens auf Tournee war, jetzt mit dem Auto leicht erreichbar waren. Zwei der fünf waren verheiratet, also gehörten zu der bunten Mischung noch Ehepartner und Enkelkinder. Deckers Tochter Cindy, die in Los Angeles in der Abteilung für schweren Autodiebstahl gearbeitet hatte, ging nun in Philadelphia auf Streife. Aber es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie wieder zum Detective befördert werden würde.
Im Haus war es warm, und der in der Luft schwebende Duft nach Essen ließ gleich Deckers Laune steigen. Rina werkelte in der engen, aber modernisierten Küche, ihre Haare aus Glaubensgründen unter einer Strickmütze zusammengebunden. Sie trug einen dünnen blauen Baumwollpullover und einen knielangen Jeansrock und rührte in einer Suppe für das morgige Schabbes-Abendessen herum. Sie benutzte einen großen Topf, was Gäste bedeutete.
»Wie viele erwarten wir?« Decker gab ihr einen Kuss auf die Wange.
Rina erwiderte seine Begrüßung mit einem Kuss auf den Mund. »Sechs bis acht. Aber beim Mittagessen sind wir allein, also gräm dich nicht.«
»Ich habe gerne Gesellschaft.«
»Lügner. Zumindest bist du kein Spielverderber. Zieh dich um, wir essen in ungefähr zehn Minuten.«
Decker setzte sich auf einen Stuhl an der Frühstückstheke. »Ich unterhalte mich lieber mit dir. Zur Abwechslung mal in angenehmer Gesellschaft.«
»Der Bengel geht dir immer noch auf die Nerven.«
»Er geht allen auf die Nerven.«
»Warum lädst du ihn nicht morgen zum Abend …«
»Nein.«
»Beschreite den rechten Weg, Peter.«
»Ich beschreite überhaupt gar keinen Weg. Er ist ein fieser, herablassender Typ. Schlimm genug, dass ich mich bei der Arbeit mit ihm abgeben muss. Warum sollte ich mir von ihm das Wochenende ruinieren lassen, oder noch schlimmer, ihn auf dich hetzen? Er wird mich letztlich bloß damit hänseln, wie gläubig, engstirnig und provinziell ich bin.«
»Oder er lernt dich von einer anderen Seite kennen.«
»Wenn ich ihn einlade, würde es ihn nur in seinem Wahn bestärken, er sei mein Vorgesetzter.«
»Der Junge mag ja ein Rotzlöffel sein, aber ich garantiere dir, dass er sehr wohl weiß, wer der echte Polizist ist. Wahrscheinlich fühlt er sich wie ein Hochstapler.«
»Er ist ein Hochstapler.«
»Gib ihm eine Chance.«
»Von mir wird er keine Einladung annehmen.«
»Vielleicht von mir.« Rina griff nach dem Telefon. »Hast du seine Handynummer?«
Nachdem Decker ihr die Nummer gegeben hatte, tippte sie die Ziffern ein und wartete. »Hallo, ich suche Tyler McAdams.«
»Sie haben mein Handy angerufen, dann werde ich das wohl sein. Und wer sind Sie?«
Decker bekam seine Antwort mit und konnte sich ein unhörbares Ich hab’s dir gesagt nicht verkneifen.
Rina redete unbekümmert weiter. »Hier spricht Rina Decker. Mein Mann und ich würden Sie gerne morgen Abend zum Essen einladen.« Die Leitung blieb lange still. Sie fuhr fort. »Ich weiß nicht, ob Peter es Ihnen gesagt hat, aber wir sind praktizierende Juden. Morgen haben wir sechs bis acht Studenten von den Colleges zu Gast, und vielleicht interessiert es die jungen Leute, was man so tut nach dem Abschluss, auch wenn es nur ein vorübergehender Job ist.«
McAdams rang sich endlich ein »Äh, vielen Dank« ab.
»Sehr gerne. Wenn es Ihnen ungelegen kommt, können wir es auch auf ein andermal verschieben. Freitagabends haben wir normalerweise immer Gäste, also bleibt die Einladung bestehen. Aber ich würde Sie wirklich gerne kennenlernen. Ich überprüfe alle Partner meines Mannes.«
»Nein, tust du nicht«, flüsterte Decker.
Sie gab ihm einen spielerischen Klaps. »Bitte sagen Sie zu.«
»Klar … super. Um wie viel Uhr?«
Decker verzog schmerzhaft das Gesicht. Rina drohte ihm mit dem Finger. »Halb sieben. Es ist recht ungezwungen. Und ich bin eine großartige Köchin.«
»Klingt nach einer Win-win-Situation, weil ich sehr gerne esse. Danke für die Einladung.«
»Keine Ursache. Wir freuen uns auf Sie. Wiedersehen.« Sie legte auf. »Erledigt.«
»Es reicht, dass er bei der Arbeit wie eine Klette an mir hängt, aber wenn er erst mal in den Genuss deiner Kochkünste gekommen ist, werde ich ihn überhaupt nicht mehr los.«
Rina nahm die Kasserolle aus dem Ofen. »Es haben sich schon viele an deinen Erfolg drangehängt, und es hat dir nie geschadet. Du hast ein breites Kreuz. An einem Jüngelchen mehr wirst du dich nicht verheben.«
2
Der Bengel war pünktlich, was völlig in Ordnung gewesen wäre, außer dass die Studenten grundsätzlich das akademische Viertel zu spät kamen. Rina begrüßte ihn an der Tür und ließ ihren Charme spielen, während Decker es vorzog zu schmollen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die übrigen Gäste eintrafen. Die Gruppe – vier Jungs und zwei Mädchen – brachte Blumen und Wein mit, woraufhin der mit leeren Händen gekommene McAdams peinlich berührt dastand.
»Machen Sie sich deshalb keine Sorgen«, sagte Decker.
»Ich mache mir keine Sorgen, aber ich bin nicht gerne der Trottel.«
»Wenn sich das so einfach mit einer Flasche Wein beheben ließe.« Decker grinste und legte dem Bengel einen Arm um die Schultern, als er ihn zum Tisch führte. »Kommen Sie, Harvard, entspannen Sie sich.« Alle wurden einander vorgestellt. Dann flüsterte Decker ihm zu: »Wir müssen jetzt einige Segenssprüche machen. Der erste gilt einem Becher Wein …«
»Ich weiß, was ein Kiddusch ist«, unterbrach McAdams ihn. »Selbst in der Ivy League gab es ein oder zwei Juden. Ich hatte mal eine jüdische Freundin.«
»Was ist passiert?«
»Sie ist nicht mehr meine Freundin, das ist passiert.«
»Sie hat Sie abserviert.« Als McAdams ihm einen wütenden Blick zuwarf, sagte Decker: »So was kommt vor.« Dann ging er zu seinem Platz am Kopfende des Tisches.
»Tyler«, Rina übernahm das Ruder, »setzen Sie sich doch zwischen Adam und Jennifer. Beide interessieren sich für Jura, und wie ich weiß, wurden Sie an der Harvard Law School angenommen.«
»Adam und McAdams, das klingt schon nach einer Anwaltskanzlei.«
Rina lächelte. »In der Tat.« Sie platzierte die übrigen Studenten, und dann sprach Decker den Kiddusch. Früher einmal war er über die hebräische Aussprache gestolpert, aber nach fünfundzwanzig Jahren des Zusammenspiels ihrer Kultur und seiner Erbanlagen konnte er den Segensspruch fließend aufsagen. Nachdem alle von dem Wein getrunken hatten, wuschen sie sich die Hände und sprachen eine weitere Segnung, und dann schloss Decker mit dem Hamozi-Segen über dem Brot.
Endlich konnte das Essen so richtig beginnen: Suppe, Salat, Rippchen, Linsen mit rotem Pfeffer und Zwiebeln, grüne Bohnen mit Haselnüssen und zum Nachtisch ein Streuselkuchen mit gemischten Beeren. Es war genug, um die Reißverschlüsse und Hosenknöpfe an jeder Taille zum Platzen zu bringen. Die Studenten und Rina diskutierten angeregt den wöchentlichen Thora-Abschnitt, den Paraschat Haschawua. Die jungen Leute waren aufgeweckt und von ihren Meinungen überzeugt. McAdams dagegen blieb schweigsam. Wie viele der weltlichen Oberschicht-Kids seiner Generation war er vermutlich nicht bibelfest. Aber er war höflich und antwortete, wenn man ihn etwas fragte.
Gegen neun ging die Einladung ihrem Ende zu, und genau da klingelte Deckers Festnetztelefon. Rina und er tauschten Blicke aus. Deckers Vater war vor einem Jahr gestorben, doch seine Mutter, bereits Mitte neunzig, lebte noch. Rinas Eltern waren ebenfalls so alt. Deshalb gab ihnen jeder Anruf am Schabbes einen Grund zur Beunruhigung. Decker hob abwartend den Finger und ging zum Apparat, auf dessen Display die Nummer angezeigt wurde. »Der Anruf kommt von hier.«
»Gott sei Dank.« Rina war erleichtert. »Wahrscheinlich ein automatischer Werbeanruf.«
Der AB schaltete sich ein. Es war Mike Radar, und Decker nahm das Gespräch an. »Hier ist Decker. Was gibt’s, Captain?« Er hörte aufmerksam zu. »Wann? … Okay … alles klar.« Er blickte auf die Uhr. »Weiß er, wann das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde? Na gut, ich sehe mir die Sache an. Ist das weit von mir zu Hause weg? … Nein, ich kümmere mich darum. Erklären Sie mir einfach, wie ich da zu Fuß hinkomme … Nein, es macht mir nichts aus, anderthalb Kilometer sind kein Problem. Mike … nein, wirklich, Sie bleiben, wo Sie sind. Ich habe gerade gefühlt eine halbe Kuh verdrückt, und ein bisschen körperliche Betätigung würde mir guttun. Wenn es keine größere Sache ist, melde ich mich Sonntag bei Ihnen.«
Decker legte auf. »Es gab einen Einbruch auf dem Friedhof, und der Wärter ist ziemlich erschüttert. Die anderen beiden Detectives sind übers Wochenende beim Eisfischen in Kanada, daher dachte der Captain, ob es mir wohl nichts ausmachen würde, mich darum zu kümmern.«
Rina tat entrüstet. »Willst du damit sagen, deine Kollegen haben dich nicht eingeladen, sie zu begleiten?«
Decker grinste. »Ehrlich gesagt hatte ich die Wahl, aber ich habe abgelehnt. Vielleicht beim nächsten Mal.«
»Ich wäre mitgefahren«, sagte McAdams, »aber mich hat niemand gefragt.«
»Wahrscheinlich dachten sie, dass Ihr blaues Blut die Kälte nicht erträgt.« Decker seufzte innerlich. Er musste das Angebot nett und freundlich formulieren. »Kommen Sie doch jetzt mit.«
»Natürlich komme ich mit.«
»Sie nehmen das Auto. Ich treffe Sie dort in circa einer halben Stunde.«
»Ich begleite Sie zu Fuß, alter Herr.«
»Harvard, es ist wirklich kalt da draußen. Ich gehe aus religiösen Gründen zu Fuß. Kein Grund, dass Sie leiden.«
»Ich lasse nicht zu, dass Sie der Macho sind und ich das Weichei.«
»Wie Sie wollen. Ich suche nur schnell ein paar Sachen zusammen, und dann ziehen wir los.«
»Ich hole Ihre Jacke, Tyler«, sagte Rina.
»Danke.« McAdams rammte beide Hände in seine Hosentaschen. Sein Blick schoss wie ein Bündel Pfeile hin und her, und er drehte klitzekleine Kreise. Als Rina ihm seine Jacke brachte, mummelte er sich ein und rang sich ein Lächeln ab. »Danke für das Essen. Es war köstlich.«
»Gern geschehen.«
»Möchten Sie ein paar Hand- und Fußwärmer?«, fragte Decker. »Ich nehme welche mit, völlig sinnlos, sich Frostbeulen zu holen.«
»Ja, danke.«
Decker winkte Rina zum Abschied zu, dann waren sie unterwegs. Die Nacht war mondlos, und tausende von Sternen sprenkelten den dunklen Himmel wie Salzkörner auf schwarzem Samt. Ohne die Wolkendecke war die Temperatur auf minus zehn Grad gefallen. Kein Wind … nur kalte Luft und der Hauch ihres warmen Atems, der durch die Dunkelheit waberte.
»Danke für die Einladung«, sagte McAdams.
»Keine Ursache. Es war die Idee meiner Frau.«
»Ja, das habe ich mir fast gedacht. Sie ist eine gute Köchin. Und sie ist wunderbar … als Mensch, meine ich.«
»Sie ist in allen Belangen wunderbar. Ich hatte ziemliches Glück.«
»Sie haben eine große Familie«, fuhr McAdams fort, »beim Durchzählen der Gesichter auf den Fotos kam ich auf sieben.«
»Fünf Kinder, zwei Ehefrauen, Zwillings-Enkelsöhne und eine Enkeltochter.«
»Wahnsinn.« Er dachte kurz nach. »Ich nehme an, der schwarze Typ ist ein Schwiegersohn? Oder Sie waren schon mal verheiratet.«
»Ich war schon mal verheiratet, aber nicht mit Kobys Mutter. Er ist der Mann meiner ältesten Tochter Cindy, die als Polizistin in Philadelphia arbeitet. Koby studiert dort Medizin. Sie haben Zwillinge, zwei Jungs. Die anderen beiden weißen Jungs sind meine Stiefsöhne. Die Mädchen sind meine biologischen Kinder, und der Jüngste ist unser Pflegesohn, der vier Jahre bei uns gelebt hat. Er ist klassischer Pianist und hat gerade die Juilliard School abgeschlossen.«
»Beeindruckend. Was machen die anderen Kinder?«
»Sam und seine Frau sind beide Ärzte. Sie haben eine Tochter, Lily, und leben in Brooklyn. Jacob – der aussieht wie Rina – hat gerade seinen Doktor gemacht, in Politikwissenschaften. Er ist noch dabei …«, Decker lachte, »… er ist noch dabei, sich selbst zu finden. Meine andere Tochter Hannah sitzt an ihrer Abschlussarbeit an der Ferkauf School of Psychology in New York.«
»Die ist nicht schlecht … aber auch nicht super.«
»Ja, ihr Harvard-Leute glaubt, dass es nur eine einzige Uni auf der Welt gibt.«
»Nein, Princeton oder Yale akzeptieren wir auch. Das war’s dann schon.«
Decker lächelte. »Was ist mit Ihnen, McAdams?«
»Wie meinen Sie das?«
»Eltern, Brüder, Schwestern, Geburtsort? Dafür, dass Sie die ganze Zeit quasseln, wenn wir unterwegs sind, weiß ich rein gar nichts über Sie.«
»Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ich bin in der City aufgewachsen, und damit meine ich Manhattan. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich zehn war, und beide waren wieder verheiratet, bis ich vierzehn war. Ein paar Halbgeschwister, ein paar Stiefgeschwister, alle jünger und keiner so schlau wie ich. Ich habe kaum was mit ihnen zu tun.«
Über seine Familie zu reden, bereitete ihm offensichtlich Mühe, also hakte Decker nicht weiter nach. Die nächsten zehn Minuten gingen sie schweigend nebeneinander her, bis der Friedhof vor ihnen auftauchte. Das war noch so etwas Typisches für Kleinstädte: Die Friedhöfe sprangen einen direkt an und befanden sich nicht wie in Los Angeles irgendwo im Niemandsland neben einem Freeway. Dieser hier bestand aus mehreren breiten Wegen, gesäumt von hohen Grabsteinen und einem abgesonderten, durch ein Tor verschlossenen Areal für die Mausoleen – dem Tod geweihte Bauten mit geriffelten Säulen. Da der Captain einen Einbruch erwähnt hatte, musste es um eine der Gruften gehen.
»Wollen Sie frische Hand- oder Fußwärmer? Meine Füße sind Eisklumpen.«
»Ja, gerne.«
Nachdem Decker ihm eine neue Fuhre Wärmer gegeben hatte, ließ auch er selbst ein paar in Hälften gebrochene Stücke in seine eigenen Schneestiefel plumpsen. »Ah … das tut gut. Mir ist nicht wirklich kalt – nach so viel Fleisch kann einem nicht kalt sein –, aber meine Hände und Füße werden langsam taub.«
»Warum wollten Sie dann unbedingt laufen? Bestimmt gibt es eine religiöse Ausnahmeerlaubnis, für berufliche Zwecke das Auto zu nehmen.«
»Ja, und es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Was soll ich sagen, McAdams? Ich fürchte, ohne Harvard-Abschluss ist man wohl einfach gehandikapt.«
Der Wärter könnte mit seinem langen Gesicht und dem klapprigen Körper und den eingesunkenen, für Tageslicht absolut unbrauchbaren Augen glatt als Doppelgänger Ichabod Cranes aus Washington Irvings Erzählung durchgehen. Decker rechnete jeden Augenblick damit, dem kopflosen Reiter zu begegnen. Der Wärter hieß Isaiah Pellman, und seine Familie lebte seit zweihundert Jahren in Greenbury. Das sagte er ihnen gleich bei seiner Vorstellung und wollte damit wohl seinen untadeligen Charakter belegen. In Greenbury gab es jede Menge redselige Menschen und ebenso viele Sonderlinge. Exzentriker findet man auf der ganzen Welt, aber in kleineren Städten fielen sie mehr auf.
Sie unterhielten sich mit Pellman zwischen den Grabsteinen. »Die Bergman-Gruft überprüfe ich jedes Mal, deshalb war ich wirklich überrascht, als es passierte.«
Decker zückte sein Notizbuch. »Als was passierte?«
»Mein Schlüssel passte nicht mehr, das passierte.«
»Okay … also war das Schloss nicht aufgebrochen?«
»Es war aufgebrochen, aber gegen ein anderes Schloss ausgetauscht worden.«
»Ihre Schlüssel passten sonst immer?«
»Ja, Sir, immer.«
»Und Sie sind sich sicher, dass das Schloss nicht einfach nur eingefroren war?«
»Ganz sicher. Als Erstes habe ich es aufgewärmt und geölt. Der Schlüssel passte ins Loch, ließ sich aber nicht drehen. Vor vier Tagen funktionierte alles noch perfekt. Vor ein paar Stunden habe ich die Familie angerufen und ihnen die Sachlage erklärt. Sie meinten, ich solle das Schloss aufbrechen und nachsehen, ob drinnen alles in Ordnung ist. Aber ich habe ihnen gesagt, dass ich die Polizei rufen werde. Und das habe ich getan. Und jetzt sind Sie auf dem Laufenden.«
»Wem gehört die Gruft? Den Bergmans?«
»Ja-ha. Sie liegen alle da drin – Moses und Ruth und ihre drei Kinder, Leon, Helen und Harold, gemeinsam mit ihren Ehepartnern – Gladys, Earl und Mary. Ich habe es immer mit Ken Sobel zu tun. Er ist der Enkel von Helen Bergman, die Earl geheiratet hat und dadurch eine Sobel wurde. Kens älterer Cousin, Jack Sobel, wurde hier vor etwa sechs Monaten beigesetzt, mit dreiundsiebzig.«
In Dorfgeschichte kannte der Mann sich aus. »Wie alt ist die Gruft?«
»Sie wurde 1895 erbaut.«
»Und die Familie besuchte die Gruft ungefähr vor sechs Monaten anlässlich einer Beerdigung?«
»Ja-ha. Ken Sobel schaute im Herbst noch mal vorbei. Ken ist Ende sechzig. Er kommt viermal im Jahr hierher, man kann die Uhr danach stellen. Und er versichert sich jedes Mal, dass das Schloss in Ordnung ist.«
»Also hat er einen Schlüssel.«
»Ja, andere auch, aber sie tauchen hier nicht auf.«
»Könnte Ken das Schloss ausgetauscht haben?«
»Nein, Sir, das habe ich ihn gefragt, als mein Schlüssel nicht funktionierte. Er verneinte es. Und er ist derjenige, der dafür zuständig ist.«
»Befinden sich wertvolle Dinge in der Gruft?«
»Nein, außer die Leichen wurden mit Schmuck bestattet.«
»Im Judentum ist es Sitte, die Leichen ohne materielle Wertgegenstände beizusetzen«, sagte Decker.
»Sehen Sie!«, rief Pellman.
»Jawohl«, entgegnete Decker, obwohl er sich nicht sicher war, was Pellman damit gemeint hatte. »Ist so etwas schon einmal vorgekommen? Dass Ihr Schlüssel nicht funktioniert?«
»Nein, Sir, nicht auf meiner Runde.«
Während der Unterhaltung hatte McAdams die ganze Zeit ungeduldig mit dem Fuß gewackelt. »Warum gehen wir nicht einfach hinein«, sagte er schließlich, »und schauen nach? Wenn alles gut aussieht, können wir wieder nach Hause.« Er sah Pellman an. »Na ja, Sie nicht, aber ich werde nicht dafür bezahlt, mir den Arsch abzufrieren.«
Decker ärgerte sich nicht nur über die Grobheit des Bengels, sondern auch über die Unterbrechung des Gesprächs. Er trug immer erst so viele Informationen wie möglich zusammen, bevor er einen Tatort betrat … falls es sich denn hier um einen Tatort handelte. »Mr. Pellman, möchten Sie mir noch etwas erzählen, bevor wir uns umsehen?«
»Nein.« Der Mann war perplex. »Sollte ich Ihnen noch was erzählen?«
»Das war keine Fangfrage«, sagte McAdams, »ein Nein tut’s auch.«
»Lassen Sie sich Zeit, Mr. Pellman«, sagte Decker.
»Nein, nichts.«
»Okay, vielen Dank.« Decker klappte sein Notizbuch zu. »Haben Sie einen Bolzenschneider?«
»Ja-ha.« Er scharrte mit den Füßen und bewegte sich nicht vom Fleck.
»Könnten Sie ihn für mich holen?«
»Klar, aber ich weiß nicht, ob er stark genug ist, um das Schloss zu knacken.«
»Das lässt sich nur auf eine Art herausfinden.«
»Da haben Sie wohl recht«, gab Pellman zu und machte sich langsam auf den Weg zu einer Hütte, die ungefähr zweihundert Meter entfernt war.
»Komischer Kauz, aber hier sind ja alle irgendwie sonderbar.«
Decker sah den Bengel direkt an. »Unterbrechen Sie mich nicht, wenn ich jemanden befrage. Das macht mich irre.«
»Ich wollte die Sache nur beschleunigen.«
»Tyler, wahrscheinlich geht es hier um nichts, deshalb ist es nicht schlimm. Aber wenn Sie mal die Gelegenheit haben sollten, in einem echten Kriminalfall zu ermitteln, können Sie die Sache auch nicht einfach beschleunigen. Sie werden dann Dinge übersehen. Sie müssen Ihr Tempo drosseln.«
Bevor McAdams etwas entgegen konnte, kam Pellman mit dem Bolzenschneider zurück und reichte ihn Decker. »Wollen Sie die Gruft und das Schloss sehen?«
»Das wäre sehr hilfreich.«
Pellman geleitete sie im Schneckentempo zur Bergman-Gruft, einem beeindruckenden Steingewölbe mit einer Kuppel als Dach. In jeder der Außenwände befand sich ein Bleiglasfenster, durch das Tageslicht ins Innere fallen konnte. Fünf Steinstufen führten hinunter zu einer mit einem Vorhängeschloss gesicherten, massiven Tür. Aus den Tiefen stiegen keine schlechten Gerüche auf, aber es war so kalt, dass alles tiefgefroren war. Decker betrachtete erst den Bolzenschneider und dann den dünnen Bügel des Vorhängeschlosses, das auch Teenager für ihren Spind in der Schule benutzen würden. Mit wenig Muskelkraft sollte es ihm gelingen, den U-förmigen Bügel sauber durchzutrennen.
»Darf ich Ihren Schlüssel noch mal ausprobieren?«, fragte Decker.
»Klar.«
Decker steckte den Schlüssel der Marke Schlage ins Schloss und konnte ihn einen Millimeter nach rechts und nach links drehen. Das Innenleben schien nicht gefroren zu sein, der Schlüssel gehörte nur einfach nicht zum Schloss. Er gab ihn Pellman zurück. Dann reichte er den Bolzenschneider an McAdams weiter. »Auf geht’s, Harvard.«
»Ich?«
»Ja, versuchen Sie’s.«
McAdams warf ihm einen scharfen Blick zu, tat aber wie ihm geheißen und setzte den Bolzenschneider an. »Okay.« Er atmete tief ein. »Okay.« Er drückte fest zu, und der Bügel rutschte zwischen den Greifern weg. McAdams fluchte.
»Wenn Sie es bis drei nicht geschafft haben, mache ich es selbst«, sagte Decker.
»Immer mit der Ruhe, alter Herr. Ich schaff das, ich schaff das.«
Der dritte Versuch vollbrachte das Wunder. Der Bengel setzte seine ganze Kraft ein, die Schneiden glitten durch den Bügel, das Schloss ging zu Bruch. Als McAdams in die Gruft gehen wollte, hielt Decker ihn zurück.
»Wie wär’s, wenn wir das Schloss vom Boden aufheben und in eine Beweistüte verfrachten? Vielleicht handelt es hier doch um einen Tatort, und möglicherweise befinden sich Fingerabdrücke auf dem Schloss. Und wie der glückliche Zufall es so will, habe ich ein paar von diesen Papiertüten in meiner Tasche.« Decker reichte ihm eine kleinere. »Oder, Boss, wäre es Ihnen lieber, dass ich es aufhebe?«
McAdams fluchte noch mal, bückte sich aber und hob es mit seinen behandschuhten Händen auf.
»Verfrachten Sie es in die Tüte«, sagte Decker, »schreiben Sie Ihren Namen drauf sowie Datum, Uhrzeit und Ort.«
McAdams folgte den Anweisungen, dann reichte er Decker die Tüte. »Nur weil Ihre Frau mich bekocht hat.«
»Und zwar gut.« Decker holte eine Taschenlampe und eine Lupe aus seiner Tasche. Er linste durch das Vergrößerungsglas, um die Tür zu untersuchen. »Keine Spuren eines Brecheisens.« Er stieß die Tür auf und ließ seinen Blick durch das Innere schweifen, in dem sich mehrere liegende Grabsteine aus Marmor befanden, aber keine Leichen, die nicht wenigstens zwei Meter unter der Erde lagen. Decker zählte die Grabsteine. Momentan beherbergte die Gruft zehn Gräber, mit ausreichend Platz für weitere Neuzugänge. Decker reichte McAdams eine zweite Taschenlampe. »Nur für den Fall, dass Sie keine eigene dabeihaben. Die können Sie behalten.« Er wandte sich an Pellman. »Dürfte ich mir Ihre Lampe ausleihen? Sie ist heller als meine.«
»Darauf können Sie wetten.« Der Wärter händigte ihm die mit vielen Batterien bestückte Lampe aus.
»Danke.« Decker ging über die Schwelle. Im Inneren der Gruft war es nicht so kalt, wie er gedacht hatte. Dicke Wände hielten das Sonnenlicht und die Hitze ab, aber eben auch extreme Kälte. Decker sah sich um.
Der Raum war so groß wie sein momentanes Wohnzimmer, knapp zwanzig Quadratmeter, und wunderschön verziert. An der Decke befanden sich goldene Ornamente, und mit Edelsteinen besetzte Banner aus schillernden Glaskacheln waren in die Wand eingelassen. Jeder Grabstein war mit seinem Bewohner beschriftet – Name, geliebter Ehemann, Vater, Großvater, geliebte Ehefrau, Mutter, Großmutter, Geburtstag, Todestag. Nichts Ungewöhnliches, abgesehen davon, dass die Grabsteine der Matriarchin und des Patriarchen ebenfalls mit einem Buntglasmosaik verziert waren – zwei unterschiedliche pastorale Szenen, hergestellt aus winzigen Glassteinen. Er ging in die Hocke, um sich die Kunstwerke genauer anzusehen. McAdams kniete sich neben ihm hin. »Hier ist es egal«, flüsterte Decker, »aber fürs Protokoll: Knien Sie sich nicht hin. Sie zerstören damit potentielle Spuren. Denken Sie an so wenig Bodenkontakt wie möglich.«
Auch McAdams ging in die Hocke. »Ich bin nicht nur ein Eisblock, jetzt kriege ich sogar noch Muskelkater.«
Decker ignorierte ihn. »Hübsche Glasarbeit, oder?«
»Ganz okay … genauer gesagt, mehr als das. Die Ausführung ist sehr gut.«
»Jemand hat für diese Grabsteine Geld hingelegt.« Decker stand auf und ließ den Lichtstrahl Zentimeter für Zentimeter über die Wände gleiten, bis er bei den Fenstern angekommen war. Sie befanden sich drei Meter über dem Boden. Unter der Kuppel, direkt vor den vier Fenstern, hingen mit Blei eingefasste Bilder aus Buntglas, die Decker beim Betreten der Gruft zuerst nicht bemerkt hatte, da es finster gewesen war. Jetzt beleuchtete er jedes Fensterbild mit der Lampe und ließ den Strahl circa eine Minute darauf ruhen, bevor er zum nächsten überging. Mit ziemlicher Sicherheit erstrahlten sie im Tageslicht wunderschön.
»Das sind die vier Jahreszeiten.« Decker wandte sich an McAdams. »Hier der Winter, hier der Frühling, das da ist der Sommer und das der Herbst.« Er drehte sich zu Pellman um. »Hingen diese Buntglasbilder schon immer in der Gruft?«
»Seit ich hier bin, und wahrscheinlich bereits davor.«
Decker wandte sich wieder an den Bengel. »Was denken Sie?«
McAdams beleuchtete mit seiner Lampe eins nach dem anderen. »Meine Mutter besitzt ein paar Tiffany-Lampen. Ich behaupte nicht, dass das hier Tiffany ist, aber es sieht qualitativ hochwertig aus.«
»Ganz Ihrer Meinung«, pflichtete Decker ihm bei.
»Sie wissen schon, dass die Firma Buntglasfenster für religiöse Zwecke angefertigt hat.«
»Fahren Sie fort.«
»Das Tiffany-Studio hat viele Devotionalien für Kirchen und Synagogen hergestellt, mehr nicht. Kennen Sie sich in Manhattan aus?«
»Nicht besonders gut.«
»Auf der Fifth Avenue gibt es eine berühmte Synagoge mit einer echten Tiffany-Arbeit. Die portugiesische Synagoge an der West Side hat ebenfalls eine.«
»Muss ich mich bei Ihrer jüdischen Freundin bedanken?«
»Sie sind ein Meisterdetektiv, alter Herr. Das Studio stellte außerdem auch Fenster für die Mausoleen reicher Leute her. Es würde mich also nicht überraschen, wenn die Fensterbilder echt wären.«
»Können Sie beurteilen, ob die hier von Tiffany sind?«
»Nicht aus dieser Entfernung. Man könnte nach einer Signatur suchen, aber die lässt sich fälschen. So etwas kommt andauernd vor. Ob es echt ist, erkennt man in der Hauptsache an der Qualität.«
Decker wandte sich an Pellman. »Haben Sie eine Leiter?«
»Nicht hier, aber ich kann Ihnen eine holen.«
»Das wäre sehr hilfreich.«
»Bin gleich wieder da.«
Nachdem er gegangen war, sagte McAdams. »Warum bloß wollen Sie da hochklettern? Ist Ihnen so langweilig in Ihrem Job?«
»Harvard, es hilft immer, etwas aus der Nähe zu betrachten. Ich übernehme das Klettern, Sie halten einfach nur die Leiter fest.« Die beiden warteten schweigend, und McAdams wirkte beunruhigt. »Alles klar bei Ihnen?«, fragte Decker.
»Bisschen unheimlich hier drin.«
»Ja, Friedhöfe sind gruselig.« Decker überlegte. »Dieser Ort allerdings nicht. Jemand hat sich Zeit genommen, ihn prächtig zu gestalten.«
Pellman kehrte mit der Leiter zurück. »Bitte schön.«
Decker tauschte die starke, aber unhandliche Taschenlampe gegen seine eigene kleinere ein und begann, zu den Fenstern nach oben zu klettern. »Leute, richtet eure Lampen auf das Fenster, okay? Ich möchte es genauer untersuchen.«
Die beiden Männer leuchteten das »Herbst«-Buntglasbild aus. Es war circa fünfunddreißig mal fünfzig Zentimeter groß und hing an zwei Ketten, die in der Decke befestigt waren.
»Gibt es eine Signatur?«, rief McAdams.
»Nach welcher Art Signatur soll ich denn suchen?«
»Tiffany Studio … etwas in der Richtung.«
Decker befand sich jetzt auf Augenhöhe mit dem Kunstwerk. Er richtete seinen Lichtstrahl auf das Buntglas, und auch wenn er kein Experte war, sah die Arbeit ziemlich gut aus. Er brauchte zwei Sekunden, um die Signatur zu entdecken: Tiffany Studio, New York.
»Halten Sie es für echt?«, fragte McAdams von unten.
»Keine Ahnung.«
»An einem der Colleges muss es doch jemanden geben, der die Authentizität beglaubigen kann.«
»Guter Gedanke.« Decker fuhr damit fort, das Kunstwerk genauer in Augenschein zu nehmen: jede Glasscherbe, jeden Metallfaden, der das Glas an seinem Platz hielt. Das Metall inklusive Rahmen hatte einen dunklen Bronzefarbton, durch den ein grünlicher Schimmer flimmerte. Aus Antiquitätensendungen im Fernsehen wusste er, dass die Patina – die Art und Weise, wie Metall über die Jahre alterte – wichtig für die Einschätzung der Echtheit war, und seiner Ansicht nach befand sich zwischen den Metallarbeiten im Glas und am Rahmen ausreichend davon. Auch auf den Ketten, an denen das Fensterbild aufgehängt war.
An allen Gliedern befand sich ebenfalls ausreichend Patina – nur an den Aufhängern nicht, die an den Rahmen gelötet waren, und am Verbindungshaken zur Kette. Diese beiden waren dunkler als der Rahmen und sahen im Vergleich zu den anderen Metallstücken kontrastarm aus. Decker bemerkte ein abstehendes Stück Metall, das er für einen Splitter hielt, doch als er es berührte, fiel dunkle Farbe ab und landete auf seinem Handrücken. Vorsichtig stieg er die Leiter hinunter und klappte sie zusammen. »Mit Erlaubnis der Familie würde ich gerne einen Kunstexperten hierherbitten, um alle vier Fenster zu begutachten.«
»Warum?«, fragte McAdams. »Was haben Sie entdeckt?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte, dass sich jemand alles genauer ansieht.«
Pellman scharrte mit den Füßen. »Ich kann die Familie schon anrufen«, räumte er ein, »aber vielleicht klingt es besser, wenn der Anruf von der Polizei kommt.«
»Ich übernehme das gerne und teile ihnen meine Vermutungen mit.« Selbst im düsteren Licht der Gruft konnte Decker erkennen, dass Pellman erleichtert war. Der Wärter gab Decker Ken Sobels Telefonnummer. »Haben Sie eine Möglichkeit, die Tür wieder zu sichern?«
»Nein, nicht dabei.«
»Ich gehe nicht davon aus, dass es hier einen Eisenwarenladen gibt, der mitten in der Nacht geöffnet ist?«
»Rufen Sie einfach Glenn Dutch an. Ich bin sicher, er hat was zu Hause. Wenn nicht, schließt er seinen Laden für Sie auf.«
»Dutch’s Eisenwaren ist auf der Gable Street«, sagte McAdams.
»Haben Sie seine Telefonnummer?«, fragte Decker Pellman.
»Nicht dabei, aber Roy hat sie vielleicht. Roy ist ein Freund von Glenn, und ich habe Roys Nummer.«
»Könnten Sie dann Roy um Glenns Telefonnummer bitten? Das wäre sehr hilfreich.«
»Klar kann ich das.« Er ging die Kontaktliste auf seinem Handy durch. »Hab sie wohl zu Hause … die Nummer von Roy. Ich rufe meine Frau an, die mir Roys Nummer gibt, der Ihnen Glenns Nummer gibt.« Pellman ging ein paar Schritte zur Seite, um den Anruf zu erledigen.
»Möchten Sie mir mitteilen, was Sie entdeckt haben«, fragte McAdams, »oder muss ich erst ein Fragespiel gewinnen?«
»Ich habe Farbe gefunden«, sagte Decker.
»Farbe?«
»Von einem der an den Rahmen gelöteten Aufhänger ist Farbe abgeblättert. Die Lötstellen wurden übermalt, damit sie alt auszusehen. Und wenn ich es mir recht überlege, hat derjenige, der die Aufhänger an den Rahmen gelötet hat, ziemlich schlampig gearbeitet. Allerdings könnte es sich ja auch um eine Reparatur aus jüngster Zeit handeln. Es entspricht halt nur nicht dem Originalwerk.«
»Wie sah das Glas aus? Und damit meine ich die einzelnen Stücke?«, fragte McAdams.
»Das Glas ist wunderschön … wirklich schillernd.«
»Konnten Sie Risse entdecken?«
Decker sah ihn aufmerksam an. »Interessante Frage. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das Glas in ziemlich gutem Zustand ist. Warum?«
»Vielleicht trifft das auf Fensterbilder nicht zu, aber meine Mom sagte immer, ihre Lampen seien schon älter. Man findet praktisch keine Stücke in makellosem Zustand – ohne Risse –, die nicht gefälscht sind.«
»Gut zu wissen«, sagte Decker. »Andererseits sitzen die Fensterbilder seit über hundert Jahren unberührt an Ort und Stelle.« Er überlegte. »Dagegen spricht, dass die Glasarbeiten in einer nicht temperierten Umgebung hängen. Angesichts der Wetterunterschiede sollte man meinen, dass es zu Rissen kommt. Dagegen spricht wiederum, dass ich nur eins der Fensterbilder unter die Lupe genommen habe, vielleicht befinden sich in den anderen Risse im Glas.«
»So machen Sie das also. Sie reden einfach so lange mit sich selbst, bis Sie einen Treffer landen.«
»Ganz genau, ich rede mit mir selbst, wenn sonst niemand da ist. Als Leiter der Mordkommission habe ich mit meinen anderen Detectives gesprochen. Wir haben uns gegenseitig Bälle zugespielt, und wir lagen öfter richtig als falsch.«
»Nur zu Ihrer Info, ich stehe hier direkt neben Ihnen und friere mir den Arsch ab. Sie könnten mir ein paar beschissene Bälle zuspielen.«
»McAdams, seit sechs Monaten tue ich nichts anderes, und alles, was ich dafür bekommen habe, ist Herumgemeckere. Soll mir recht sein. Ich weiß, dass ich ein hervorragender Polizist bin. Wenn Sie etwas lernen möchten, freue ich mich, mein Wissen mit Ihnen zu teilen. Und wenn es etwas gibt, was Sie wissen und ich nicht, dann ist das auch kein Problem für mich. Ein guter Detective fängt an als guter Zuhörer.«
3
Nachdem die Gruft dank des Eisenwarenladens von Glenn Dutch wieder mit einem Vorhängeschloss gesichert war, verließen sie den Ort gegen halb zwölf Uhr nachts. Es war zu spät für Anrufe, aber wenn es Deckers Familiengrab gewesen wäre, hätte er sofort informiert werden wollen. Er reichte McAdams einen Notizzettel. »Das ist Ken Sobels Nummer – er scheint sich um die Gruft zu kümmern. Geben Sie sich die Ehre.«
»Ich?«
»Sie sind mein Vorgesetzter.«
»Dann beauftrage ich Sie hiermit, den Anruf zu tätigen.«
»Ich bin im Schabbes. Würden Sie mir den Gefallen tun?«
»Es ist spät.«
»Ich weiß, aber ich denke trotzdem, wir sollten ihn anrufen.«
»Warum?«
»Weil es die angemessene Vorgehensweise ist. Pellman hat ihm bereits mitgeteilt, dass etwas mit dem Schloss nicht stimmt. Wahrscheinlich wartet er darauf, von ihm zu hören.« Eine Pause. »Hören Sie, falls Sie sich damit nicht wohlfühlen …«
»Machen Sie sich nicht lächerlich.« McAdams kramte sein Handy aus der Tasche. »Ich ruf an.«
Aber er rief nicht an. »Als Erstes sagen Sie, wer Sie sind«, schlug Decker vor.
»Ich weiß, wie man das macht, okay?« Decker schwieg dazu, und McAdams starrte sein Handy an. »Wie viel soll ich ihm sagen? Was, wenn er die Fensterbilder höchstpersönlich abgehängt hat? So würden wir ihn warnen, dass wir misstrauisch geworden sind.«
»Halten wir uns einfach an das, was wir wissen, okay?«
»Wir wissen aber nichts mit Sicherheit, weshalb rufen wir ihn dann überhaupt an?«
»Wir rufen ihn an, um ihn darüber zu informieren, dass alles so weit in Ordnung ist, dass wir aber der Vollständigkeit halber die Fensterbilder lieber begutachten lassen würden. Sagen Sie ihm zuerst, dass alles normal aussieht. Dann loben Sie die Glasarbeiten, dann fragen Sie ihn, ob das echte Tiffanys sind …«
»Ich hab’s kapiert!« McAdams drückte Decker abrupt das Handy in die Hand. »Offensichtlich haben Sie eine Art Drehbuch im Kopf. Also schießen Sie selber los, und zwar schnell. Mir ist kalt … mehr als kalt. Ich bin ganz taub.«
»Ich übernehme den Anruf, aber würden Sie die Nummer vielleicht für mich eintippen?«
»Ich glaube nicht, dass ich meine Finger bewegen kann.«
»Na gut.«
»Das war ein Witz, alter Herr.«
»Und stellen Sie es laut, dann muss ich das Gespräch nicht wiederholen«, wies Decker ihn an. McAdams schmollte – sein Stolz war verletzt –, aber er tat wie ihm geheißen. Decker wartete auf das Rufzeichen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach Hause in einer jetzt definitiv polaren Kälte. Er hatte die Angewohnheit, sich beim Telefonieren zu bewegen. Wenigstens war es diesmal tatsächlich sinnvoll.
Nachdem jemand das Gespräch angenommen hatte, sagte er: »Hier spricht Peter Decker von der Polizei Greenbury. Bitte entschuldigen Sie den späten Anruf, aber ich hätte gerne Ken Sobel gesprochen.«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang hellwach. »Am Apparat. Warum hat das so lange gedauert? Was geht da vor sich?«
»Sir, wir haben das Schloss zur Gruft aufgebrochen. Soweit ich das beurteilen kann, sieht alles gut aus.«
»Puh! Na fein. Die Vorstellung, jemand wäre in die Gruft eingebrochen und hätte dort Unfug angerichtet, ist wirklich makaber. Warum hat denn Isaiah Pellmans Schlüssel nicht gepasst?«
»Das wissen wir nicht. Könnte jemand anderes aus der Familie das Schloss ausgetauscht haben?«
»Ich bin eigentlich der Einzige, der sich die Mühe macht, zur Gruft zu fahren … außer für das Begräbnis vor sechs Monaten. Und bei meinem Besuch vor vier Monaten war alles in Ordnung.«
»Wer außer Ihnen besitzt noch einen Schlüssel?«
»Meine Schwester … einige meiner Cousins.«
»Mr. Pellman hat das Schloss vor vier Tagen überprüft, und da funktionierte es. Wenn also jemand das Schloss ausgetauscht hat, müsste das in den letzten Tagen passiert sein.«
»Ich versichere Ihnen, dass keiner meiner Verwandten in den letzten Tagen vor Ort war.«
»Gut. Falls es Ihnen nichts ausmacht, hätte ich noch ein oder zwei Fragen.«
»Bitte.«
»Im Inneren der Gruft befinden sich vier wunderschöne Buntglasbilder. Die Motive erinnern an die vier Jahreszeiten. Ich habe mir sogar eine Leiter besorgt, um das Herbst-Motiv genauer zu betrachten, und dabei eine Tiffany-Signatur entdeckt. Handelt es sich um echte Tiffanys?«
Am anderen Ende der Verbindung wurde es einen Moment lang still. »Warum fragen Sie?«
»Ich bin von Natur aus misstrauisch. Bei meiner ersten Unterhaltung mit Isaiah Pellman klang es so, als wäre das Originalschloss absichtlich aufgebrochen worden. Und dann sah ich diese Fensterbilder. Wenn es echte Tiffany-Arbeiten sind, lohnt sich der Diebstahl.«
»Aber Sie sagten doch, alles sei in Ordnung?«
»Ist es auch.«
»Jetzt bin ich verwirrt.«
»Sind die Glasbilder von Tiffany?«
»Ja, und sie stellen die vier Jahreszeiten dar. Meine Großmutter hatte sie zur Jahrhundertwende in Auftrag gegeben.«
»Es wäre eine gute Idee, jemanden herzuschicken, um ihre Authentizität zu bezeugen. Mein Partner machte den Vorschlag, dass jemand von den Colleges dies übernehmen könnte, Ihr Einverständnis vorausgesetzt.«
»Das ist lächerlich. Natürlich sind alle vier echt!«
»Ich bin mir sicher, dass sie es einmal waren.«
»Wie bitte?« Eine lange Pause. »Sie glauben, jemand ist dort eingedrungen und hat die Fensterbilder gegen Fälschungen ausgetauscht?«
ENDE DER LESEPROBE