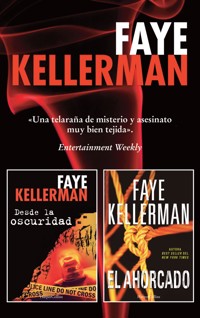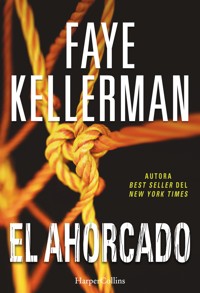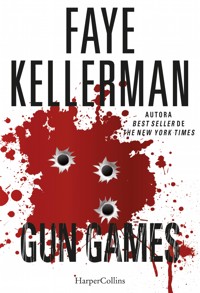9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Decker/Lazarus-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der finale Fall für Rina Lazarus und Peter Decker
Peter Decker bereitet sich weiter auf seinen Ruhestand vor, doch ein letzter Fall muss noch geklärt werden: Mit seinem Partner, Detective Tyler McAdams, versucht er herauszufinden, wie eine der vermissten Personen aus seinem letzten Fall tot im Wald enden konnte. Alle Beteiligten scheinen sich nach Deutschland abgesetzt zu haben.
Gleichzeitig wird Gabes Mutter Terry das Opfer eines brutalen Überfalls, bei dem ihr jüngster Sohn entführt wird. Gabe informiert seinen Vater, den schwerreichen Zuhälter Chris Donatti, der sofort alles stehen und liegen lässt, um seine schwer verletzte Ex-Frau und große Liebe Terry zu sich zu holen, ihren Sohn zu befreien und sie wieder zurückzugewinnen – und dafür schreckt er vor nichts zurück ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem TitelThe Hunt bei William Morrow, an Imprint of HarperCollinsPublishers, New York.
© by Faye Kellerman
The Hunt. Copyright © 2022 by Plot Line, Inc.
Deutsche Erstausgabe
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Buerosüd
Covergabbildung von mauritius images / Westend61 / Martin Rügner, kabby, Anelina, javarman / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7499-0510-2
www.harpercollins.de
Widmung
Meinem Jonathan, der mich im Leben in jeder Hinsicht unermüdlich unterstützt hat: Ich liebe dich und danke dir.
Meinen Kindern und Enkelkindern: Ich liebe euch alle so sehr!
Allen Menschen im Verlagswesen, die mir im Laufe der Jahre geholfen haben, eingeschlossen die Agentur Karpfinger und William Morrow, mein langjähriger Verleger, und dessen Belegschaft. Ein besonderes Dankeschön geht an Carrie Ferron, meine hervorragende Lektorin, gelegentliche Therapeutin und wundervolle Freundin.
Und schließlich sei dieser letzte Roman mit Peter Decker und Rina Lazarus all meinen Fans gewidmet, die meine Bücher und mich bisher unterstützt haben. Ohne euch wäre all dies nicht möglich gewesen. Danke, danke, danke!
PROLOG
Es waren ungefähr fünfzig Anrufe nötig gewesen, aber schließlich hatte sich die Familie für ein Restaurant entschieden, in dem sie zu Abend essen wollte, bevor Decker und Rina vom Kennedy Airport aus nach Israel flogen. Decker ließ den Blick über ihre am Tisch versammelte, bunt durcheinandergewürfelte Familie schweifen: Jacob und Sammy, Rinas erwachsene Söhne; seine eigene erwachsene Tochter, Cindy; ihre gemeinsame kleine Tochter, Hannah, die inzwischen selbst ein Baby hatte; und Gabe, ihren Pflegesohn. Außerdem zugegen waren drei Ehegatten, zwei Verlobte und fünf Enkelkinder. Er und Rina hatten ihre Sache gut gemacht. Selbst wenn er morgen sterben sollte, würde Decker das in der Gewissheit tun, in seinem Leben überreich gesegnet worden zu sein.
Wie immer wurde die Unterhaltung erst lebhaft, dann laut. Die Erwachsenen riefen durcheinander, die Kinder unterbrachen sie, und dazu gab es wie gewohnt umgestoßene Gläser und Trotzanfälle. Kurz bevor die Vorspeisen kamen, brachte die Servicekraft zwei große Flaschen Rosé-Champagner und die dazugehörigen Champagnergläser.
»Wer hat das bestellt?«, fragte Rina. »Nicht, dass ich mich beschweren würde.«
»Wir alle zusammen.« Jacob stand auf und schlug mit einer Gabel an sein Glas. »Jetzt, da alle hier sind, möchte ich auf das glückliche Paar anstoßen. Mögen sie Frieden und Abgeschiedenheit im Heiligen Land finden, und ihre Renovierungspläne problemlos vonstattengehen. L’chaim.«
»L’chaim«, ertönte es von allen Seiten.
»Eine Sache noch.« Jacob hielt seinem Stiefvater zwei Briefumschläge hin. »Für euch beide. Ein kleines Präsent für all das, was ihr mit dieser Truppe immer über euch ergehen lassen müsst.«
»Das ist doch hoffentlich kein Geld«, sagte Rina.
»Ist es nicht.« Cindy lächelte. »Macht sie auf.«
Decker tat es und zog zwei Business-Class-Tickets nach Israel aus dem Umschlag. Er zeigte sie Rina.
»Was habt ihr da gemacht?«, rief Rina.
»Reist in Frieden und reist mit Stil«, sagte Sammy.
»Die müssen ein Vermögen gekostet haben.«
»Da wir so viele sind, war’s nicht so schlimm. Wir haben ja bloß die Tickets, die ihr schon hattet, auf die nächsthöhere Klasse umgebucht.«
»Leider war es schon zu spät, um für den Hinflug noch Plätze nebeneinander zu bekommen«, sagte Hannah, »aber auf dem Rückflug sitzt ihr zusammen.«
»Wahnsinn, danke, Kinder. Das macht unsere Reise sogar noch aufregender.« Decker hob sein Champagnerglas. »Ein Toast auf euch alle.«
Genau in diesem Moment klingelte Gabes Handy. Er sah auf das Display. Eine unterdrückte Nummer. Zweifellos sein Vater. Chris benutzte oft Wegwerfhandys, obwohl er ein normales mit den Funktionen eines Wegwerfhandys hatte, mit dem man auch seine Nummer unterdrücken konnte. Aber so war Chris einfach. Bei ihm war nichts je ohne Widerspruch.
»L’chaim«, sagte Gabe. »Da muss ich drangehen.« Er stand auf und verließ das Restaurant. Der Straßenlärm machte das Ganze nicht viel ruhiger, aber zumindest klingelten ihm nicht die Ohren vom Geschrei kleiner Kinder. »Hi.«
Am anderen Ende konnte er jemanden atmen hören. Gabe hätte fast wieder aufgelegt, nur dass es kein perverses Atmen war. Es war ein krampfhaftes Nach-Luft-Ringen. »Hallo?«
»Du musst … mich holen kommen.«
Eine Frau versuchte verzweifelt, die Worte herauszubringen. Kurz war er verwirrt, dann fiel der Groschen. Gabes Herz fing an zu rasen. »Mom?« Keine Antwort. »Geht’s dir gut?«
»Nein.«
»Bist du verletzt?«
»Ja.« Sie weinte. »Die haben Sanjay entführt … Juleen … sie sind weg. Ich … sterbe.«
»Mom, wo bist du?«
»L. A.«
»Wo in Los Angeles?«
»Valley.«
»Mom, ruf den Notruf an.«
»Nein!«
»Du musst …«
»Nein!«
»Mom, du musst die Polizei verständigen.«
»Die werden mich festnehmen.« Ein längeres Schweigen. »Du musst mich holen kommen.«
»Mom, ich bin viertausend Kilometer weit weg. Wenn du verletzt bist, musst du in ein Krankenhaus. Ruf den Notruf an.« Keine Antwort. »Mom, bist du noch dran?« Sie antwortete nicht, aber Gabe konnte sie atmen hören. »Mom, ich hab dich lieb. Bitte, ruf Hilfe!«
»Warte … o Gott, ich glaube, das ist Juleen!«
»Mom?« Aber sie hatte aufgelegt. Mit zitternden Händen wählte er ihre Nummer, aber sein Anruf ging direkt auf die Mailbox. »Warum machst du das mit mir?«
Er rief noch mal an. Und noch mal. Und immer wieder.
Er schrieb ihr eine SMS: RUFMICHAN!
Decker war vor die Tür getreten und sah seinen Pflegesohn unruhig auf und ab gehen. »Alles in Ordnung?«
»Nein«, antwortete Gabe. »Meine Mutter hat mich gerade angerufen. Nach dem, was ich mir zusammenreimen konnte, hat irgendjemand meinen Bruder und vielleicht auch meine Schwester entführt. Meine Mom ist verletzt.«
»Wo ist sie?«
»In Los Angeles. Im Valley, glaube ich.«
»Ihre alte Gegend. Meine alte Gegend. Wie ist ihre Nummer? Ich versuche mal, ob ich nicht einen Polizeibeamten da rausschicken kann, um nach ihr zu suchen.«
»Sie will nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird, Peter. Außerdem hat sie mit einer unterdrückten Nummer angerufen. Meine Anrufe landen direkt auf der Mailbox.« Gabe hielt inne. »Sie hat ihre Kids aus Indien rausgeschmuggelt. Ich vermute, es gab eine gerichtliche Verfügung, dass sie das Land nicht mit ihnen verlassen darf. Du weißt ja, dass sie sich gerade von ihrem Mann scheiden lässt. Wahrscheinlich streiten sie um das Sorgerecht.«
»Sie ist auf der Flucht?«
»Vermutlich.«
»Vielleicht hat ihr Mann die Kinder zurück entführt.«
»Keine Ahnung …« Gabe ging weiter nervös auf und ab. »Ganz ehrlich, momentan mache ich mir weniger Sorgen um die Kids als um sie. Sie klang fürchterlich.«
»Gabe, lass mich auf meinem alten Revier anrufen. Ich kenne immer noch jede Menge Leute. Vielleicht können die anhand ihres Handys ihren Aufenthaltsort ermitteln.«
»Sie hat gesagt, keine Polizei.«
»Wenn sie wirklich verletzt ist, meinst du, du solltest auf sie hören?«
»Nein, du hast recht, aber ich glaube nicht, dass du etwas erreichen wirst, Peter. Ich glaube, sie hat ihr Handy ausgeschaltet.«
»Dann fällt mir auch nichts mehr ein«, sagte Decker. »Du bist viertausend Kilometer weit weg und kannst wahrscheinlich nicht vor morgen dort sein … was möglicherweise zu spät ist.«
Gabes Augen wurden feucht. »Ich hab sie wirklich lieb. Aber meine Mom ist eine Katastrophe! Wir wissen, dass ihr derzeitiger Mann üblen Typen Geld schuldet, es könnte also etwas damit zu tun haben. Ihre Wahl bei Männern ist definitiv fragwürdig. Ich glaube wirklich, Devek ist noch schlimmer als mein Vater.«
Decker hob die Augenbrauen und einen Finger. »Gabe, ruf deinen Dad an.«
»Was?«
»Ruf deinen Dad an. Nevada liegt in derselben Zeitzone, und er hat einen Privatjet. Vermutlich kann er in zwei Stunden vor Ort sein. Außerdem kennt er das Valley genauso gut wie ich. Da haben er und deine Mom sich kennengelernt. Und wenn sie auf der Flucht vor schlimmen Typen ist, kann er sie besser beschützen als irgendjemand sonst. Ruf deinen Dad an.«
»Er wird ihr nicht helfen. Er wartet schon seit Jahren darauf, dass sie eine totale Bruchlandung hinlegt. Ich glaube, das ist es, was ihn all die Jahre am Leben erhalten hat. Rache.«
»Versuch es wenigstens.« Keine Antwort. Decker zuckte die Achseln. »Hast du einen besseren Vorschlag?« Schweigen. »Willst du, dass ich ihn anrufe?«
»Nein, unter gar keinen Umständen!« Gabe schüttelte den Kopf. »Geh zurück zum Abendessen, Peter. Ich bin vierundzwanzig. Ich kann die Sache regeln.«
»Ist keine Schande, um Hilfe zu bitten.«
»Ich brauche keine Hilfe.« Obwohl er sie natürlich doch brauchte. »Bitte, geh wieder rein, bevor jeder mitbekommt, dass es ein Problem gibt.«
»Sicher?«
»Ja.«
Gabe sah zu, wie sein Pflegevater ins Restaurant zurückging. Dann versuchte er mit zitternden Händen, die Nummer einzugeben, die er auswendig kannte, aber er vertippte sich immer wieder. Schließlich sah er in seiner Kontaktliste unter Dad nach. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals.
Häufig schaltete Chris sein Handy aus. Meistens ging er nicht dran, auch wenn das Telefon an war. Christopher Donatti war ein viel beschäftigter Mann. Er konnte Anrufe nicht ausstehen. Ganz besonders konnte er Anrufe von seinem Sohn nicht ausstehen, der es immer wieder schaffte, seinen Vater bei wichtigen Geschäften zu stören.
Er sagte dann gerne: Du kostest mich gerade Geld. Das sollte jetzt besser wichtig sein.
Das Telefon klingelte, was bedeutete, die aktuelle Nummer war noch gültig. Im nächsten Moment hörte er, wie jemand abnahm.
»Was!«
Danke, lieber Gott. »Dad, du musst mir helfen. Mom hat angerufen. Sie ist in Kalifornien, ich glaube, im Valley, aber genau weiß ich es nicht. Sie ist schlimm verletzt, aber sie will weder den Notruf verständigen noch ins Krankenhaus gehen …«
»Moment. Lass mich irgendwo hingehen, wo ich ungestört bin.« Kurz darauf war Donatti wieder am Apparat. »Deine Mutter ist an der Westküste?«
»Ja.«
»Wo sind ihre Kinder?«
»Die hatte sie bei sich, aber jetzt sind sie weg. Sie steckt mitten in einer unschönen Scheidung. Könnte sein, dass sie sie ohne Erlaubnis aus Indien weggebracht hat.«
»Ah.« Kurzes Schweigen. »Jemand hat sie zurückgeholt.«
»Das denke ich auch, ja.« Gabe holte tief Luft. »Chris, ich weiß, dass sie sie nicht friedlich gehen lassen würde, und ich denke, sie ist in einen üblen Kampf geraten. Sie klang, als ob sie richtig in der Patsche sitzt. Sie will, dass ich komme und sie hole, aber ich bin in New York, außerdem hat sie mich von einem Wegwerfhandy mit einer unterdrückten Nummer angerufen, also kann ich sie nicht zurückrufen. Ich glaube, sie hat ihr normales Handy ausgeschaltet.« Gabe hielt inne, aber sein Vater sagte nichts. »Ich hoffe, sie ruft mich zurück. Sobald sie’s tut, werde ich Näheres erfahren. Aber in der Zwischenzeit bist du viel dichter an L. A. als ich. Und du bist gut darin, Leute zu finden.«
Wieder hielt er inne. Sein Dad wartete …
»Hör zu«, sagte Gabe, »ich weiß, ihr habt euch im Streit getrennt …«
»Sie hatte eine Affäre, hat sich von dem Arschloch schwängern lassen, bekam, während sie noch mit mir verheiratet war, seinen Bastard, und hat mich dann, ohne mit der Wimper zu zucken, sitzen lassen. Ja, das würde ich als im Streit getrennt bezeichnen.«
»Ich hatte auch meine Probleme mit ihr. Ich habe ihr verziehen.«
»Das ist dein gutes Recht.«
»Sie ist meine Mutter, Chris!« Schweigen. »Du weißt, was es bedeutet, seine Mutter zu verlieren.«
»Juckt mich nicht die Bohne. Versuch’s mal mit ’ner anderen Taktik.«
»Du hast sie mal geliebt.«
Diesmal hielt das Schweigen länger an. Gabe dachte, er hätte vielleicht aufgelegt. Aber dann sagte Donatti: »Wer sagt, dass ich sie nicht immer noch liebe?«
Gabe atmete tief durch. Diesen Kampf würde er gewinnen. »Hilfst du ihr? Ja oder nein?«
»Ja, ich fliege hin.« Keinerlei Zögern. »Ich habe gerade ein gutes Dutzend Leute draußen in meinem Büro zu Gast. Gib mir eine halbe Stunde, um sie loszuwerden, den Jet vollzutanken und einen Flugplan anzufordern. Falls sie dich anruft, lass dir eine Telefonnummer geben. Und gib ihr meine Nummer.«
»Sobald ich etwas weiß, melde ich mich bei dir.«
»Und eins sag ich dir, Gabe. Sie sollte meine Hilfe besser wirklich wollen. In der Vergangenheit habe ich keine sonderlich guten Erfahrungen mit deiner Mutter gemacht. Wenn ich bis zu meiner Ankunft in Los Angeles nichts von ihr gehört habe, drehe ich wieder um, und dann ist sie dein Problem.«
»Einverstanden. Ich gebe dir mal Moms Nummer.«
»Die habe ich.«
»Da geht immer nur die Mailbox dran.«
»Wenn sie die Kinder ohne gerichtliche Genehmigung mitgenommen hat, will sie wahrscheinlich nicht geortet werden. Ich werde mir was überlegen.«
»Vielen, vielen Da…«
»Ja, schon gut. Lass mich jetzt loslegen.«
Donatti legte auf und steckte sein Handy ein, dann fuhr er sich mit den Fingern durch die schulterlangen weißen Haare und ließ seine widersprüchlichen Gefühle die Sache ausfechten – weil er nicht wusste, was er fühlen sollte, jetzt, da der Moment tatsächlich gekommen war.
Über ein Jahrzehnt hatte er an seinen Racheplänen gefeilt, die ihm süße Genugtuung verschaffen würden … immer ihre gerechte Bestrafung vor Augen. Er hatte diese Rache gesät, gehegt und gepflegt, gewässert, vor Kälte geschützt und vor Hitze bewahrt. Er hatte zugesehen, wie sie gewachsen und zu etwas Furchtbarem und Unaufhaltsamem erblüht war. Es hatte seine Gedanken völlig in Beschlag genommen. Wie er sie büßen lassen würde für das, was sie ihm angetan hatte. Und jetzt, da seine Chance auf Vergeltung so nah war – so unglaublich nah –, war alles, was er fühlen konnte, das schnelle Klopfen seines eigenen Herzens – angetrieben nicht von Rachegefühlen, sondern von freudiger Erregung.
Er wollte sie wirklich unbedingt zurückhaben!
Der Gedanke an Sex mit ihr, selbst nach all diesen Jahren, machte ihn so richtig heiß. Er hatte es sich mindestens tausendmal ausgemalt – manchmal harmlos, manchmal düster und grausam –, jedes Mal in Hochauflösung und gestochen scharf vor seinem geistigen Auge. Ihr Gesicht wiederzusehen … ihren Körper zu spüren. Ihre Stimme zu hören. Es war ihre Stimme, die ihn am meisten verfolgt hatte. Ihre Stimme, die ihn nachts wachgehalten hatte und ihn tagsüber vor sich hin hatte träumen lassen. Manchmal sprach sie so deutlich zu ihm, dass er sich umdrehte, nur um hinter sich einen leeren Raum vorzufinden.
Nachdem er vor über einem Jahrzehnt zum dritten Mal von ihr verlassen worden war, hatte er Jahre gebraucht, um sich zu erholen. Schließlich, endlich, hatte er sein Leben in den Griff bekommen. Er war weg vom Heroin, hatte sich die Zigaretten abgewöhnt und trank erheblich weniger. Inzwischen trainierte er auch regelmäßig. Er ernährte sich gesund. Er war ein neuer, besserer Mensch geworden, während er sich für sein Unternehmen abgerackert hatte – einen viele Millionen Dollar teuren Spielplatz für reiche Männer jedweder sexueller Vorliebe. Er hatte sein eigenes kleines Königreich errichtet, in dem er der alleinige Herrscher war und niemand es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen. Er hatte jede Menge Geld, jede Menge Sex, er hatte Respekt. Und was am allerwichtigsten war: Er hatte die Kontrolle über wirklich alles in seinem Leben.
Jetzt war genau dieses Alles im Begriff, ihm um die Ohren zu fliegen.
Und obwohl er genau wusste, dass das Ganze böse enden würde – wie es das schon drei Mal getan hatte –, wusste er auch, dass er ohne zu zögern ins kalte Wasser springen würde, Idiot, der er war.
Einmal zum Narren gemacht – du solltest dich schämen.
Zweimal zum Narren gemacht – ich sollte mich schämen.
Zum dritten Mal zum Narren gemacht – irgendwer ist hier ein unverbesserlicher Dummkopf.
Er warf die Haare zurück, dann begab er sich aus seinem Büro in das Getümmel, dessen Gastgeber er war.
Jetzt geht’s wieder los.
Verdammt noch mal, jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los.
Mit seinen eins dreiundneunzig – na ja, mittlerweile vielleicht eins zweiundneunzig, wenn man die altersbedingte Schrumpfung mit einrechnete – hatte es Decker immer vor dem Fliegen gegraut, da er seinen überdurchschnittlich langen Körper in Sitze quetschen musste, die nicht auf jemanden seiner Größe zugeschnitten waren. Der Flug nach Israel war lang, und nach dem Landen brauchte er immer Stunden, bis er sich wieder ganz aus der verkrampften Haltung gelöst hatte. Diesmal würde es vielleicht anders sein.
Er strahlte, als er an seine Kinder dachte, die alle zusammengelegt hatten, um Rina und ihm Business-Class-Tickets zu kaufen. Was für ein Glückspilz er doch war. Er ließ sich auf seinen Sitz mit Fußstütze gleiten. Er hatte ein größeres Kissen und eine dickere Decke als üblich. Er hatte seinen eigenen Fernseher und Servicepersonal, das ihm noch vor dem Start Saft, Wasser oder Champagner anbot.
Daran konnte er sich definitiv gewöhnen.
Rina kam zu ihm. Sie saß drei Reihen hinter ihm. »Ziemlich luxuriös.«
»Unglaublich«, sagte Decker. »Nette Überraschung.«
»Das haben wir gut gemacht«, entgegnete Rina. »Irgendwelche Neuigkeiten von Gabe?«
»Ich weiß, dass er seinen Vater erreicht hat und Chris sich bereit erklärt hat, zu helfen.«
»Nett von ihm – falls er Terry vorher nicht umbringt«, sagte Rina.
»Das Ganze ist mehr als zehn Jahre her.«
»Wieso habe ich trotzdem das Gefühl, dass Chris eher der nachtragende Typ ist?«
Peters Handy summte.
»Schalt das Ding aus«, sagte Rina. »Wir sind jetzt im Urlaub.«
Decker schaute auf das Display. »Das ist Tyler.«
»Es ist bald Mitternacht. So sehr kann er dich nicht vermissen.«
»Ja, bedeutet sicher nichts Gutes.« Decker nahm den Anruf entgegen. »Was gibt’s?«
»Vor ein paar Stunden hat jemand eine Leiche gefunden«, meldete sich sein Partner. »Im Wald, ungefähr drei Meilen von dem Diner entfernt, an dem Bertram Lanz verschwunden ist.«
Decker hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl. Er und die gesamte Polizeitruppe von Greenbury hatten wochenlang nach dem kognitiv beeinträchtigten Mann gesucht. Er hatte gehofft, dass Lanz sicher bei seinen Eltern in Deutschland war. Aber vielleicht war es anders gekommen. Dass er den Fall nicht hatte abschließen können, lag als schwere Last auf Deckers Schultern. Er wusste, dass er sich ohne Aufklärung dieses Rätsels nicht hätte freinehmen sollen. »Wo bist du momentan?«
»Ich habe gerade den Tatort verlassen, um dich anzurufen. Da oben gibt’s keinen Empfang. Sobald ich aufgelegt habe, gehe ich wieder zurück.«
»Muss ich zurückkommen, McAdams?«
»Peter!«, rief Rina.
»Nein, nein. Wir schaffen das schon, Boss. Der Gerichtsmediziner sollte jeden Augenblick hier sein. Kevin hat den Bereich abgesperrt. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich dachte nur, du solltest Bescheid wissen.«
Die Flugbegleiterin machte jetzt die Durchsagen. Rina sagte: »Wenn du so uneinsichtig bist, gehe ich wieder auf meinen Platz.«
Decker hörte sie kaum. Er steckte sich den Finger ins Ohr. »Sicher, dass du das schaffst?«
»Wir haben alles im Griff, Boss. Mach dir keine Sorgen. Genießt eure Zeit im Ausland.«
»Bevor du auflegst: erste Überlegungen hinsichtlich der Leiche?«
»Die Leichenstarre ist bereits vorbei, die Gasbildung ebenfalls.«
»Dann ist der Leichnam schon mehrere Wochen alt?«
»Möglicherweise. Es gibt Anzeichen von Verwesung.«
»Insektenbesiedelung?«, fragte Decker.
»Einige, in den Körperöffnungen – Nasenlöchern, Augen und Mund.«
»Dann lag ein Teil des Gesichts frei, sodass die Fliegen ihre Eier ablegen konnten.«
»Ja, der Leichnam war teils vergraben.«
»Tierfraß könnte einen Einfluss darauf gehabt haben.«
»Davon war nichts zu erkennen«, sagte McAdams. »Aber das ändert sich vielleicht, sobald die Autopsie abgeschlossen ist.«
»Irgendeine Ahnung, ob die Leiche männlich oder weiblich ist?«
»Der Größe nach zu schließen, vermutlich weiblich. Doch das Gesicht ist ziemlich verwüstet, und wir dürfen nichts anfassen, bis der Gerichtsmediziner da war.«
»Ist die Leiche nackt, oder habt ihr auch Kleidung gefunden?«
»Etwas verrottete Kleidung. Sieht aus wie Jeans, Holzfällerhemd, Turnschuhe.«
Eine Flugbegleiterin namens Nurit trat zu ihm. »Alles in Ordnung, Sir?«
Decker sah sie an. »Ja, danke.«
Nurit schluckte. »Die Dame auf der anderen Seite des Gangs hat gehört, wie Sie sich über Leichen unterhalten haben. Ich glaube, das beunruhigt sie.«
»Oh, tut mir leid.«
»Was tut dir leid?«, fragte Tyler.
»Nein, nicht du.«
Decker lächelte die Flugbegleiterin an. »Ich bin Detective bei der Polizei. Ich beende dann das Gespräch.« An McAdams gewandt: »Ich muss Schluss machen.«
»Mach dir keinen Kopf, Boss, ich hab alles unter Kontrolle.«
Decker legte auf. Rina war wieder erschienen. Sie stand vor ihm. »Du fliegst keinesfalls zurück.«
»Nein, ich fliege nicht zurück«, versicherte Decker.
»Hoffentlich ruiniert uns das nicht den Urlaub.«
»Wenn wir landen, gebe ich dir meinen Laptop und mein Handy. Beweist das nicht, dass ich’s ernst meine?«
»Ich werde dich beim Wort nehmen«, sagte Rina. Weitere Durchsagen folgten. »Ich muss auf meinen Platz.« Sie küsste Peter auf den Kopf. »Und denk daran, deine Schlaftablette zu nehmen, sobald wir in der Luft sind. Das hilft gegen den Jetlag. Wir sehen uns dann im Heiligen Land.«
»Ein neues Abenteuer«, sagte Decker.
»Ein neues Abenteuer.« Rina wuschelte ihm durch die Haare und ging.
Drei Stunden später schlief Rina tief und fest. Decker dagegen hatte sich ausgestreckt und lag mit offenen Augen da, während ihm tausend Gedanken im Kopf herumgingen. Vermutlich würde er jetzt schlafen, wenn er die Tablette genommen hätte, aber er hatte sich dagegen entschieden.
Man kann den Mann von den Ermittlungen abziehen, aber nicht die Ermittlungen von dem Mann.
Er hatte Rina versprochen, alles, was mit der Arbeit zu tun hatte, auszustöpseln, wenn sie landeten. Sie verdiente es. Aber warum sollte er sich stundenlang unruhig hin und her wälzen, wenn die Lösung für seine Schlaflosigkeit in Reichweite lag? Leise stand er auf und nahm den Laptop aus dem Gepäckfach über seinem Sitz. Nachdem er ihn hochgefahren hatte, sah er sich die verschiedenen Buchungsmöglichkeiten für den Internetzugang im Flugzeug an. Zuerst zog er in Erwägung, die Dreißig-Minuten-Option zu wählen. Nur ein paar schnelle Fragen und dann den ganzen störenden Kram ausschalten. Aber eine unerklärliche Macht führte seine Hand und ließ ihn die Zwei-Stunden-Option auswählen. Dann gab er Tylers E-Mail-Adresse ein.
Er schrieb:
Wenn wir landen, schalte ich alle meine elektronischen Geräte aus.
Aber jetzt bin ich wach, ich kann nicht schlafen.
Erzähl mir alles, was bei euch los ist.
KAPITEL 1
So hatte ich es in Erinnerung, als ich blutend, zusammengeschlagen und auf dem Boden liegend das Bewusstsein wiedererlangte:
Ich hatte auf dem Sofa gesessen, war gerade meine juristischen Möglichkeiten durchgegangen für das, was eine langwierige und hässliche Scheidung werden würde, und versuchte herauszufinden, wie ich das ohne Geld hinkriegen sollte, noch dazu in einem Rechtssystem am anderen Ende der Welt. Mein fünfjähriger Sohn spielte neben mir ein Videospiel. Meine elfjährige Tochter befand sich in ihrem Zimmer, die Tür abgeschlossen, und tat, was immer sie in der Abgeschiedenheit ihres eigenen Reiches tat. Juleen war hypererwachsen, und als ich diese Wohnung gemietet hatte, hatte ich dafür gesorgt, dass sie ihr eigenes Zimmer bekam. Die Wohnung verfügte über zwei Schlafzimmer, und Sanjay schlief in dem kleineren der beiden. Juleen hatte das Elternschlafzimmer, und ich schlief im Wohnzimmer auf dem Sofa.
Ich war so in meine Gedanken versunken gewesen, dass ich die Schritte draußen vor der Tür nicht gehört hatte. Bei dem Haus handelte es sich um ein frei stehendes Gebäude, und normalerweise hörte ich, wenn jemand die Treppen hoch oder runter ging. Diesmal nicht. Wäre ich aufmerksamer gewesen, wäre das alles vielleicht nicht passiert.
Erst als die Tür aufgestoßen wurde und ich »Lauf!« schrie, geriet alles in Bewegung. Zwei indische Männer: Einer griff sich sofort Sanjay, und der andere sagte, er würde das Mädchen suchen gehen. Mein Sohn trat um sich und schrie, ich packte seine Beine und zog ihn zu mir, während mein Widersacher in die entgegengesetzte Richtung zog: ein gefährliches Tauziehen. Der Mann hielt Sanjay den Mund zu, und ich weiß noch, dass ich meinem Sohn gesagt habe, er solle ihm in die Hand beißen. Gleichzeitig zerkratzte ich dem Eindringling den Arm und zerrte wild an Sanjay. Aber der Mann war größer und kräftiger als ich und hielt meinen Sohn weiter fest, obwohl er ihm eine Hand auf Mund und Nase gelegt hatte. Ich ließ nicht locker, bis der zweite Mann wiederkam und mich fragte, wo das Mädchen sei.
Als ich nicht antwortete, schlug er mir ins Gesicht – einmal rechts, einmal links und dann noch einmal rechts. Danach packte er mich an den Haaren, wickelte sie sich um die Hand und riss so heftig daran, dass er mir ein ganzes Büschel ausriss. Schiere Willenskraft hinderte mich daran, die Beine meines Sohnes loszulassen. Dann schlug er mich wieder auf die rechte Wange, diesmal mit der Faust. Ich sah Sterne vor den Augen und taumelte. Während ich zu Boden ging, trat er mir gegen den Kopf, dann zweimal in die Rippen. Ich spürte es knacken. Dann versetzte er mir als Zugabe zwei letzte Tritte – einen in den Magen und einen in den Rücken. Noch immer umklammerte ich die Füße meines Sohnes. Erst als eine Sirene zu hören war, gerieten die Männer in Panik. Sie mutmaßten, dass ein Nachbar wohl den Lärm gehört und die Polizei verständigt hatte. Eine letzte Drehung und dann ein Ruck, der den Schmerz wie einen Stromstoß durch meine Arme schießen ließ, und mein Liebling war verschwunden. In meiner Hand blieb nur einer seiner kleinen gepunkteten Vans zurück. Ich hob ihn ans Gesicht, rollte mich ganz klein zusammen, und dann wurde alles erst still und dann dunkel.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos gewesen war, als ich aufwachte. Ich wusste nur, dass alles ruhig war und ich unerträgliche Schmerzen hatte. Mein rechter Arm hing schlaff herunter und war zu nichts mehr zu gebrauchen, mein Kiefer pulsierte, mein Kopf hämmerte, und mein Gesicht stand in Flammen. Ich versuchte aufzustehen, aber sobald ich mich bewegte, knickte ich wieder ein, und eine neue Welle aus Schmerz und Übelkeit überflutete mich. Meine Nase fühlte sich verstopft an und lief gleichzeitig, und als ich mit der linken Hand darüberwischte, entdeckte ich Blut.
Die Sirene, die ich gehört hatte, musste von einem Krankenwagen oder einem vorbeifahrenden Streifenwagen gekommen sein, denn niemand war zu meiner Rettung erschienen. Da Sommer war, war es draußen noch immer hell, und Sonnenlicht drang durch die Lücke über den Vorhängen. Ich hielt sie immer geschlossen, aber durch den Spalt oben konnte ich sehen, ob Tag oder Nacht war.
Ich hob den Kopf, und durch meine geschwollenen Lider konnte ich meine Handtasche ausmachen. Ich kroch zu dem Beistelltisch am Sofa und zog sie mit der linken Hand zu mir herunter. Ihr Inhalt kullerte auf den Boden, darunter drei Handys: mein privates Handy und zwei Prepaid-Wegwerfhandys, die ich vor wenigen Tagen bei Walmart gekauft hatte. Mit einem der Wegwerfhandys rief ich meinen Sohn in New York an. Gabe meldete sich beim dritten Klingeln, weil er dachte, es sei sein Vater, aber dann erkannte er meine Stimme und fragte, was passiert sei.
Ich erzählte ihm, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Ich sagte ihm, er müsse nach L. A. kommen und mich holen und dass ich schwer verletzt sei. Doch er rief immer nur: »Wähl den Notruf.«
Ich konnte den Notruf nicht wählen. Weder konnte ich zur Polizei noch ins Krankenhaus. Man würde mir Fragen stellen. Man würde herausfinden, dass ich meine Kinder ohne gerichtliche Genehmigung aus Indien entführt hatte. Ich würde sie verlieren.
Ich befand mich immer noch in dem Irrglauben, dass ich sie nicht bereits verloren hatte.
Mein privates Handy erwachte zum Leben, und auf dem Display tauchte Juleens Name auf. Abrupt beendete ich das Telefonat mit meinem Sohn, um ihren Anruf entgegenzunehmen, sagte aber nicht sofort etwas, weil am anderen Ende ja auch die Schlägertypen sein konnten. Aber dann fragte sie: »Mommy, geht es dir gut?«
Brennende Tränen quollen mir aus den Augen und rannen an meinen aufgeplatzten Wangen hinab. »Juleen, wo bist du?« Meine Worte klangen undeutlich und verwaschen. Ich konnte meinen Kiefer kaum bewegen.
»Mommy?«
Diesmal sprach ich langsamer und so deutlich, wie ich konnte.
»Wo … bist … du?«
Wahrscheinlich nicht die schlaueste Frage. Ich hatte keine Ahnung, ob mein Handy abgehört wurde und geortet werden konnte.
»In einem Versteck …«
»Still!«, unterbrach ich sie. »Weißt du noch, wo wir gestern zu Abend gegessen haben?« Es kostete mich mehrere Versuche, mich verständlich zu machen. Bei jedem Wort schoss der Schmerz durch meinen Kiefer.
Endlich sagte sie: »Ja, weiß ich.«
»Kannst … du … allein … dorthin gehen?«
»Ja.«
Ms. Hypererwachsen.
»Mach … dein … Handy aus. Sieh dich um. Warte in der Nähe … vom Eingang. Ich werde …« Es wurde immer schwerer zu reden und zu atmen. »Da … treffen wir uns.«
Ich legte auf. Immer noch im Liegen sammelte ich den gesamten Inhalt meiner Handtasche wieder ein. Dann gelang es mir, mich aufzusetzen und auf die Füße zu kommen. Sofort fühlte ich mich benommen, und mir wurde übel.
Ich übergab mich.
Gut, dass ich dem Wohnungsverwalter so eine große Kaution für die Endreinigung gegeben hatte.
Ich hielt mich an der Rückenlehne des Sofas fest und sagte mir, dass ich mich langsam bewegen müsse – als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Danach hangelte ich mich an den Möbeln und schließlich an der Wand entlang und schaffte es bis in die Küche, wo ich mir zwei Mülltüten holte. Als Nächstes tastete ich mich zu Juleens Zimmer vor, mit den Händen an der Flurwand, um nicht umzukippen. Wir teilten uns einen Kleiderschrank, aber keine von uns beiden besaß viel zum Anziehen. Ich begann, Kleider, Hosen und Shirts in die Plastiktüten zu werfen, außerdem Schuhe, Socken und Unterwäsche: nicht mehr, als ich tragen konnte, aber genug, um drei oder vier Tage lang damit auszukommen.
Was die Sachen meines Sohnes betraf, sparte ich mir die Mühe.
Weitere Tränen.
Nicht jetzt, Terry, nicht jetzt.
Ich hielt alles in der linken Hand, weil mein ganzer rechter Arm vor Schmerz brannte. Bevor ich mich aus Juleens Zimmer schleppte, fiel mein Blick auf ihren Geigenkasten. Ich ging in die Hocke – das war einfacher, als mich zu bücken – und hob ihn auf. Das zusätzliche Gewicht sandte weitere Schmerzwellen durch mich hindurch, aber ich konnte nicht ohne die Geige weggehen. Obwohl sie nicht annähernd so ein Wunderkind war wie Gabe, liebte sie diese Geige.
Ich wusste, dass ich nicht zur Vordertür rauskonnte. Sie waren vielleicht immer noch da und warteten auf mich. Ich musste mich an den Plan halten, den ich mit Juleen besprochen hatte, sollte es in dieser Wohnung zu einem Überfall kommen, wie wir ihn gerade erlebt hatten.
Verschließ deine Zimmertür, spring aus dem Fenster und lauf, als sei der Teufel hinter dir her.
Und sie hatte sich vorbildlich daran gehalten. Das Fenster nach hinten raus stand immer noch halb offen. Ich konnte es nicht weiter nach oben schieben. Zu schmerzhaft, zu wenig Kraft. Glücklicherweise bin ich nicht besonders groß – nicht so klein wie Juleen, aber ich konnte mich hindurchzwängen. Ich warf die Tüte zusammen mit meiner Handtasche aus dem Fenster. Den Geigenkasten nahm ich in die linke Hand, drückte ihn fest an mich und hoffte das Beste. Als ich auf dem Boden aufschlug, wurde ich von den Schmerzen in meiner rechten Seite fast ohnmächtig. Aber ich rappelte mich hoch, hob die Plastiktüten und meine Handtasche auf und machte mich auf den Weg zu meinem Wagen einen Häuserblock entfernt.
Mir wurde bewusst, dass mein Gesicht wahrscheinlich furchtbar aussah. Ein Auge war zugeschwollen, das andere verquollen, aber zumindest konnte ich damit etwas sehen, wenn ich es etwas zusammenkniff. Wahrscheinlich sah ich für jeden, der sonst noch auf den Straßen unterwegs war, wie eine Obdachlose aus. Aber wir befanden uns in Los Angeles. Niemand ging hier zu Fuß. Und selbst wenn, hätte ein einziger Blick auf mich genügt, und die Person hätte weggeschaut. Keiner wollte etwas Hässliches sehen. Außerdem scherte sich niemand darum.
Ich stellte das Auto nie vor meiner Wohnung ab, aber Devek hatte mich trotzdem gefunden. Normalerweise war mein Mann sanft und sogar so etwas wie ein Waschlappen. Aber seine Spielsucht in den letzten drei Jahren hatte ihn in Bedrängnis gebracht. Er hatte verzweifelte Maßnahmen ergriffen, um an Geld zu kommen, und bei seinen letzten Unternehmungen war er zu weit gegangen. Deshalb hatte ich gehen müssen.
Ich musste gehen.
Ich war in ständiger Alarmbereitschaft, aber das bedeutete nicht, dass ich nicht betete. Gabe war zum Judentum übergetreten, und meine beiden jüngeren Kinder waren Hindus. Ich selbst hatte als Katholikin das Licht der Welt erblickt. Ich war nicht wählerisch, wer sich da oben befand, solange Gott zuhörte. Und sobald es mir gelungen war, den Schlüssel für meinen Wagen hervorzukramen und die Tür aufzuschließen, bedankte ich mich bei ihm. Ich öffnete die Heckklappe und warf meine Sachen hinein. Kaum dass ich hinter dem Lenkrad saß, verriegelte ich die Tür und atmete tief durch.
Sitzen erwies sich als noch schmerzhafter denn stehen, aber ich hatte keine Wahl. Ich drückte mit der linken Hand auf den Startknopf, sah mich mehrmals um, wobei ich bedachte, dass ich kaum etwas sehen konnte, und fuhr los. Mit dem Auto brauchte ich fünf Minuten zum Restaurant. Juleen saß auf der Bank neben der Tür, ihr Telefon und ihren Laptop in der Hand. Ich fuhr vor, und sie stand auf. Ich bemerkte, dass sie humpelte, als sie auf mich zukam. Sie öffnete die Beifahrertür und schlüpfte hinein. Es war kurz vor neunzehn Uhr. Sie sah mein Gesicht und schnappte nach Luft.
»Es geht mir gut.« Das war offensichtlich nicht zutreffend. Ich verließ den Parkplatz und fädelte mich in den Verkehr ein. »Ich bin okay.«
Tränen kullerten ihr aus den Augen. Sie griff nach meinem kaputten rechten Arm, und ich schrie vor Schmerz auf. Sofort ließ sie ihn los.
»Mein Arm ist ein wenig … empfindlich.«
»Mommy, ich rufe den Notruf …«
»Nein!«
»Du musst ins Krankenhaus!«
»Sie werden dich mir wegnehmen … dich nach Indien zurückschicken. Willst du das?«
Ich wusste nicht, wie viel sie bei meiner verwaschenen Aussprache verstand, aber sie musste ungefähr begriffen haben, was ich gesagt hatte, denn sie schüttelte den Kopf.
»Es geht mir gut.« Vor einer roten Ampel musste ich halten. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich fuhr oder was ich tun sollte, also parkte ich am Straßenrand. Dann fiel es mir wieder ein. »Ruf Gabe an.« Als sie nach ihrem Handy griff, fügte ich hinzu: »Nimm ein Wegwerfhandy … In meiner Handtasche ist eins.«
»Okay.«
Sie fischte ein Wegwerfhandy heraus und rief ihren Bruder an, dessen Telefonnummer sie auswendig kannte.
Hypererwachsen.
Aus dem Telefon kam die aufgebrachte Stimme meines Sohnes. »Endlich! Wo bist du?!«
Ich bat meine Tochter, ihn auf Lautsprecher zu stellen. Juleen sagte: »Gabe, du musst herkommen. Mommy ist verletzt!«
»Schlimm?«
»Ja, schlimm.«
»Was ist passiert?«
Juleen ging auf die Frage nicht ein. »Du musst uns holen kommen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen.«
»Wo ist Sanjay?«
Tränen strömten mir aus den Augen, und ich flüsterte: »Weg.«
»Was ist passiert?« Nach einer Pause: »Mom?«
»Jemand ist in die Wohnung eingedrungen«, berichtete Juleen. »Mehr weiß ich nicht. Mom hat mir gesagt ich soll wegrennen, und das hab ich gemacht.«
»Sie haben Sanjay mitgenommen?«
Ich nickte, dann fiel mir ein, dass er mich nicht sehen konnte. »Ja.«
»Und dich zusammengeschlagen?«
»Ja.«
»Wo seid ihr jetzt?«
»Wir sitzen im Auto«, antwortete Juleen.
»Sie fährt selbst?«
»Wir stehen im Moment am Straßenrand. Du bist auf Lautsprecher, Gabe. Sie kann alles hören. Aber sie kann nicht gut reden. Sie haben sie im Gesicht verletzt.«
»O Gott«, murmelte Gabe. »Diese Telefonnummer kenne ich nicht. Telefonierst du mit einem Wegwerfhandy?«
»Ja«, flüsterte ich.
»Kannst du mir die Nummer geben? Sie wird mir als unterdrückt angezeigt. Wenn es wie beim iPhone ist, müsste die Nummer ganz oben in deiner Kontaktliste stehen.«
»Lass mich nachsehen«, sagte Juleen. »Okay … hab sie. Ich geb sie dir durch.«
»Großartig! Danke, Jules.« Eine Pause. »Das ist zumindest ein Anfang. Mom, hör mir genau zu. Ich kann frühestens morgen Nachmittag da sein. Du bist verletzt. Du musst in ein Krankenhaus gehen …«
»Nein!«
»Sie wird nicht ins Krankenhaus gehen«, sagte Juleen. »Sie meint, man würde ihr dort Fragen stellen und mich ihr wegnehmen.«
»Ich dachte mir schon, dass das ein Problem ist.« Eine weitere Pause folgte. »Also, das ist Plan B. Mom, hörst du zu?«
»Ja.«
Ein Seufzen drang durchs Telefon. »Als ich beim ersten Mal mit dir geredet habe, klang es so, als bräuchtest du sofort Hilfe.«
»Das tut sie«, warf Juleen ein.
»Mom, ich habe Chris gebeten, dir zu helfen. Er ist viel näher bei euch, und er kennt sich in L. A. genauso gut aus wie ich. Er hat einen Jet. Er könnte in zwei Stunden dort sein. Tatsächlich kann es sehr gut sein, dass er bereits unterwegs ist. Wenn du Schutz brauchst, und es hört sich so an, als würdest du das, gibt es niemand Besseren, der dir helfen kann.«
Ich schloss mein unversehrtes Auge. Chris. Vom Regen in die Traufe … Mein Leben war eine absolute Katastrophe!
»Mom, bist du noch dran?«
»Ja.«
»Mom, er wird dir nur helfen, wenn du um Hilfe bittest. Ich weiß, das ist ein Pakt mit dem Teufel, aber du musst ihn anrufen. Hier geht es nicht nur um dich, es geht auch um Juleen.«
Ich antwortete nicht, aber ich wusste, dass er recht hatte.
Juleen schaltete sich ein: »Gib mir die Nummer, dann ruf ich ihn an.«
»Er wird dir nicht helfen, Jules«, sagte Gabe. »Nur Mom. Sie muss sich mit ihm in Verbindung setzen.«
»Gib mir die Nummer«, murmelte ich.
»Was hat sie gesagt?«
»Sie hat gesagt, du sollst ihr die Nummer geben«, erwiderte Juleen. »Ich werde sie für sie aufschreiben.«
»Jules, ruf mich zurück, sobald Mom mit meinem Dad gesprochen hat, okay?«
»Okay.«
»Jules, mein Dad kann extrem schroff und gemein sein. Also, wenn du ihm begegnest, sei einfach gelassen und superhöflich, ganz egal, was er sagt oder wie er sich benimmt.«
»In Ordnung.«
»Ich gebe dir hier wirklich die Quintessenz meiner Erfahrungen mit auf den Weg. Merk es dir.«
»Okay. Lass mich jetzt auflegen, damit Mom mit ihm sprechen kann.«
Hypererwachsen.
»Ich hab dich lieb, Mom.«
Ich konnte nicht antworten. Es wurde immer schwerer zu sprechen. Ich konnte mich kaum wachhalten. Juleen legte auf und wählte die Nummer meines Ex-Mannes. Es klingelte dreimal, dann meldete sich die Mailbox.
»Mr. Whitman, hier ist Juleen, Teresa McLaughlins Tochter. Mein Bruder Gabe hat mir gesagt, ich soll Sie anrufen. Meine Mutter ist verletzt und kann nicht so gut sprechen, aber sie wird mit Ihnen reden, wenn Sie zurückrufen. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer dieses Telefons durch. Bitte, bitte, rufen Sie zurück. Vielen Dank, Sir.«
Ich sah meine Tochter an und reckte den Daumen hoch.
»Was jetzt?«, fragte sie. Als ich nicht antwortete, sagte Juleen: »Mommy, wir können nicht hierbleiben. Sie kommen vielleicht zurück.«
Ich nickte und fuhr los.
»Wohin fahren wir?«
»Ich … weiß es nicht.«
»Du kannst nicht einfach nur durch die Gegend fahren.«
Sie hatte recht. Ich dachte einen Moment lang nach. »Wir fahren zu meinem … Haus.«
»Welches Haus?«
Ich winkte ab.
»Welches Haus?«
»Das, in dem ich aufgewachsen bin.«
»Du bist hier aufgewachsen?«
Ich nickte.
»Kennt Mr. Whitman es?«
»Donatti«, korrigierte ich sie. »Mr. Donatti.«
Das Wegwerfhandy klingelte. Juleen schaltete auf Lautsprecher und nahm den Anruf entgegen. »Hallo?«
Ich hörte die Stimme meines Ex-Mannes. »Terry?«
Es war nicht das erste Mal, dass man Juleen und mich am Telefon verwechselte. Unsere Stimmen klangen sehr ähnlich. »Ich bin … hier«, flüsterte ich.
»Was ist da los bei euch?«, fragte Chris.
Ich begann zu weinen, und Juleen tat das Gleiche. »Sie haben sie zusammengeschlagen«, murmelte sie.
»Wo seid ihr?«
»Valley«, antwortete ich.
»Wo im Valley?«
»Sie fährt zu dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist«, erklärte Juleen.
»Sie fährt?«
»Wissen Sie, wo ihr altes Haus ist?«
»Ja, weiß ich. Fahrt nicht dorthin …«
Die Verbindung brach ab. Juleen rief ihn zurück, aber der Anruf ging auf die Mailbox.
Die Sonne ging langsam unter, und schon bald würde die Dunkelheit uns Schutz bieten. Wir waren ungefähr eine Meile von der Wohnung entfernt, die wir gemietet hatten, und vier Meilen von unserem alten Haus. Mein funktionierendes Auge fing jetzt ebenfalls an, sich zu schließen. Ich wusste, wenn ich nicht bald dort ankam, würde ich überhaupt nicht mehr fahren können. Mir platzte schier der Kopf vor Schmerz, und ich wurde immer schläfriger. Ich beschloss, in Richtung meiner alten Highschool zu fahren – ein gemeinsamer Orientierungspunkt für Chris und mich. Immer wieder schüttelte ich den Kopf, um wach zu bleiben. Jedes Mal, wenn ich das tat, durchzuckten Blitz- und Donnerschläge mein Gehirn.
Das Wegwerfhandy erwachte jäh zum Leben. Juleen meldete sich. »Wir sind auf Lautsprecher, Mr. Donatti.«
»Terry, bist du da?«
»Hi, Chris.«
»Terry, hör mir zu. Bist du physisch überhaupt in der Lage, Auto zu fahren?«
Ich antwortete nicht.
»Terry?«
»Ja.« Noch.
»Fahr nicht zu eurem alten Haus, Babe. Wenn ich nach dir suchen würde, würde ich mich genau dort auf die Lauer legen. Erinnerst du dich, wo ich früher gewohnt habe?«
»Ja.«
»Fahr dorthin. Die Adresse ist Jasper – 8246 … Nein, 8446 …«
»8226«, sagte ich ihm.
»Dein angeschlagenes Hirn funktioniert besser als meins. Schaffst du es da hin?«
»Ja.«
»Okay, gut. Ich stoße dort in zwei Stunden zu euch. Wahrscheinlich geht es sogar noch schneller. Ich werde zweimal die Scheinwerfer aufblenden, dann eine kleine Pause machen und erneut zweimal aufblenden, damit du weißt, dass ich es bin. Blende du dann ebenfalls auf. Steig unter gar keinen Umständen aus dem Wagen. Ich werde zu dir kommen.«
»In Ordnung.«
»Juleen, achte darauf, dass sie nicht einschläft, das darf auf keinen Fall passieren. Kann ich mich auf dich verlassen?«
»Ja, Sir.«
»Gut. Dann bis später.«
Nachdem er aufgelegt hatte, fragte Juleen: »Kannst du fahren, Mommy?«
»Ja.« Jedenfalls irgendwie. »Mir geht’s … gut.«
Wir brauchten ungefähr eine halbe Stunde, um vier Meilen über leere Straßen zu fahren. Ich erreichte die Jasper Street genau in dem Moment, als das restliche bisschen Tageslicht endgültig am Horizont erlosch. Das letzte Mal war ich mit sechzehn in dieser Wohnung gewesen, als ich bis über beide Ohren in den tollsten Typen der Highschool verliebt gewesen war. Ich hatte Chris in seiner Wohnung und auch bei mir zu Hause ungefähr drei Monate lang Nachhilfeunterricht gegeben, bis es zwischen uns komisch wurde und ich nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Im Grunde wusste ich, dass er nichts taugte, aber ich kehrte immer wieder zu ihm zurück. Als ich das letzte Mal hier war, verbrachten wir die Nacht zusammen. Es wurde intim, auch wenn wir keinen Sex hatten. Den hatten wir dann in einem Gefängnis irgendwo in der Mojave-Wüste. Als ich endlich beschloss, die Notbremse zu ziehen, war es bereits zu spät. Aber am Ende hatte sich alles gefügt. Eine Welt ohne Gabriel konnte ich mir nicht vorstellen. Ich schloss die Augen und hoffte darauf, nichts mehr zu spüren.
Plötzlich drehte Juleen das Radio voll auf.
»Schalt … das aus!«
»Er hat mir aufgetragen, dich nicht einschlafen zu lassen.«
»Wer?«
»Mr. Whit… Mr. Donatti. Du weißt schon, Gabes Vater.«
Ich beugte mich vor und schaltete das Radio wieder aus. »Es geht mir gut.« Eine Minute später fielen mir wieder die Augen zu. Juleen rüttelte mich. Ich sagte: »Lass mich in Ruhe.«
»Du darfst nicht einschlafen.«
Ich hörte sie kaum, dämmerte weg. Sie rüttelte mich immer wieder wach. Dann schaltete sie das Radio wieder ein. Ich machte es aus. Als sie erneut zum Knopf langte, schlug ich nach ihrer Hand. Sie ließ sich nicht beirren, sondern fuhr fort, mich zu schütteln, mich anzuschreien und vor meinem Gesicht in die Hände zu klatschen. Irgendwann war ich sogar zu müde, sie anzubrüllen. Dann begann ich ernsthaft zu weinen. Ich weinte, weil ich mein Leben so komplett ruiniert hatte. Ich weinte, weil ich schreckliche Schmerzen hatte. Vor allem weinte ich bei dem Gedanken an meinen verlorenen kleinen Sohn. Es zerriss mir das Herz.
Er musste solche Angst haben!
»Es wird alles wieder gut, Mommy. Es wird alles wieder gut.«
Ich konnte Juleen nicht antworten. Ich konnte kaum atmen, und weinen machte es nur noch schlimmer. Hier saß ich, eine 42-jährige Frau, vollkommen pleite und komplett am Boden. Ich hatte in puncto Männer schreckliche Entscheidungen getroffen. Ich hatte meinen älteren Sohn im Stich gelassen und meinen jüngeren nicht retten können. Ich gab ein fürchterliches Vorbild für Juleen ab. Sie tröstete mich, statt andersherum. Was war los mit mir, dass ich nicht einmal ein Minimum an elterlicher Fürsorge leisten konnte?
Ich trocknete mir mit dem Ärmel die Augen. Meine Lider waren jetzt völlig zugeschwollen. Wenn ich eins mit den Fingern anhob, konnte ich etwas sehen. In meinem Kopf hämmerte es, und mir war schwindlig und übel. Immerhin konnte ich noch denken, mein Gehirn war also intakt. Außerdem hatte ich nach wie vor meine Sehkraft, einen gesunden Arm und zwei funktionierende Beine. Das war doch schon etwas.
Es erschien eine SMS auf dem Wegwerftelefon in Juleens Händen. Sie sagte: »Es ist Gabe. Er will wissen, was mit uns und seinem Dad ist. Was soll ich ihm antworten?«
Mein lichter Moment war schon wieder verflogen. Ich konnte zwar nicht sprechen, aber ich konnte mit einer Hand eine Nachricht schreiben. Ich griff nach dem Telefon und tippte unbeholfen mit dem linken Zeigefinger meine Sätze.
Wir haben Chris kontaktiert. Er ist auf dem Weg hierher.
Gott sei Dank! Ich werde zu euch kommen. Wahrscheinlich morgen.
Mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut.
Wie fühlst du dich?
Okay. Müde. Wir sprechen später.
Und das war nicht gelogen. Ich war völlig erschöpft. Nachdem ich Juleen das Handy zurückgegeben hatte, schrieb sie ihm eine Nachricht. Ich lehnte den Kopf zurück und schaute zur Decke des Autos, während ich einnickte. Juleen rüttelte mich nach fünfzehn Sekunden glückseliger Leere wach. Kaum war ich wieder bei Bewusstsein, kehrte der Schmerz mit voller Wucht zurück. Das Wegwerfhandy klingelte, und Juleen hielt es mir ans Ohr. Es war Gabe. »Du bist Ärztin. Du müsstest es besser wissen. Bleib wach!«
»Ja … ja.«
Aber sobald er auflegte, nickte ich wieder ein. Juleen schnippte mit den Fingern, klatschte in die Hände und zog mir an den Haaren, was wirklich wehtat. Ich musste daran denken, wie dieser Schlägertyp mir die Haare ausgerissen hatte. Ich betastete meinen Kopf und tatsächlich, da war eine kleine kahle Stelle.
Ich wollte einfach nur schlafen, aber Juleen ließ mich nicht. Keine Ahnung, wie lange das Geklatsche und Fingerschnipsen und Geschüttele anhielt, aber es erschien mir wie eine Ewigkeit. Irgendwann hörte ich den Motor eines Autos. Ich zog ein Augenlid hoch und sah ein zweimaliges Blinken, eine Pause, dann wieder zweimaliges Blinken.
Das ist er, dachte ich. Ich vergaß, sein Signal zu erwidern. Stattdessen öffnete ich die Tür, machte Anstalten aufzustehen und fiel sofort zuerst auf die Knie, dann aufs Gesicht. Die Übelkeit überwältigte mich. Wieder übergab ich mich, heftig und schnell. So heftig, dass ich mich einnässte – etwas Feuchtes und metallisch Riechendes breitete sich vorne an meiner Jeans aus.
Vom Boden aus sah ich, wie dieser sehr große Mann mit den schulterlangen Haaren aus dem Wagen stieg und auf mich zugerannt kam. Mit einer einzigen Bewegung und ohne jede Anstrengung hob er mich hoch. Starke Arme – seine Arme. Sein Geruch. Ich dagegen war von oben bis unten voll mit Kotze und Blut und stank wie eine öffentliche Toilette. Aber er sagte kein Wort, während er mich zu seinem Wagen trug. Ich zog ein Augenlid hoch und schaute über meine Schulter zu meiner Tochter, die zwei Mülltüten, ihren Geigenkasten, ihren Laptop und meine Handtasche trug, und so schnell sie konnte hinterherhumpelte, um mich einzuholen. Chris’ Augen folgten meinem Blick.
»Hol mal irgendjemand das Mädchen!«
Sofort lief ein anderer Mann los, um Juleen zu helfen.
Santa war mit seinen Wichteln gekommen.
Chris setzte mich auf der mittleren Rückbank einer Stretchlimousine ab und schob sich auf den Sitz neben mich. Ich hielt noch immer mein Augenlid hoch, als er seine Hand um mein Kinn legte und mein Gesicht untersuchte. »Verdammte Scheiße!« Er schaute auf meine Hose. »Terry, du musst ins Krankenhaus.«
»Nein …« Ich ließ mein Augenlid los, wodurch mir nur Schmerz und Dunkelheit blieben. Wenn ich nichts sehen konnte, würde das alles vielleicht verschwinden.
»Du pinkelst Blut!« An jemand anderen gewandt fügte Chris hinzu: »Welches ist das nächstgelegene Krankenhaus?«
Er hörte mir offensichtlich nicht zu, was einfach typisch war. Ich brüllte: »Nein!«
Juleens Stimme drang an mein Ohr. »Sie will nicht ins Krankenhaus. Sie hat Angst, dass man mich ihr wegnehmen wird.«
»Dann wirst du ihr eben weggenommen. Immer noch besser, als sie sterben zu lassen.«
Jemand ließ den Wagen an. Wir fuhren einige Minuten, und von der Bewegung wurde mir wieder übel. Ich würgte einige Male.
»Halt an«, befahl Chris. Ich hörte, wie die Autotür geöffnet wurde, und er hielt mich fest, während ich mich ein drittes Mal übergab und würgte, bis ich das Gefühl hatte, als würde mein Magen mit rauskommen. »Außerdem erbrichst du Blut«, stellte er fest.
Ich wusste, was das bedeutete, aber es war mir egal. Ich würde jedenfalls kämpfend sterben. Ich schlug nach ihm. »Nicht ins … Krankenhaus!«
Chris zog mein Augenlid hoch. »Hör mir zu, Teresa. Wenn du nicht bald Hilfe bekommst, wirst du sterben! Verdammt noch mal, du bist Ärztin. Du weißt es doch besser.«
Fast buchstabengetreu Gabes Worte. Ich schlug erneut nach ihm. »Nein!«
»Hör auf, nach mir zu schlagen wie nach einer nervigen Mücke.« Er hielt immer noch mein Augenlid hoch, und eine strahlend blaue Iris starrte mir entgegen. Dann ließ er mein Lid sinken und die Dunkelheit hüllte mich wieder ein.
»Ich tue das hier wider mein besseres Wissen.« Er hielt inne. »Okay, Terry, ich mache Folgendes. Ich nehme euch zwei mit. Ich bin Miteigentümer einer Notfallambulanz, die rund um die Uhr geöffnet hat. Dort werde ich euch hinbringen. Ich verspreche dir, dass niemand Fragen stellen wird, okay?«
Ich nickte.
»Für eine Situation wie diese sind wir dort nicht ausgerüstet. Meistens verabreichen wir lediglich Antibiotika oder Schmerzmittel, oder wir verbinden eine Zerrung. Im äußersten Fall stabilisieren wir Herzinfarktpatienten und schicken sie dann weiter in ein größeres Krankenhaus in Elko. Aber ich rufe an und erzähle, womit ich es hier zu tun habe. Wenn der Arzt mir sagt, du musst nach Elko, dann fährst du nach Elko. Ende der Diskussion. Okay?«
»Okay.«
»Fahren Sie los«, sagte Chris. »Gnade mir Gott, wenn du stirbst.« Er verfiel ein paar Sekunden in Schweigen. »Was zur Hölle ist mit deinem Arm los?« Als er meine rechte Hand anhob, schrie ich vor Schmerz auf. »Ich vermute, deine Schulter ist ausgekugelt. Halten Sie noch mal an.«
Der Fahrer gehorchte.
»Das kann ich in Ordnung bringen«, sagte Chris. »Wahrscheinlich wird es den Schmerz ein wenig lindern, aber wenn der Arm gebrochen ist, könnte es die Sache auch verschlimmern.«
»Tape …«
»Was hast du gesagt?«
Ich bedeutete Juleen, mir das Handy zu geben. Dann zog ich ein Augenlid hoch und schaffte es, einen Finger über die Buchstaben des Handys zu bewegen. Ich tippte: Tape den Arm.
Chris las es. Dann sagte er: »Haben wir irgendwelches Klebeband?«
Jemand auf dem Vordersitz antwortete: »Ich habe Isolierband.«
Serienmörder, dachte ich.
»Gib es mir«, sagte Chris. »Das wird an ihrem Arm kleben bleiben.«
Ich machte eine Bewegung mit meiner linken Hand.
»Ich verstehe nicht«, sagte Chris.
»Dreh’s … um.«
»Umdrehen … Ah, na klar.« Er nahm meinen rechten Arm und wieder schrie ich vor Schmerz, während er anfing, meinen Unterarm mit der nicht klebenden Seite so fest zu umwickeln, wie er konnte. Es fühlte sich an, als würde er mir den Arm abbinden. Ich schluchzte, weil es so wehtat.
»Halt durch, Baby. Fast fertig.« Schließlich sagte er: »Das wird jetzt noch mal wehtun …«
»Mach …«
Er nahm mein Handgelenk, zog meinen Arm mit Kraft nach vorne, direkt von mir weg, sodass die Kugel in die Gelenkpfanne zurückglitt. Ich kreischte vor Schmerz. Anschließend tat es immer noch weh, aber ich konnte die Finger bewegen.
Der Arm ließ sich aber dennoch nicht ohne Schmerzen bewegen. »Besser«, flüsterte ich. Ich zog an dem Klebeband.
»Willst du, dass ich das Band abnehme?«, fragte Chris.
Ich nickte.
»Halt still.« Einen Moment später spürte ich etwas Kühles, das über das Isolierband an meinem Arm glitt. Wahrscheinlich ein Messer. Chris hatte immer Waffen bei sich. Auch jetzt, an seine Brust geschmiegt, konnte ich seine Pistole in ihrem Schulterholster spüren.
»Wag es ja nicht, einzuschlafen«, sagte er. Ich war zu müde, um ihm zu antworten. Er redete trotzdem weiter … um mich wachzuhalten. »Ich weiß, wir hatten unsere Probleme, aber es gab auch viele gute Zeiten. Weißt du noch, in Vegas zum Beispiel … Ich hab dich an unserem fünften Hochzeitstag dorthin mitgenommen. Und wir haben uns beide so volllaufen lassen, dass wir zu Boden gefallen sind, kaum dass wir das Hotelzimmer betraten.« Er hielt inne. »Und wir konnten gar nicht wieder aufhören zu lachen. Wir haben uns die ganze Nacht geliebt und …« Eine weitere Pause. »Und dann sind wir zum Frühstück nach unten gegangen … nachdem wir die ganze Nacht oben gewesen waren. Wir sahen schrecklich aus – na ja, ich sah schrecklich aus, du nicht. Du sahst immer gut aus, Terry, egal, was los war.«
Ähm, das sehe ich anders.
»Wie dem auch sei, wir sind runter ins Casino gegangen. Und da stand dieser riesige Spielautomat, der nur 10-Dollar-Jetons genommen hat. Du wolltest spielen, und ich habe gesagt, du könntest das Geld genauso gut die Toilette runterspülen.«
Wie wahr.
»Aber du hast darauf bestanden, also hab ich dir einen Jeton gekauft. Und du hast den Hebel runtergezogen. Genau einmal.« Er stieß ein Lachen aus. »Einmal gezogen, und die Glocke ging los. Du hast ein paar Riesen gewonnen. Nicht der große Jackpot, aber es war eine ziemlich gute Rendite.«
Seine Stimme klang wie aus weiter Ferne, wie schwache Musik von einer Parade.
»Du wolltest es mir geben … das Geld. Aber ich habe gesagt, du sollst es behalten und es für etwas ausgeben, das dir gefällt. Schließlich war es dein Geld.« Ein Herzschlag. »Und du hast mir davon ein Gewehr gekauft – ein antikes belgisches Mauser-Modell von 1893. Ich meine, was zur Hölle sollte ich mit einem antiken Gewehr anfangen? Aber du warst so glücklich, es mir kaufen zu können. Das Lächeln auf deinem Gesicht … reine Glückseligkeit. Weißt du, das Gewehr hab ich noch. Im Lauf der Jahre habe ich jede Menge Waffen gekauft und wieder verkauft, aber dieses Gewehr würde ich nie hergeben.«
Er verstummte für einen Moment.
»Und weißt du noch, dass du mir zu meinem Geburtstag immer diese fantastischen Kuchen gebacken hast? Ich glaube, der erste war … ein Kuchen in der Form eines Cellos.« Er hielt kurz inne. »Und dann war da der Kuchen, der aussah wie eine Malerpalette. Und noch einer, der wie eine Pistole geformt war. Aber der beste … der, an den ich mich als den besten erinnere, den hast du gebacken, als ich mit meinem Onkel wegen organisierter Kriminalität und Beeinflussung der Geschworenen vor Gericht stand. Du hast mir einen ›Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-frei-Kuchen‹ gebacken Gott, ich hab mich schlappgelacht. Es war eine so schwierige Zeit, und es hat einfach … ich weiß nicht. Es hat’s mir einfach leichter gemacht …« An den Chauffeur gewandt, fragte Chris: »Wie lange noch?«
Der Mann auf dem Fahrersitz antwortete: »Zwei Minuten, Sir. Sie haben gerade das Flugzeug fertig betankt.«
»Lass dir vom privaten Jet-Terminal eine Route zuteilen. Ich will sofort starten, wenn wir ankommen.«
»Ja, Sir.«
Ein paar Minuten später wurde der Wagen langsamer, und ich hörte das Dröhnen eines Motors. Ich öffnete ein Auge und sah, dass die Limousine direkt neben einem Flugzeug angehalten hatte. Chris lehnte sich über Juleen hinweg und öffnete mit seinen langen Armen die Tür. »Steig aus, und dann die Treppe hoch.« Als ich Anstalten machte, mich zu bewegen, sagte er: »Du nicht. Deine Tochter. Du wartest hier.«
Sobald er von mir wegrückte – mir seine Schulter als Stütze nahm –, kippte ich zur Seite, bis ich lag. Wenig später half Chris mir aus dem Wagen, dann hob er mich hoch, trug mich die Treppe hinauf und ließ mich in einen Sitz hinunter. »Ich brauche einen nassen Waschlappen und ein paar Kühlpads.« Kurz darauf sagte er: »Der ist zu kalt. Legen sie ihn in die Mikrowelle. Und holen Sie mir ein Handtuch. Und wo zur Hölle bleibt das Kühlpad?«
Ich öffnete mein Auge und schaute mich suchend nach meiner Tochter um, aber Chris versperrte mir die Sicht. »Mach das Auge zu. Das könnte ein wenig brennen.«
Ich kooperierte. Er machte sich daran, mein Gesicht zu säubern. Es dauerte ein paar Minuten, und als er fertig war, tupfte er es trocken. Ich stank immer noch. Er legte mir ein Kühlpad in die linke Hand. »Halte das an dein Gesicht. Du solltest es vielleicht eine Minute drauflassen und dann wieder eine Minute wegnehmen.«
»Danke.« Ich hielt inne. »Tut mir leid.«
»Pscht. Davon will ich nichts hören. Ich muss jetzt Copilot des Flugzeugs spielen, Baby. Wenn du was brauchst, sag es deiner Tochter, und sie holt mich.«
Ich nickte. Er stand auf, und ich sah Juleen mir gegenüber auf der anderen Seite des Gangs sitzen. Das Flugzeug war ein Sechssitzer, und vier Plätze waren belegt. Chris hatte vorgesorgt. Die Männer, die dort saßen, waren nicht einfach nur Männer, sie waren auch seine Waffen.
Chris legte mir den Sicherheitsgurt um. »Wir fliegen über Berge. Genau genommen fliegen wir ins Gebirge. Es wird ziemlich holprig werden, vor allem weil Sommer ist und die heiße Luft nach Einbruch der Dunkelheit nach oben steigt. Das ist völlig normal. Du brauchst nicht nervös zu werden.« Er streichelte mir über den Arm. »Es wird alles wieder gut, das verspreche ich dir.« An Juleen gewandt, fügte er hinzu: »Wenn sie einschläft, leg ihr einfach das Kühlpad aufs Gesicht, okay?«
»Okay.«
Ich streckte die Hand nach meiner Tochter aus, und sie ergriff sie. Binnen einer Minute war ich weg. Und kein noch so lautes Geschrei, kein Rütteln, kein Kühlpad und keine Turbulenz konnten mich aufwecken. Irgendwann glaubten sie, ich wäre gestorben.
Vielleicht war ich das.
KAPITEL 2
Er stank nach Erbrochenem, Blut und seinem eigenen Schweiß. Obwohl er sonst sehr auf Reinlichkeit bedacht war, ertrug er den üblen Geruch notgedrungen. Aber sobald sie in das hinter Doppeltüren versteckte Behandlungszimmer geschoben worden war, würde er sich umziehen müssen. Er hatte in all seinen Büros stets Sachen zum Wechseln. Und er hatte eine Menge Büros. Aus Bequemlichkeit trug er jeden Tag das Gleiche: einen schwarzen Anzug und ein schwarzes T-Shirt, je nach Wetter lang- oder kurzärmelig. Nur seine Stiefel ließen Kreativität erkennen. Er hatte Hunderte von Paaren in allen erdenklichen Farben und aus allen erhältlichen Tierhäuten.
An die Wand gelehnt, versuchte er, wieder zu Atem zu kommen. Hier gab es kein Wartezimmer. Die Männer, die an diesen Ort kamen, waren normalerweise ganz bestimmte Typen: Solche, die für ein paar durchzechte Nächte in Freiheit vorsätzlich Heim und Herd verlassen hatten, reiche alleinstehende Männer, die es sich auf eine ganz spezielle Weise besorgen lassen wollten, und autistische Programmierer ohne soziale Kompetenzen und mit Geld wie Heu. Dafür bekamen sie hier gutes Essen, edelste Spirituosen und jede Menge Sex mit so vielen Frauen – oder Männern –, wie ihre Brieftaschen hergaben. Wer zur Hölle würde ihretwegen im Wartezimmer einer Klinik unruhig auf- und abgehen? Keine Ehefrau, keine Freundin, kein Lover, überhaupt niemand.
Also nein. Keine Wartezimmer. Nur ein Gang mit ein paar Stühlen. Auf einem davon saß das Mädchen, den Kopf gesenkt, zwei Mülltüten, eine Handtasche und einen Geigenkasten zu seinen Füßen.
»Ich geh nach oben«, sagte Donatti. »Ich stinke wie eine Müllhalde. Landon, Sie behalten die Tür im Auge. Petry, Sie das Mädchen. Niemand geht durch diese Tür, bis ich zurück bin. Und niemand, und ich meine wirklich niemand, fasst ohne meine Erlaubnis das Mädchen an. Falls irgendjemand diese Anordnung anzweifelt, erst schießen und dann nachfragen. Ich bin in zehn Minuten wieder da.«
Das Mädchen hob die Hand.
»Was?«, fragte Donatti.
»Ich muss auf die Toilette.«
Es war wahrscheinlich acht Stunden her, seit sie das letzte Mal gepinkelt hatte. Er hob Terrys Handtasche vom Boden auf. »Komm mit … hier lang.« Er führte sie zum Aufzug, und sie fuhren damit in den dritten Stock. Es war dunkel. Donatti schaltete das Licht ein, dann ging er den Flur entlang zu seinem Büro. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass das Mädchen zwanzig Schritte hinter ihm war. Er wartete, bis es ihn eingeholt hatte und öffnete die Tür. Er schaltete auch hier das Licht ein und deutete auf eine weitere Tür. »Da drin.«
Es humpelte hinein und schloss die Tür hinter sich. Er sah sich um. Das hier war eins seiner kleineren Büros. Schreibtisch, Stuhl und ein Schrank. Er bewahrte hier nur sehr wenige Akten auf – lediglich über die Männer, die ernste gesundheitliche Probleme hatten. Er überwachte sie, so wie er alles überwachte. Schließlich wollte er nicht, dass einer seiner Klienten in seinem Gebäude starb.
Schlecht fürs Geschäft.
Er legte die Handtasche seiner Ex-Frau auf den Schreibtisch und einen frischen Satz Anziehsachen daneben, während er darauf wartete, dass das Mädchen herauskam, damit er duschen konnte. Er hörte es hinter der Tür weinen.
Das Bastard-Kind.
Gegen seinen Willen tat sie ihm leid.