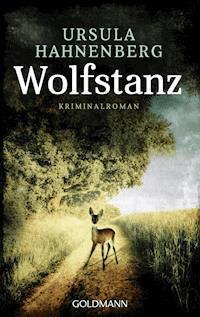
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Julia Sommer
- Sprache: Deutsch
Als im Ebersberger Forst ein junges Mädchen verschwindet, ist die Dorfgemeinschaft von Grafenried in heller Aufregung. Zumal vor Kurzem ein freilaufender Wolf im Wald gesichtet wurde. Als dann tatsächlich die Leiche der jungen Leonie mit verdächtigen Bissspuren gefunden wird, gibt es kein Halten mehr, und eine wilde Hetzjagd beginnt. Nur Försterin Julia Sommer ist skeptisch. Sie glaubt nicht an die Wolfsgeschichte. Zu viele Einzelheiten stimmen nicht, zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Als eine zweite Jugendliche verschwindet, beginnt Julia zu ermitteln. Und kommt einem verzweifelten Mörder auf die Spur …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
In einer nebligen Nacht wird Julia Sommer, Försterin im Ebersberger Forst, zu einem Wildunfall auf einer der Durchgangsstraßen im Wald gerufen. Auf den ersten Blick sieht alles danach aus, als wäre das Reh von dem Auto erfasst und getötet worden. Doch Julia kommen Zweifel. Wurde das Tier nicht etwa angefahren, sondern gerissen? Womöglich von einem freilaufenden Wolf, der vor Kurzem in der Gegend gesichtet wurde? Als kurz darauf die sechzehnjährige Leonie vom Joggen im Wald nicht mehr zurückkehrt, ist die Dorfgemeinschaft von Grafenried erst recht in heller Aufregung. Auch Julia, ihren Sohn Florian und ihre Großmutter Martha nimmt das Verschwinden der liebenswerten Schülerin sehr mit, schließlich passte sie oft auf Flo auf. Als dann tatsächlich Leonies Leiche mit verdächtigen Bissspuren gefunden wird, steht für die meisten Dorfbewohner fest: Das junge Mädchen muss dem Wolf zum Opfer gefallen sein. Plötzlich gibt es kein Halten mehr, und eine wilde Hetzjagd beginnt. Nur Julia ist skeptisch. Denn sie glaubt nicht an das Märchen vom bösen Wolf …
Weitere Informationen zu Ursula Hahnenberg sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
URSULA HAHNENBERG
Wolfstanz
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Originalausgabe Mai 2017
Copyright © 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: plainpicture/Mohamad Itani;
gettyimages/Kristin Hanisch
KS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20298-9V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Oma
Prolog
Sie rannte den Forstweg entlang, der eine schnurgerade Schneise in den Fichtenwald riss. Panisch warf sie einen Blick über die Schulter und stolperte, fing sich aber wieder und rannte weiter. Er war immer noch hinter ihr. Und er hatte an Tempo zugelegt. Ihre Seite schmerzte, und sie atmete heftig und ungleichmäßig.
An der Wegkreuzung verlangsamte sie ihren Schritt. Sollte sie abbiegen und Richtung Dorf rennen? Nein, das gäbe ihm nur die Möglichkeit, zwischen den Bäumen hindurch abzukürzen und sie einzuholen. Erneut blickte sie sich um. Er kam immer näher. Wie lange würde sie ihren Vorsprung noch halten können?
Sie beschleunigte wieder und rannte weiter den Forstweg entlang. Die Fichten wurden von niedrigen Laubbäumen abgelöst. Sie musste runter vom Weg und sich in den Wald schlagen. Dort hätte sie eine Chance, könnte sich verstecken und ins Dorf zurückkehren, wo man ihr helfen würde. Sie retten. War er noch hinter ihr? Sie wagte es nicht, sich wieder umzusehen, aus Angst zu stolpern und hinzufallen. War er da? Sie vernahm nur noch das Rauschen ihres Blutes in den Ohren und ihren keuchenden Atem. Der Wald war totenstill.
Sie verließ den Forstweg und lief ins Dickicht. Hier kam sie langsamer voran. Zweige schlugen ihr ins Gesicht, und ihre Füße sanken in den weichen Waldboden ein. Jeder Schritt kostete sie Kraft, ihre Lunge und Beine schmerzten. Sie bahnte sich einen Weg durch die dicht stehenden Bäume, Zweige mit jungen Blättern stoben an ihr vorbei. Verhöhnten sie, raunten ihr zu, dass sie es nicht schaffen würde, dass sie verloren sei.
Sie spürte einen heftigen Schmerz im Gesicht. Was war das? Ein widerspenstiger Ast, gegen den sie mit dem Kopf geprallt war. Ihre Stirn blutete.
Egal. Weiterrennen. Einen Fuß vor den anderen.
Den Schmerz ignorieren. Laufen.
Leben.
Dann hörte sie das Bellen.
Donnerstag, 5. Mai 2016, Christi Himmelfahrt
Sonnenaufgang
05:48 Uhr
Sonnenuntergang
20:33 Uhr
Minimaltemperatur
1,4 °C
Maximaltemperatur
15,8 °C
Erdbodenzustand (6UTC)
trocken
Niederschlag
0 l/m2
Sonnenscheindauer
10,9 h
Waldbrandgefahrenstufe
2 (gering)
Namenstage
Irene, Jutta, Sigrid
Eins
Auf der Staatsstraße mitten im Forst leuchteten Julia die Lichter der Warnblinkanlage entgegen und fraßen ein bedrohliches Loch in die tiefe Dunkelheit. Der nächtliche Nebel schien jedes bisschen Helligkeit nach wenigen Metern zu verschlucken. Ihre Augen brannten von der Anstrengung, die Straße zu erkennen, und sie konnte ein Gähnen nicht unterdrücken. Sie hasste es, nachts aus dem Bett geklingelt zu werden, aber das gehörte auch zu ihrem Job als Försterin.
Vor dem Opel, der mitten auf der Fahrbahn stand, bremste sie ab, wendete und parkte den Landrover hinter dem Wagen am Straßenrand. Sie drückte auf den Schalter für die Warnblinkanlage, und auch der alte Landy sendete ein pulsierendes Licht in die kühle Nacht.
Kaum war sie aus dem Auto gestiegen, kam ein älterer Mann auf sie zu. Obermeier, der Anrufer. Im rhythmischen Schein der Warnleuchten tanzten die winzigen Wassertröpfchen des Nebels durch die Luft. In der Dunkelheit konnte Julia Obermeiers bärtiges Gesicht nur schemenhaft erkennen, nur sein weißes Hemd über dem rundlichen Bauch leuchtete unter der dunklen Jacke hervor.
»Da sind Sie ja endlich. Ich warte schon eine Ewigkeit.« Er nuschelte ein wenig beim Sprechen, als wäre er nicht ganz nüchtern, und Julia vermutete, dass das auch der Grund war, warum er sie angerufen hatte und nicht die Polizei.
»Grüß Sie, Herr Obermeier.« Julia sah auf ihr Handydisplay. 02:36 Uhr. »Es ist nicht einmal fünfzehn Minuten her, dass Sie mich angerufen und aus dem Bett geholt haben. Schneller ging es nicht. Was ist denn passiert?«
»Nix ist passiert. Ich bin mir ganz sicher, dass nichts passiert ist. Ich hab das Reh nicht überfahren. Das lag schon da.«
Ja klar. Julia unterdrückte ein Stöhnen. »So was passiert manchmal. Bei Dunkelheit sieht man oft nicht, wenn ein Reh auf die Straße läuft. Das ist ganz normal.«
»Das Reh ist nicht auf die Straße gelaufen, das lag schon da. Ich bin mir sicher. Und dann war da noch ein Schatten.«
Ein Schatten? Wie viel hatte der gute Mann getrunken? »Wo ist das Tier denn?«
»Da drüben liegt es, direkt vor meinem Auto.« Obermeier deutete zu seinem Wagen. »Ich konnte gerade noch bremsen, als ich gesehen hab, dass da was liegt. Ein Verkehrshindernis ist das!« Obermeier wandte sich um und ging vor sein Auto.
Julia folgte ihm. Vor der Kühlerhaube des Opels lag der hellbraune Körper eines Rehs und wurde rhythmisch von den Warnleuchten erhellt. Gerade noch bremsen. Ja genau. Die Vorderräder berührten den Rücken des Tiers. Es lag ganz still. Die Bauchdecke hob und senkte sich nicht. Es war tot. Eine Schande.
Sie kramte ihr Handy aus der Tasche und machte ein paar Fotos von dem Reh. Dann zog sie ein Paar Einmalhandschuhe aus der Jackentasche, streifte sie sich über die Hände und zerrte das Tier an den Läufen an den Straßenrand. Als sie sich aufrichtete, bemerkte sie, dass Obermeier sie beobachtete. Schwankte er? In seinem Zustand würde er ihr keine Hilfe sein. »Herr Obermeier, wie wäre es, wenn Sie sich schon mal in meinen Wagen setzen? Ich sehe mir das hier alles genau an, mache noch ein paar Fotos, und dann stellen wir Ihren Wagen ab, und ich bringe Sie nach Hause.«
Obermeier zögerte und kratzte sich am Kopf. »Wieso denn nach Hause bringen? Ich kann selbst fahren!«
»Ich denke, Sie sollten heute Nacht nicht mehr selbst Auto fahren, Herr Obermeier«, sagte sie sanft.
Obermeier richtete sich auf. Trotzdem reichte er Julia nur bis zur Nasenspitze. »Ich kann fahren!«, wiederholte er entrüstet.
Julia überlegte. Es hatte keinen Sinn, mit ihm zu streiten. Aber fahren lassen konnte sie ihn auch nicht. »Hören Sie, Herr Obermeier. Entweder Sie lassen sich von mir nach Hause fahren, oder ich rufe die Polizei. Auf mich macht es den Eindruck, als hätten Sie ein oder zwei Bier zu viel getrunken«, sagte sie bestimmt.
Obermeier machte den Mund auf, um erneut zu protestieren, schwieg aber, als Julia sich abwandte.
Sie beugte sich wieder zu dem Reh hinunter. »Ich muss mir noch mal ansehen, wo Sie das Reh angefahren haben.«
Obermeier blieb hinter ihr stehen. Sein Schatten bedeckte das Reh und reichte bis in die erste Baumreihe. Dahinter verschluckte der Nebel alles in einem diffusen Grau, das im Licht der Autoscheinwerfer eine Wand bildete.
»Aber Frau Sommer, das hat wirklich schon da gelegen, ich hab es nicht umgefahren. Glauben Sie mir das! Da war was anderes, was Unheimliches. Ich hab was weghuschen sehen, ganz sicher.«
»An Ihrem Auto ist nichts kaputt?« Sie sah ihn nicht an, sondern aktivierte die Taschenlampe an ihrem Handy.
Obermeier schüttelte den Kopf.
Julia zögerte. Dann stand sie auf und wandte sich dem Opel zu. Mit dem Handy leuchtete sie über die Motorhaube und Stoßstange. Tatsächlich war kein Schaden zu entdecken. »Dann schauen Sie halt morgen bei Tageslicht noch einmal nach und rufen mich an, falls Sie doch eine Beschädigung an Ihrem Auto finden.«
Er sah sie fragend an.
»Wegen der Versicherung, damit Sie den Schaden melden können. Dazu brauchen Sie eine Bestätigung von mir.«
Ihre Erklärung schien ihn nicht zu beruhigen. Er murmelte wieder, dass das Reh schon da gelegen hätte.
Julia beugte sich erneut zu dem Tier und leuchtete mit dem Handy über seinen Körper. An der Stelle auf der Straße, wo das Tier zuerst gelegen hatte, hatte sie dunkle Flecken gesehen. Blut. Das konnte wiederum sehr wohl von einem Unfall stammen. In der Dunkelheit war das nicht leicht zu erkennen. Sie machte ein Foto. Der Blitz ließ die Nebelschwaden gespenstisch aufleuchten. Sie packte das Tier wieder an den Läufen und drehte es herum. Wieder beleuchtete sie es, machte noch ein Foto, zögerte. Am Hals des Tieres bemerkte sie eine große Wunde. Nein, um genau zu sein, waren es mehrere kleine Wunden, die sich entlang der Kehle bis zum Kopf des Rehs aneinanderreihten. Konnten diese Verletzungen von einem Unfall stammen? Für einen Autounfall waren sie eher ungewöhnlich. Vielmehr sahen sie wie Bissspuren aus. Sie beugte sich tiefer hinunter und betrachtete die Wunden eingehender. Obermeier konnte recht haben, auch wenn sie das ungern zugab. Sie spürte, wie er hinter ihr stand und jede ihrer Bewegungen verfolgte.
Das hier war kein normaler Wildunfall. Sie musste sich das Reh später im Hellen genauer ansehen. Trotz ihrer warmen Jacke fröstelte sie.
Julia richtete sich auf, sah sich aufmerksam um und lauschte in die Dunkelheit. Der Nebel schien noch dichter zu werden und aus den Büschen auf die Straße zu kriechen. Es war geradezu unnatürlich still, als hielte der Wald den Atem an und beobachtete sie aus tausend stummen Augen. Kein Rascheln im Unterholz, kein Wind, der durch die Blätter strich. Die Straße lag still und grau da, der Himmel war schwarz, und der dichte Nebel ließ keinen Strahl Mondlicht durch. Julia befiel der unwiderstehliche Drang, ebenfalls jedes Geräusch zu vermeiden. Sich unsichtbar zu machen für die lauernde Gefahr, die ihr Körper mit rauschendem Adrenalin in ihrer Blutbahn anzeigte. Obermeier stand genauso still wie sie, fast wie zur Salzsäule erstarrt.
Sie kämpfte mit ihrer Erstarrung, dann endlich setzte die Vernunft ein. Was in aller Welt sollte ihr nachts auf der Staatsstraße im Wald passieren? Die größte Gefahr war doch wohl, von einem Auto überfahren zu werden, wenn sie nicht bald machten, dass sie hier wegkamen. Julia atmete tief durch, schüttelte die kribbelnden Arme und drehte sich um. Sie würde jetzt Obermeier nach Hause bringen. Es gab keinen Grund, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen.
Ein Rascheln im Gebüsch neben ihr riss Julia aus ihren Gedanken. Sie fuhr zusammen und merkte, wie sich die Härchen in ihrem Nacken aufstellten. Hastig wich sie einige Schritte zurück, den Blick starr in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Was war das? Ein Tier? Sie strauchelte und wäre beinahe über das Reh gestolpert. Mit einem kleinen Aufschrei fing sie sich gerade noch ab, doch als sie aufsah, war alles wieder still. Nur das Pochen des Blutes in ihren Ohren sagte ihr, dass sie nicht geträumt hatte. Sosehr sie auch ihre Augen anstrengte, sie konnte außer dem Nebel und den Umrissen der Bäume und Büsche nichts erkennen.
Eilig zerrte Julia das Reh zum Landrover, hievte es in den Kofferraum und bat Obermeier um seinen Autoschlüssel. Mit einer strengen Handbewegung bedeutete sie ihm, in den Landy zu steigen, und parkte seinen Opel auf dem Grasstreifen neben der Forststraße. Dann stieg sie eilig in ihren eigenen Wagen und startete den Motor.
Zwei
Die Kirchturmuhr schlug acht, als Julia mit ihrer Großmutter in der kleinen Küche des Forsthauses beim Frühstück saß.
Das Haus gehörte zu ihrer Arbeitsstelle im Grafenrieder Forst. Schon als ihr Vater hier der Förster gewesen war, hatte ihre Familie hier gewohnt. Doch als sie erst vier Jahre alt gewesen war, waren ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben, und sie war zu ihrer Großmutter nach Mühldorf gezogen. Julias Vorgänger hatte es im Gegensatz zu ihr vorgezogen, in einer großen modernen Wohnung im Nachbarort zu wohnen, und das hübsche Häuschen mit den grün lackierten Fensterläden hatte lange Zeit leer gestanden. Seit Julia mit ihrem sechsjährigen Sohn Florian und ihrer Großmutter Martha vor gut einem Jahr eingezogen war, hatte sie damit begonnen, das Forsthaus zu renovieren, doch die Fenster warteten immer noch auf einen neuen Anstrich, und auch der Boiler sorgte nicht immer für warmes Wasser im Badezimmer.
Die Küche war Julias und Omas Refugium. Der Boden war mit hellen Dielen ausgelegt, die sie regelmäßig schrubbten, und die Küchenschränke aus hellem Holz waren einfach, aber praktikabel wie die übrige Ausstattung. Den größten Raum nahm eine gemütliche Eckbank mit einem großen Holztisch und ein paar Stühlen ein. Die Sitzgruppe gehörte zum Haus und war schon da gewesen, als Julia noch klein gewesen war. Sie hatte die Möbelstücke gleich wiedererkannt, als sie ihren zukünftigen Arbeitsplatz besichtigt hatte.
Draußen vertrieben Sonnenstrahlen den Nebel und fielen fröhlich und warm zum Küchenfenster herein, als wollten sie die Schwärze der Nacht aus Julias Gedanken fortjagen. Doch das seltsame Erlebnis auf der Straße im Wald hatte sich in ihrem Kopf eingebrannt und bereitete Julia stechende Kopfschmerzen. Dass die Heizung im Bad heute Morgen mal wieder streikte und sie nur kalt hatte duschen können, trug erst recht zu ihrer schlechten Laune bei. Sie goss erst Martha und dann sich selbst Kaffee ein und nahm sich eine Scheibe Brot aus dem Körbchen. Koffein und etwas zu essen, das war jetzt genau das richtige Heilmittel. Wenn es ihr nach dem Frühstück nicht besser ging, konnte sie immer noch eine Kopfschmerztablette nehmen.
Über dem Kühlschrank tickte laut die Küchenuhr, doch Julia war zu müde, um gegen die Stille Konversation zu machen. Außerdem war Oma in der Früh auch meist froh, ihre Ruhe zu haben. Besonders wenn sie wie heute den Morgen ohne den quirligen Florian genießen konnten, der den Feiertag bei seinem Vater, Julias Exmann Markus, verbrachte.
Noch in der Nacht hatte Julia das Reh aus dem Auto in die Wildkammer im Keller geschleppt, zu mehr war sie nicht mehr fähig gewesen. Nun wartete das tote Tier in dem weiß gekachelten Raum darauf, näher von ihr untersucht zu werden, und das wollte sie so schnell wie möglich tun. Denn sie kannte Obermeier. Er würde aus der Begegnung in der Nacht eine Märchenstory spinnen, garniert mit einer gehörigen Portion Jägerlatein. Für ein bisschen Aufmerksamkeit seiner Jagdkumpane gab er stets alles. Am besten wäre es wohl, wenn sich die Sache als Wildunfall herausstellte und sie das Reh in den Abschussplan eintragen konnte. Auch wenn Obermeier behauptete, er habe das Tier nicht angefahren. Doch bevor er die Leute mit Schauergeschichten erschreckte, musste sie herausfinden, was wirklich geschehen war. Gleich nach dem Frühstück, wenn Martha in die Kirche gegangen und sie allein im Haus war, würde sie das Reh untersuchen.
Julia nahm einen großen Schluck Kaffee und verbrühte sich daran die Zunge. Mit einem leisen Fluch und einem viel zu lauten Klirren stellte sie die Tasse zurück auf den Unterteller. Sie fing einen strafenden Blick von Martha auf und nahm sich vor, sich ab sofort besser zu benehmen. Lächelnd murmelte sie eine Entschuldigung und bestrich ihr Brot mit selbst gemachter Johannisbeermarmelade.
Das Klingeln des Telefons im Büro nebenan beendete die Stille abrupt.
Julia warf erneut einen Blick auf die Uhr und stand auf. Kurz nach acht. Florian war bestimmt schon wach. Markus hatte darauf bestanden, dass Flo den Vatertag bei ihm in Freising verbrachte, obwohl am nächsten Tag Schule war. Wahrscheinlich war ihrem Kleinen langweilig, weil Markus an freien Tagen gern ausschlief. Sie eilte ins Büro und suchte das Mobilteil auf dem Schreibtisch. Nach ein paar Sekunden fand sie es zwischen zwei Papierstapeln und drückte die grüne Taste.
»Hallo, mein Schatz!«, rief sie fröhlich.
»Frau Sommer?«, schallte ihr eine unbekannte Stimme entgegen. »Hier spricht Dirk Berger.«
»Äh, Entschuldigung. Ich hatte jemand anderen erwartet. Was kann ich für Sie tun, Herr, äh, Berger?«, stammelte Julia verlegen.
»Ich arbeite für den Ebersberger Anzeiger und habe einige Fragen an Sie. Sie sind doch Försterin im Ebersberger Forst, oder?«
Julia wurde hellhörig, und ihr Kopfschmerz verstärkte sich. Sie kannte den Lokalreporter. Er berichtete immer, wenn es einen Unfall im Forst gegeben hatte. Ein unangenehmer kleiner Mann. Was wollte er von ihr? Diese Zeitungstypen verdrehten einem doch nur zu leicht das Wort im Mund, und ihr fielen die passenden Antworten oft erst ein, wenn Gespräche längst beendet waren.
Dirk Berger gab ihr keine Gelegenheit zu antworten. »Haben Sie den Wolf schon gesehen?«
Welchen Wolf? Für einen Moment war Julia sprachlos. War er nach Obermeier der nächste Jägerlateinerzähler? Mit sicherem Zeitungsleserpublikum? Nicht mit ihr. »Ich wüsste nicht, was Sie das anginge.« Sie rieb sich über die Stirn. Dieser Tag hätte wirklich nicht schlimmer anfangen können. Das lag bestimmt am Föhnwind. Neben Sonnenschein brachte er auch Kopfschmerzen und schlechte Laune. Und offenbar auch Reporter auf komische Ideen.
»Ach, kommen Sie, Sie haben bestimmt die Gerüchte gehört.«
»Welche Gerüchte denn?«, fragte Julia langsam. Meist war sie im Dorf die Letzte, die etwas erfuhr. Wenn Oma nicht wäre, bekäme sie wahrscheinlich gar nichts davon mit, was im Dorf getratscht wurde.
»Es soll ein Wolf gesehen worden sein«, erklärte Berger mit ruhiger Stimme.
»Gibt es dafür Beweise? Fotos?«
»Bisher wohl nicht. Ich bin auf der Suche danach, Frau Sommer. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ein Wolf praktisch vor unser aller Haustüren im Wald herumstreift?«
»Herr Berger, ich weiß wirklich nicht, warum Sie gerade mich anrufen. Der Ebersberger Forst ist ein riesiges Waldgebiet mit vier großen Forstrevieren. Hier gibt es Tiere in Hülle und Fülle. Natürlich könnte es sein …« Weiter kam Julia nicht, denn Dirk Berger fiel ihr erneut ins Wort.
»Sie bestätigen also die Sichtung?« Die Stimme des Reporters hatte einen lauernden Unterton angenommen.
»Das habe ich nicht gesagt«, protestierte Julia.
Berger ging nicht auf ihren Einwand ein. »Ich habe hier einen Augenzeugen, der behauptet, er hätte einen Wolf im Wald gesehen.«
»Dann fragen Sie doch Ihren Augenzeugen!« Julia hatte so langsam genug.
»Der ist kein Experte, Frau Sommer«, beharrte der Reporter. »Ich frage Sie mal andersherum: Können Sie ausschließen, dass sich ein Wolf im Forst herumtreibt?«
»Können Sie ausschließen, dass sich in Ihrer Küche Mäuse herumtreiben?«, entgegnete Julia.
»Also nein.«
Julia fühlte, wie ihre Wangen vor Wut rot wurden. Sie öffnete den Mund, um den Zeitungsfritzen zurechtzuweisen. Da klickte es in der Leitung. Berger hatte aufgelegt. Verärgert starrte sie den Telefonhörer an.
Nach dem Anruf holte Julia sich noch eine Tasse Kaffee aus der Küche und ließ sich dann auf ihren Schreibtischstuhl fallen. Einen Moment lang lehnte sie sich zurück und schloss die Augen.
Die Kopfschmerzen waren immer noch da. Rechts oberhalb ihrer Stirn. Sie kreiste die verspannten Schultern, aber die Bewegung brachte keine Erleichterung. Ein Wetterwechsel würde vielleicht helfen oder eine heiße Dusche. Sie nahm einen Schluck Kaffee. Mittlerweile war er nur noch lauwarm, aber immerhin belebte er sie etwas und milderte den Kopfschmerz ein wenig. Vielleicht sollte sie sich eine Thermoskanne Tee aufbrühen und endlich eine Tablette nehmen? Nein. Für eine gemütliche Teestunde war keine Zeit. Es gab heute viel zu tun, und der Kopf schwirrte ihr noch von dem seltsamen Telefonat. Missmutig kritzelte sie als To-do »Heizung reparieren!« auf ein gelbes Post-it und klebte den Zettel an den Monitor. Dann schob sie ein paar Seiten Papier von der Tastatur, suchte nach der Maus und startete den Computer.
Wie immer dauerte es quälend lange, bis der Rechner hochgefahren war. Es würden einige Minuten vergehen, bevor sie die Seite des Landesamts für Umwelt aufrufen konnte. Da würde sie die Informationen finden, die sie suchte. Unschlüssig blickte Julia sich in ihrem Arbeitszimmer um. Es war klein und vollgestopft und eigentlich nicht besonders gemütlich. Rechts des überfüllten Schreibtisches befand sich eine Regalwand mit Julias Fachbüchern und den lästigen Aktenordnern, die auf Fütterung warteten. Links an der Wand hing die große Karte vom Forst, und daneben, hinter der Tür versteckt, stand der schmale Stahlschrank, in dem Julia ihre Waffen aufbewahrte. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl zum Regal und fuhr mit dem Finger über die Rücken der dort stehenden Bücher, bis sie das orangefarbene Zoologiebuch »Forstschutz gegen Tiere« fand. Sie blätterte gerade darin, als Martha hereinkam.
Ihre Großmutter trat neben sie und senkte neugierig den Kopf, um einen Blick in das Buch zu erhaschen. »Wer war das denn am Telefon?«
Julia zuckte mit den Schultern. Ihre Bereitschaft zu reden war durch das Telefonat mit Berger nicht gerade größer geworden, aber sie hatte sich doch gerade vorgenommen, Oma nicht unter ihrer mäßigen Laune leiden zu lassen. Sie versuchte, ein freundliches Gesicht zu machen. »Ach, nur so ein nerviger Reporter.«
Martha sagte darauf nichts und sah sie von der Seite an. Sie kannte sie eben zu gut.
Seufzend drehte sich Julia zurück zum Schreibtisch. »Er sagt, es sei ein Wolf gesehen worden. Aber ich glaube das nicht so recht. Wahrscheinlich hat ihm Obermeier, der alte Märchenonkel, einen Bären aufgebunden. Oder vielmehr einen Wolf.« So ungefähr entsprach das schon der Wahrheit, auch wenn sie Omas forschenden Blick in ihrem Rücken spürte.
Martha gab sich zum Glück damit zufrieden und legte Julia eine Hand auf die Schulter. »Nimm eine Tablette gegen die Kopfschmerzen. Du siehst elend aus. Ich mache mich jetzt fertig und gehe zum Gottesdienst.«
Noch einen kleinen Moment spürte Julia auf ihrer Schulter die wohltuende Wärme, die von der Hand der alten Dame ausstrahlte. Dann verließ Martha den Raum, und Julia blätterte weiter in dem Fachbuch.
Darin gab es kein Kapitel über Wölfe, was Julia nicht verwunderte. Schließlich richteten Wölfe ja keinen Schaden im Wald an. Es müsste aber ein Kapitel über Menschen geben, dachte Julia, denn die schadeten dem Wald sehr wohl. Sie stellte das Buch zurück ins Regal und wandte sich dem Computer zu. Doch bevor sie die Website aufrufen konnte, klingelte erneut das Telefon.
»Sommer«, meldete sich Julia weitaus weniger euphorisch als vorhin.
»Landratsamt Ebersberg. Mein Name ist Dr. Straßmeier. Grüß Sie, Frau Sommer. Ich rufe an, weil uns da einige Gerüchte zu Ohren gekommen sind.«
Julia zögerte. Erst der Reporter und jetzt ein Mitarbeiter des Landratsamtes? Was wollte der? »Hallo. Ich … Wie kann ich Ihnen helfen? Um was geht es denn?«, fragte sie dann.
»Wir haben den Anruf eines besorgten Bürgers bekommen. Ein Wolf soll im Ebersberger Forst gesehen worden sein. Genauer gesagt im Grafenrieder Forst«, erklärte Straßmeier.
Der Anrufer war heute Morgen schon der Zweite, der von einem Wolf sprach. Das Bild des toten Rehs, das sie letzte Nacht auf der Staatsstraße vorgefunden hatte, schoss ihr durch den Kopf. Konnte ein Wolf es gerissen haben?
»Hallo, Frau Sommer? Sind Sie noch dran?« Dr. Straßmeiers Stimme klang etwas ungeduldig.
»Jaja, natürlich. Ich bin nur sehr überrascht. Wie sollte denn ein Wolf so plötzlich aus dem Nichts bei uns auftauchen?«
»Hören Sie, Frau Sommer, das ist wichtig. Ich merke, dass ich Sie überfallen habe. Das tut mir leid. Es geht uns hier um die öffentliche Sicherheit. Falls sich ein Wolf in Ihrem Teil des Forsts ansiedelt, wäre es wichtig, dass Sie mich unverzüglich informieren.«
»Also, Herr …« Julia zögerte.
»Straßmeier. Dr. Straßmeier.«
»Herr Dr. Straßmeier, wie Sie sicher wissen, bin ich als Försterin in einem Privatwald angestellt. Ich müsste da natürlich erst Rücksprache mit meinem Chef halten, bevor ich Ihnen irgendwelche Zusagen machen kann.«
Straßmeier schwieg einen Moment. Dann sagte er: »Natürlich. Meinen Unterlagen zufolge ist Herr Thomas Voss der Waldbesitzer. Ich konnte ihn aber unter der Nummer, die uns vorliegt, nicht erreichen. Außerdem ist Herr Voss ja noch recht jung. Ist es nicht so, dass Sie die Fachfrau für Ihren Zuständigkeitsbereich sind und Herr Voss kein Förster ist? Und wissen Sie, als Frau haben Sie doch auch ein besseres Gespür für gesellschaftliche Erfordernisse. Sehen Sie, wir müssen da ein bisschen Informationsmanagement betreiben. Die Anwesenheit eines Wolfes wäre eine Sensation. Und denken Sie an die Bevölkerung. Wäre Ihnen selbst wohl, wenn ein großes Raubtier in unserem schönen Ebersberger Forst umherstreift?«
Sie als Frau? Julia schluckte. »Ich …«, setzte sie an.
Aber der Beamte redete einfach weiter: »Haben Sie Kinder?«
»Ja, einen Sohn.« Julia war von der Frage so überrumpelt, dass sie automatisch antwortete. Sofort ärgerte sie sich darüber.
»Dann wäre Ihnen eine Begegnung Ihres Sohnes mit einem unkontrollierbaren Wildtier bestimmt nicht recht.«
Auch wenn es ihr widerstrebte, musste Julia dem zustimmen. Kinder – wie auch Erwachsene – sollten Abstand zu Wölfen halten. Vor ihrem inneren Auge tauchte das Bild eines Wolfes auf, der Florian auf Augenhöhe gegenüberstand, und erfüllte sie mit Angst. Sie versuchte, sich ihre Gefühle nicht anmerken zu lassen, und sagte laut: »Ich verstehe aber immer noch nicht, worauf Sie eigentlich hinauswollen, Herr Straßmeier.«
»Frau Sommer, mir geht es erst einmal darum, Informationen zu sammeln. Haben Sie in Ihrem Revier einen Wolf gesehen oder Spuren entdeckt, die auf die Anwesenheit eines Wolfes schließen lassen?«
»Nein«, antwortete Julia und überkreuzte vorsichtshalber Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand. Schließlich wusste sie noch nichts sicher. Erst wenn sie das Reh genauer untersucht hatte, konnte sie vielleicht von Spuren sprechen. Vielleicht auch von Unfallspuren. Dann erst konnte sie sicher sein, dass der Nachtschreck nicht nur ihrem Gehirn entsprungen war. Sie würde sich auf keinen Fall zu Spekulationen hinreißen lassen.
»Gut, mehr wollte ich im Moment nicht wissen.« Straßmeier hatte jetzt einen beschwichtigenden Tonfall angenommen.
»Herr Straßmeier …«
»Dr. Straßmeier.«
»Wenn ich tatsächlich Spuren von einem Wolf finden würde, wie gehe ich dann am besten vor? Hier hat heute Morgen schon ein Reporter vom Lokalblatt angerufen.«
»Um Gottes willen. Sollten Sie etwas entdecken, rufen Sie mich unverzüglich an. Und sprechen Sie mit niemandem darüber. Vor allem nicht mit Reportern.«
»Aber sollte ich nicht mit den Kollegen aus den benachbarten Revieren … So ein Wolf hält sich doch an keine Reviergrenzen.«
»Nein. Wenn Sie etwas Konkretes haben, eine Sichtung, ein Foto, Trittsiegel oder ein gerissenes Beutetier, rufen Sie mich an. Ich alarmiere das Landesamt für Umwelt und schicke Ihnen zwei Kollegen vom Netzwerk vorbei, die dann die Spuren auswerten. Haben Sie meine Nummer notiert?« Straßmeier wirkte nun ganz geschäftsmäßig.
»Was für ein Netzwerk denn?«, fragte Julia abwesend, während sie sich einen Stift und ein Blatt zum Mitschreiben schnappte.
»Das Netzwerk Große Beutegreifer. Das sind ausgebildete Experten. Die können erstens einen Verdacht bestätigen, und zweitens wissen die, wie man mit solchen Informationen vertraulich umgeht.«
Julia kritzelte eifrig mit und notierte sich auch Straßmeiers Nummer, die auf ihrem Display leuchtete. Das Netzwerk Große Beutegreifer war ihr natürlich bekannt. »Aber hat denn die Öffentlichkeit nicht ein Recht darauf zu erfahren, was hier los ist? Los wäre, wenn wirklich ein Wolf auftauchen würde?«
»Gerade in so einem Fall ist es notwendig, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit feinfühlig zu steuern. Das sollten Sie wirklich Experten überlassen.«
Experten aus dem Landratsamt? Hm. Es gab einen Grund, warum Julia im Privatwald und nicht für eine staatliche Behörde arbeitete. Mehr als einen.
Straßmeier schien ihr Zögern zu spüren. »Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass Panik in der Bevölkerung ausbricht. Dazu müssen wir an einem Strang ziehen, auch in Ihrem eigenen Interesse. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Zum Schutz der Menschen und zum Schutz des Wolfes. Ich denke, wir verstehen uns.«
Julia seufzte. »Gut.«
Straßmeier diktierte Julia noch seine Mobilfunknummer und beendete das Gespräch. Als sie aufgelegt hatte, löste sie die gekreuzten Finger ihrer linken Hand. Dann wählte sie eine gespeicherte Rufnummer und wartete.
Drei
»Was war denn nun so dringend? Und warum konntest du es mir nicht am Telefon erzählen?« Tom rieb sich das unrasierte Gesicht und gähnte herzhaft. Cora, die alte Jagdhündin, die er von seinem Vater geerbt hatte, tat es ihm gleich.
Die beiden sahen so niedlich aus, dass Julia grinsen musste. Sie bat die beiden herein und führte sie in die Küche.
Nachdem sie Tom angerufen hatte, waren nur zehn Minuten vergangen, bis er im Forsthaus angekommen war. Da waren sicher weder Kaffee noch Frühstück drin gewesen, höchstens ein paar Brocken Futter für Cora. Falls sich in seinem Junggesellenkühlschrank überhaupt etwas Essbares befand. Nach dem Tod seines Vaters im letzten Jahr hatte Tom den Wald geerbt. Er war erst siebenundzwanzig Jahre alt und verdiente sich einen bescheidenen Lebensunterhalt als Schriftsteller und Literaturkritiker. Das Vermögen, das ihm sein Vater vermacht hatte, hatte er nicht angerührt, soweit Julia wusste. Die Verwaltung und Bewirtschaftung des Waldes hatte er ganz in Julias Hände gelegt und bezahlte aus dem Gewinn ihr Gehalt, aber er lernte mit Hingabe alles, was Julia ihm über seinen Wald beibrachte. Bei der Frage, ob das Reh in der Wildkammer durch einen Autounfall oder aus einem anderen Grund verendet war, würde ihr Tom nicht viel weiterhelfen können. Aber er war klug und stellte meist die richtigen Fragen. Außerdem konnte er mit Menschen umgehen, hoffentlich auch mit Reportern und Beamten aus dem Landratsamt.
»Manche Sachen kann man eben nicht am Telefon besprechen. Außerdem bin ich gebeten worden, die Angelegenheit geheim zu halten.«
Tom starrte sie mit großen haselnussbraunen Augen an und kratzte sich am Kopf. »Hast du Kaffee?«
Julia bedeutete ihm, ihr zu folgen, und sie setzten sich an den Küchentisch. Cora machte es sich auf ihrem Stammplatz vor dem Schwedenofen gemütlich, der vor dem kleinen Sofa neben der Eckbank stand.
Während Julia den vom Frühstück übrig gebliebenen Kaffee aus der Kanne in eine Tasse goss, erzählte sie Tom von dem Wildunfall und fasste den Anruf des Reporters und den aus dem Landratsamt kurz zusammen.
»Ich gehe davon aus, dass du von meiner Verpflichtung zur Verschwiegenheit ausgenommen bist. Schließlich können sie ja wohl nicht von mir verlangen, meinen Chef zu hintergehen«, schloss sie.
»Ich glaube, die Herrschaften im Landratsamt haben schon erkannt, wer die wahre Chefin meines Waldes ist.« Tom grinste und zog sein Smartphone aus der Tasche. »Hm. Niemand hat versucht, mich anzurufen. Wahrscheinlich haben sie noch die alte Nummer von meinem Vater.« Er nahm einen Schluck Kaffee, verzog angeekelt das Gesicht und stellte die Tasse auf dem Esstisch ab.
»Ach, Mist, der ist kalt, oder? Tut mir leid. Ich mache dir nachher frischen. Komm, jetzt sehen wir uns erst mal das Reh an.« Julia zwinkerte ihm zu. Sie befahl der Hündin, an ihrem Platz zu bleiben, nahm Toms Hand und zog ihn auf die Füße und in den Flur. Dann schloss sie die Kellertür auf. Diese war immer abgeschlossen, damit Florian nicht unbeaufsichtigt ins Untergeschoss gehen konnte.
Doch kaum waren sie die ersten Stufen der Kellertreppe hinabgestiegen, hörten sie Martha draußen rufen. »Julia, Julia!«
»Mist«, murmelte Julia, »ich dachte, sie ist schon in der Kirche. Ich wollte mir gern mit dir das Reh in Ruhe ansehen, ohne sie.«
»Sie klingt aufgeregt«, gab Tom in besorgtem Ton zurück.
»Julia!«
Jetzt hörte Julia es auch. Die Stimme ihrer Großmutter klang tatsächlich aufgelöst und schwach. Sofort machte sie kehrt und rannte hoch in den Flur. Tom folgte ihr.
Martha stand an der offenen Haustür und hielt sich am Türrahmen fest. Ihre sonst so ordentlich hochtoupierten weißen Haare waren zerzaust, ihr Gesicht aschfahl. Sie keuchte und rang nach Luft, als wäre sie von der Kirche bis nach Hause gerannt. Alarmiert nahm Julia ihre Großmutter an der Hand, führte sie behutsam in die Küche und bugsierte sie auf einen Stuhl.
Martha atmete immer noch heftig, und Julia ließ ihre zarte Hand nicht los. »Um Himmels willen, Oma, was ist denn? Geht es dir nicht gut, soll ich den Arzt rufen?« Die Sorge um die alte Dame schnürte ihr die Kehle zu. Mit stolzen dreiundachtzig Jahren war Martha in einem Alter, in dem man immer damit rechnen musste, dass sie erkrankte oder sogar starb. Julia betete, dass der Tag, an dem dies geschähe, in weiter Ferne lag. Es war doch alles perfekt, wie es war.
Martha hob den Blick und schüttelte den Kopf. Behutsam nahm Julia ihr die Handtasche ab und kramte darin nach den Herztabletten. Martha presste die Hände auf die Brust, die sich immer noch sehr schnell hob und senkte. Mit besorgtem Blick ließ Tom Leitungswasser in ein Glas laufen und reichte es Julias Großmutter. Und auch Cora schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Sie trottete heran und legte ihren Kopf auf Marthas Oberschenkel.
»Grüß Sie, Frau Klein. Sie schauen ja gar nicht gut aus. Sollen wir nicht doch einen Arzt rufen?« Tom beugte sich zu Martha und tätschelte ihre Schulter.
Martha schüttelte nur den Kopf. Sie hatte Tränen in den Augen.
»Aber jetzt beruhigen Sie sich doch, Frau Klein.« Toms Stimme war ganz sanft.
Martha senkte den Kopf und stöhnte auf.
»Oma, was ist denn? Sag es uns doch«, drängte Julia besorgt.
Ihre Großmutter sah auf und von Julia zu Tom. Dann brachte sie mühsam hervor: »Die Leonie ist verschwunden.«
Frühjahr 1945
Schnell, schnell verstecken.
Die Sirene heulte wieder. Martha raffte den Rock zusammen und rannte über den Hof. Nur schnell das Haus erreichen, sonst würden die Bomberpiloten sie entdecken, die Richtung Bahnhof flogen. Den kleinen Flugplatz des Ortes hatten sie auch schon einmal bombardiert. Aber manchmal verloren sie vor ihrem eigentlichen Ziel eine der Bomben, und deswegen hatte der Bürgermeister die Anweisung gegeben, dass sich im Dorf und auch auf den Einödhöfen niemand im Freien aufhalten durfte, wenn die Sirene heulte.
Abrupt blieb sie stehen. O nein. Die dicke Bertha war wieder aus dem Hühnerstall entwischt und suchte vor dem Küchenfenster gackernd nach ein paar Körnern.
Martha lief auf Bertha zu, aber das Huhn stakste eilig davon. In der Ferne hörte sie das Dröhnen der Flugzeuge. Sie kamen. Sie musste sich beeilen. Schon oft hatte ihre Mutter ihr eingeschärft, dass es nicht reichte, bloß ins Haus zu rennen, sondern dass sie sich dort verstecken sollte, damit ihr nichts passierte. Aber der Bertha durfte auch nichts passieren! Die Vögel waren abgesehen von den beiden mageren Kühen ihr einziges Vieh und wertvoll, vor allem weil sie nur noch wenige Hühner besaßen.
Martha zwang sich, stillzustehen und ruhig zu atmen. Dann machte sie einen Satz auf Bertha zu und packte das Huhn mit beiden Händen. Jetzt hatte sie sie! Der Vogel wehrte sich und versuchte wegzuflattern, aber sie packte ihn mit der einen Hand fester, mit der anderen zog sie den Saum ihres Rockes hoch und verbarg das Huhn in dem Stoff. Jetzt schnell ins Haus. Die Mutter durfte sie nicht erwischen. Wenn sie sah, dass ihre Tochter bei Bombenalarm draußen herumlief, würde sie sie mit ein paar Stockhieben bestrafen. Da konnte auch der Vater nichts mehr ausrichten, wenn die Mutter einmal wütend war. Martha streckte eine Hand unter den Rocksaum und drückte dem Huhn den Schnabel zu, damit es still war. Dann schlich sie eilig ins Haus.
Drinnen lauschte sie angestrengt, konnte aber niemanden hören. Ihre Eltern mussten auf dem Feld sein. Hoffentlich fanden sie rechtzeitig einen Unterschlupf. Sie lief durch den Hausflur, drückte die Küchentür auf. Danke, lieber Gott, für das Glück! Niemand war hier.
Martha huschte durch den Raum und kroch unter die Eckbank, ganz hinten in die Ecke. Die dicke Bertha drückte sie fest an sich, so fest, dass sie den Herzschlag des Huhns spürte. Oder war es ihr eigenes Herz, das so schnell gegen ihre Brust hämmerte?
Das Dröhnen wurde lauter. Gleich würden die ersten Flugzeuge über den Hof hinwegrauschen. Sie durfte keine Angst haben, die übertrug sich nur auf das Huhn. Leise, leise, ruhig. Sie fing an, ein Lied zu summen. Da dadada dada daa. Bin i net a schöna Hoh?
Bertha beruhigte sich, und draußen wurde es still.
»Wie ist denn das Huhn da hereingekommen?«
Die ärgerliche Stimme ihrer Mutter ließ Martha aus dem Schlaf schrecken. Sie brauchte einen Moment, bis sie realisierte, dass sie immer noch versteckt unter der Küchenbank lag. Nur Berta hatte sich befreit und lief jetzt aufgeregt gackernd in der Küche herum.
»Jetzt reg dich doch nicht auf. Besser, es ist hier drin, als dass es draußen herumflattert und am Ende vom Fuchs geholt wird.«
Die Stimme ihres Vaters. Ihren Eltern war also nichts passiert. Martha war erleichtert.
»Warum ist es überhaupt schon wieder aus dem Hühnerstall heraus? Du hast doch gesagt, du hast ihn repariert?«
Martha drückte sich noch weiter in die Ecke unter der Holzbank. Ein Streit ihrer Eltern war nicht die beste Gelegenheit, um plötzlich aufzutauchen. Außerdem würde ihre Mutter dann bestimmt wissen wollen, warum sie nicht in der Schule war.
»Ich mach es schon noch«, brummte ihr Vater.
»Mach es lieber gleich. Und dann bring die Eier mit. Ich muss sie heute abgeben.«
»Wie viele musst du diese Woche abgeben?«
»Zwölf.« Die Stimme der Mutter klang bitter.
»Und wie viele haben wir?«
»Zwölf.«
»Und was sollen wir dann essen, wenn du alles hergibst? Diese verfluchten Nazis. Unsereins hungert.«
Wie auf Kommando knurrte Marthas Magen. Sie hielt die Luft an. Nicht entdeckt werden, bitte nicht entdeckt werden!
Doch ihre Mutter war zu sehr in Rage, um auf das Geräusch zu achten. »Lieber hungern, als sterben.«
»Wenn es so weitergeht, kannst du beides haben. Dabei sind die Nazibauern mit ihren fetten Wänsten und die Städter an allem schuld.«
»Sei endlich still! Mit deinen gefährlichen Reden stürzt du uns noch ins Unglück«, schimpfte Mutter.
»Ja, so weit ist es schon, dass man die Wahrheit nicht mehr sagen kann.«
Der bittere Ton des Vaters schmerzte Martha. Aber die Mutter gab nicht nach: »Willst du vielleicht ins Arbeitslager geschickt werden wie der Pfarrer?«
»Sprich nicht vom Pfarrer. Da packt mich gleich noch mehr die Wut auf das Pack. Er hat doch nur gesagt, dass es dem lieben Gott nicht recht ist, dass wir alles, was wir haben, abgeben müssen und …«
»Und wenn du nicht aufhörst, auch so zu reden«, fiel ihm Mutter ins Wort, »dann nehmen sie uns das Wenige, was wir haben, auch noch weg. Und dich gleich mit. Und dann steh ich da, allein mit deinen zwei Töchtern.«
»Das sähe ihnen ähnlich. Aber ich bin ja schon still. Für die Mädchen und für dich. Nicht, weil es mir recht ist«, gab der Vater nach. Dann packte er die Henne und verließ die Küche.
Weil ihre Mutter im Raum blieb, musste Martha noch länger in ihrem Versteck ausharren. Sie ballte die Hände zu Fäusten und wünschte sich innig, dass die Mutter die Küche bald verließe. Dann würde sie durch die Hintertür hinaushuschen und ihre kleine Schwester Marei auf dem Heimweg von der Schule abfangen. In ihrer Rocktasche fühlte sie den herzförmigen Stein und den Mantelknopf, den sie auf der Straße im Dorf gefunden hatte. Den Knopf wollte sie Marei schenken, damit sie nicht verriet, dass Martha heute nicht in der Schule gewesen war. Denn Marei liebte Knöpfe. In einer Blechschatulle, die Vater ihr gegeben hatte, bewahrte sie ihre Sammlung auf.
Den Stein würde sie behalten, für immer. Den hatte er ihr geschenkt, als sie sich heute Morgen getroffen hatten.
Vier
Julia kniete sich vor Martha hin und sah zu ihr hoch. »Was? Unsere Leonie?«
Die sechzehnjährige Schülerin mit dem dunkelblonden Pferdeschwanz passte gelegentlich auf Florian auf, wenn ihr umfangreiches Sportprogramm ihr die Zeit dazu ließ. Sie spielte mehrmals in der Woche Handball, joggte täglich und gab im ortsansässigen Sportverein Zumba- und Leichtathletikkurse für Kinder. Und die Schule war ihr natürlich auch wichtig. Leonies Eltern vielleicht mehr als ihr selbst, aber immerhin durfte sie sich dann und wann das Taschengeld als Babysitterin für Florian aufbessern, zum Beispiel wenn Julia Martha zum Arzt fahren musste.
Draußen heulte die Feuerwehrsirene los, und Julia zuckte zusammen.
»Wie? Verschwunden?«, fragte Tom besorgt nach. Er rückte einen Stuhl heran und setzte sich Martha gegenüber. »Erzählen Sie mal der Reihe nach.«
»Wir saßen in der Kirche, da ist Leonies Vater, der Herr Wenninger, hereingekommen. Er hat kurz mit dem Diakon gesprochen, dann hat er am Mikrofon gesagt, dass Leonie gestern Abend zum Joggen gegangen, aber nicht mehr heimgekommen ist. Leonies Eltern haben schon überall gesucht, ihre Freundinnen angerufen, aber das Mädel ist weg. Und dann hat er gesagt, dass alle zum Maibaum kommen und beim Suchen helfen sollen, wenn die Messe vorbei ist. Aber ich konnte nicht so lange warten und bin sofort nach Hause gerannt. Wir gehen doch hin, oder? Die Polizei ist auch alarmiert …« Martha verstummte und sah mit weit aufgerissenen Augen von Julia zu Tom.
»Natürlich helfen wir bei der Suche«, sagte Julia sofort. »Das Mädchen kann ja nicht weit weg sein. Vielleicht hatte sie Krach mit ihren Eltern und ist ausgerissen. Mehr ist bestimmt nicht passiert.«
Tom nickte mit gerunzelter Stirn, wirkte aber nicht überzeugt.
Martha nippte an ihrem Wasserglas. Sie sah noch immer schrecklich blass aus, und Julia streichelte ihr beruhigend über den Arm. »Aber du, Oma, solltest dich erst einmal erholen. Mir ist nicht wohl dabei, dich allein zu lassen. Nimm deine Medizin. So eine Aufregung ist gar nicht gut für dich.« Sie drückte eine Herztablette aus dem Blister und reichte sie Martha, die sie mit ein wenig Wasser schluckte.
Julia warf einen Blick auf die Küchenuhr. »Wann ist die Messe denn zu Ende?«
Martha folgte ihrem Blick. »Um Viertel nach zehn, glaube ich. Ich achte ja sonst nicht darauf, wenn ich drin sitze. Dann vergeht die Zeit ja schnell.« Sie atmete tief durch. »Jetzt geht es mir schon wieder besser. So ein Schreck. Ich bin halt eine alte Frau, die nicht mehr so schnell laufen kann.«
Mehr noch als die Tatsache, dass langsam wieder Farbe in Omas Gesicht zurückkehrte, beruhigte Julia, dass sie ihren gewohnten Spruch aufsagte. Sie sei eine alte Frau, damit kokettierte sie oft. Solange Martha so redete, wusste Julia, dass es ihr gutging.
»Wir werden Leonie schon finden. Sie kann ja nicht einfach verschwunden sein. Sicher ist sie nur bei einer Freundin oder einem Freund über Nacht geblieben und hat vergessen, Bescheid zu sagen. Schließlich ist heute Feiertag und keine Schule. Einfach weglaufen würde sie bestimmt nicht«, sagte Julia, stand auf und streckte die schmerzenden Beine.
Im Flur zog sie ihre knöchelhohen Wanderschuhe an, die sie immer im Wald trug. Dann ging sie ins Büro und steckte eine Karte ein, auf der Grafenried, der Ebersberger Forst und das Umland verzeichnet waren. Die Karte würde bei der Suche helfen, denn Julia wusste, dass Leonie meist im Wald joggte, aber immer in der Nähe des Waldrands blieb.





























