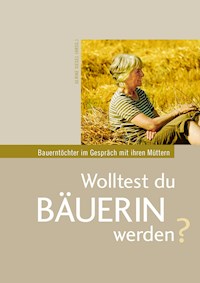
Wolltest du Bäuerin werden? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LV Buch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ulrike Siegels neues Buch gewährt durch die Ausgangssituation der Gespräche zwischen Müttern und Töchtern einen ungewohnt tiefen und persönlichen Einblick in das Leben der Frauen auf dem Land in der Kriegs- und Nachkriegszeit. So ist das Buch eine unterhaltsame Lektüre und zugleich ein wichtiges zeithistorisches Dokument.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolltest du Bäuerin werden?
Bauerntöchter im Gespräch mit ihren Müttern
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
„Alles für den Hof?“
Die Veröffentlichung der Bauerntöchter-Geschichten hat in vielen Bauernfamilien eine Auseinandersetzung über das Erleben der in den 60er Jahren geborenen Töchter angestoßen. Vor allem von den Müttern wurde immer wieder der Wunsch geäußert, auch ihre Generation mit ihrer Sicht auf diese Zeit, geprägt durch das Erleben der Kriegs- und Nachkriegsjahre in der Landwirtschaft, zu Wort kommen zu lassen.
Wie haben Frauen ihre Kindheit und Jugend auf den Bauernhöfen der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt? Was hat ihr Leben geprägt und wie blicken sie heute auf ihr Bäuerinnenleben zurück? Ein Leben für den Hof?
14 Bauerntöchter machen sich in dem vorliegenden Band mit diesen Fragen auf Spurensuche im Leben ihrer Mütter. Daraus entstanden Porträts von 14 Bäuerinnen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, die in den schwierigsten Zeiten Großes geleistet haben. 14 Kapitel deutscher Zeitgeschichte, die von Träumen und zerstörten Hoffnungen berichten. 14 Lebensbilder, die aber auch deutlich machen, mit welcher Kraft, mit welchem Engagement Frauen ihr Schicksal in die Hand nehmen.
Als Kriegskinder geboren, berichten sie über die Schrecken des Krieges: von den Nächten im Bombenkeller, von brennenden Städten, Angst, Verzweiflung, Kummer und Trauer. Drei der Frauen mussten die vertraute Heimat zurücklassen und in der Fremde neu anfangen. Sie alle hätten Grund gehabt, über ihre verpasste Kindheit und Jugend zu weinen. Aber sie haben es nicht getan.
Mit großer Tatkraft haben sie ihr Leben angepackt – erst auf den elterlichen Höfen, später auf den Höfen der Ehemänner. Haben sich meist den dortigen Gepflogenheiten untergeordnet und gearbeitet, im Haushalt, im Garten, im Stall und auf dem Feld. Nebenher die Kinder aufgezogen und oft sogar noch Alte und Kranke gepflegt. Ein Arbeitspensum, das sich schon die Tochtergeneration nicht mehr vorstellen kann.
Spannend ist der Rückblick der Frauen auf ihr Bäuerinnenleben. Übereinstimmend die Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude beim Blick zurück trotz oder vielleicht gerade wegen der durchlebten schweren Zeiten. Beeindruckend die innere Unabhängigkeit, die sich diese Frauen dabei bewahrt haben. Dies zeugt von menschlicher Größe, die hohen Respekt verdient.
Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Vor allem den Müttern, für ihren Mut und die Offenheit, mit der sie uns die Tür zur Vergangenheit geöffnet haben. Herzlichen Dank auch den Töchtern, die sich auf diese Gespräche eingelassen haben, und für ihre Bereitschaft und die Zeit, in der sie diese zu Papier gebracht haben.
Oktober 2008
Ulrike Siegel
Darum bin ich eine reiche Frau
Ida Haffert, geb. 1926 in Wadersloh/Nordrhein-Westfalen, wächst mit vier Geschwistern auf und heiratet mit 22 Jahren den Landwirt Antonius Haffert, der einen Hof in der Nachbarschaft bewirtschaftet. Nach dem frühen Tod ihres Mannes führt sie mit den acht Kindern den Betrieb weiter. Heute wird die Landwirtschaft von einem ihrer Söhne betrieben.
Tochter Ingeborg Haffert, geb. 1960, lebt in Aachen und ist Redakteurin beim ARD-Morgenmagazin. Ihre Geschichte „Von strammen Köpfen und dem schönsten Grabstein der Welt“ ist im Bauerntöchterband 2 veröffentlicht.
Meine Mutter ist heute 82 Jahre alt und eine „reiche Frau“: „Ich habe ein erfülltes Leben hinter mir“, sagt sie.
Aufgewachsen in einer Bauernfamilie mit fünf Kindern fährt sie mit Anfang zwanzig auf einem Flachwagen voller Aussteuer vom elterlichen Hof in ihr neues Leben. Von nun an ist sie Bäuerin auf dem nahe gelegenen Hof meines 17 Jahre älteren Vaters. Nachbarskinder werden Eheleute. Meine Eltern ziehen in den gemeinsamen Jahren acht Kinder groß und nicht selten sitzen beim Mittagessen 15 Personen an unserem Tisch: Die Eltern, die Kinder, die Oma, noch unverheiratete Geschwister meines Vaters, Knechte, Hausmädchen und ab und zu auch mal der Postbote. Es ist turbulent bei uns zu Hause, mit allem, was das Leben zu bieten hat: Ernteausfälle, Liebeskummer, Schulprobleme, Todesfälle, Hochzeiten, Geburten und auch revolutionäre technische Errungenschaften sorgen in unserer Familie für Aufregung: der erste Trecker, die erste Melkmaschine, der erste Selbstbinder, das erste Auto.
Mein Vater stirbt mit 67 Jahren an Krebs. Ein Schock für die Familie und eine Riesenaufgabe für meine Mutter. Sie muss die Familie und den 40-Hektar-Betrieb von nun an alleine managen. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das geschafft hat, und habe großen Respekt vor dieser Lebensleistung meiner Mutter.
Heute ist sie wohlverdiente Rentnerin, doch hin und wieder geschieht es, dass ihr wahres Alter und ihre innere Befindlichkeit nicht recht zueinanderkommen wollen. Bei einer gemeinsamen Radtour sagt sie kürzlich zu mir: „Wir fahren so weit, wie DU kommst.“ Und ich bin nicht unsportlich! Heute lebt sie mit meinem Bruder und seiner Familie auf dem Hof. Sie hat sich dort eine eigene kleine Wohnung eingerichtet und wünscht sich noch ein paar ruhige Jahre in vertrauter Umgebung. Ich spüre ein bisschen ihre Angst, auf der Bühne des Lebens nach hinten treten zu müssen. Ein ganzes Leben lang war sie aktiv, lebendig, selbstständig. Sie hat wichtige Entscheidungen getroffen, hat uns Kinder aufwachsen und aus dem Haus gehen sehen, hat viel gearbeitet und erreicht. Es ist nicht leicht, sich aus einem so vollen Leben zurückzuziehen. Den Blick ins eigene Innere zu wenden und dort Frieden mit sich und der Welt zu finden. Ich wünsche ihr von Herzen, dass ihr das gelingt. Es ist zehn Uhr morgens. Wir sitzen gemeinsam an dem Küchentisch, an dem ich schon als Kind gesessen habe. Auf der Eckbank, in der früher meine Schultasche verschwand. Ich hole das Aufnahmegerät, meine Mutter eine Flasche Doppelkorn. Wir trinken uns Mut an. Wenig später stecke ich ihr das kleine Mikrofon an den Blusenkragen. Tonprobe und los geht’s:
„Wenn du zurückblickst auf dein Leben, was hat dich am meisten geprägt?“
Mein Aufgabengebiet war immer die Familie und der Betrieb. Die haben mein Leben bestimmt. Das war so vorgegeben und du musstest zusehen, dass du zurechtkamst. Dass du dein Brot bezahlen konntest. Und dazu gehörte auf jeden Fall die tägliche große Aufmerksamkeit für den Betrieb und viel praktische Arbeit. Das stand immer im Vordergrund.
Am Anfang, als ich hier auf den Hof kam, hatten wir 18 Kühe. Die mussten DREIMAL am Tag MIT DER HAND gemolken werden. DREIMAL! Das gab es überhaupt nicht anders. Und als in der Nachbarschaft die ersten Melkmaschinen angeschafft wurden, da hieß es bei uns: So eine Melkmaschine, die kriegen wir NIE. Davon geht doch nur das Euter kaputt. Früher waren die Melkmaschinen auch nicht so wie heute. Und mittags, wenn der Milchwagen wiederkam, dann mussten die Magermilch und die Molke ins Schweinehaus getragen werden. Damit wurden die Schweine gefüttert. Die Kannen mussten gewaschen werden. Auch die Kälber wurden dreimal am Tag gefüttert. Auch sonntags. Und um Punkt zwölf Uhr wurde jeden Tag gegessen. Das war hier immer so. Aber diese Pünktlichkeit verlangte einem auch was ab. Die jüngsten Kinder wurden vorher versorgt und ins Bett gebracht. Wenn hier mittags die vielen Leute mit am Tisch saßen, die hatten nur eine Stunde Mittag, meinst du, die wollten sich dann hier das Theater bei Tisch anhören? Es wurde gegessen, dann die Zeitung gelesen, dann war noch eine halbe Stunde frei. Nur am Sonntag aßen alle Kinder mit am „großen Tisch“.
Die tägliche Arbeit nahm damals viel Zeit in Anspruch. Vor allem weil alles Handarbeit war. Die Runkeln wurden zum Beispiel mit der Hand durchgedreht und jedes Bund Stroh mit der Hand bis oben auf den Balken befördert.
„Du hast mal erzählt, dass es zu dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, keinerlei Müll auf eurem Hof gab.“
Das stimmt. Wir hatten keine Dosen, und Plastik gab es ja noch nicht. Früher konnte man deshalb auch keine Maissilage machen. Es gab gar keine Plane zum Abdecken. Die Runkeln wurden mit Stroh und Erde zugedeckt. Hattest du zu viel zugedeckt, dann erstickten sie und wurden faul. Hattest du zu wenig zugedeckt, dann erfroren sie. Im Krieg wurde auf meinem elterlichen Hof noch selber Butter gemacht. Die gab es nur auf Lebensmittelkarten, die sehr knapp waren. Dann wurde die Sahne unters Sofa gestellt, damit die immer etwas warm war und sauer wurde. Dann kam sie in eine Zehnliterkanne und wir Kinder mussten die Sahne mit einem Stampfer ständig bewegen. Manchmal eine Stunde lang. Bis die Sahne gerann. Damit sich die Butter von der Buttermilch absetzte. Da haben wir manches Mal ganz schön gestöhnt. Auch im Garten wurde alles mit der Hand gemacht. Und was du im Sommer nicht geerntet und eingemacht hattest, das gab es dann im Winter auch nicht zu essen. Es wurde NIE eine Dose Erbsen gekauft! Oder Runkeln hacken. Stundenlang. Auch wenn es noch so heiß draußen war. Da hat sich keiner beschwert. Es hat auch keiner gesagt, ich kann nicht mehr. Das hat es nie gegeben. Wir hatten ja noch keinen Trecker damals. Nur Pferdestärken. Darum waren immer so viele Leute auf den Höfen. Wir konnten das alleine gar nicht schaffen. Beim Runkeln vereinzeln, da sind wir auf Knien übers Feld gekrochen, immer rechts und links vereinzeln und hinterher taten uns die Knie so weh.
„Hast du diese ständige Arbeit nicht manchmal verflucht?“
Nein. Ich bin damit aufgewachsen und ich wusste, es geht nicht anders. Und ich freute mich, wenn wir was fertig hatten. Das war doch unser Erfolgserlebnis.
„Ab wann hast du als Kind auf dem Hof mitgearbeitet?“
Das fing so mit acht, neun Jahren an. Beim Waschen haben wir geholfen. Wir mussten ja früher die Waschmaschine mit der Hand drehen. Fünfmal rechts rum, fünfmal links rum. Lieber hätten wir natürlich gespielt. Steinhüpfen, Ballspielen oder Seilchen springen. Am Waschtag machten wir dann Feuer unter dem Topf. So ein Tag, den gab es nur alle fünf, sechs Wochen. Da wurde nur einmal pro Woche das Hemd gewechselt. Und bis dahin musste man irgendwie auskommen. Dann haben wir noch Kartoffeln aufgesucht, Holz geholt und Eier weggebracht. Wir mussten die mit dem Fahrrad in die Stadt bringen. Zehn Kilometer ein Weg. Die Eiertasche hatten wir auf dem Handgelenk und dann durch die ganzen Schlaglöcher, aus einem Loch raus ins nächste wieder rein. Wir hatten auch keine Fahrräder wie heute. Da wurde man nicht gefragt, kannst du das wohl oder ist dir das nicht zu schwer? Bestimmte Pflichten mussten einfach erledigt werden. Aber es gab auch keine Alternative, damals im Krieg. Die Eier mussten da hin, sonst kriegten wir nicht, was wir brauchten. Auch für meine Aussteuer nachher. Man musste immer etwas mitbringen. Und das waren damals bei uns an erster Stelle die Eier. Du musstest schon schmieren, sonst lief nichts.
„Was hast du sonst noch eingetauscht?“
Auch mal ein Stück Speck oder Wurst. In einem Uhrengeschäft saß immer so ein älterer Herr hinter der Ladentheke, der zog dann immer die Schublade raus und meinte: „Tja, die Hühner haben heute ja noch gar nicht gelegt.“ So war das mit den Tauschgeschäften. Als ich 1949 geheiratet habe, da konntest du nicht einfach in den Laden gehen und sagen, das hätte ich gern. Das gab es nicht. Es wurde alles regelrecht zusammengehamstert.
„Du erzählst gerade von deiner Hochzeit. Wie war die Rolle der Frauen damals?“
Früher wurde einfach viel von den Eltern bestimmt. Wir sind doch erst „ich“ geworden, als wir verheiratet waren. Das musste alles nach außen nach was aussehen. Und was nicht gut war, das trug man auch nicht nach draußen. Das gab man auch nicht zu. Ich hatte damals auch nie einen Pfennig Geld in der Tasche. Nie, bis ich geheiratet habe. Unsere Eltern sorgten dafür, dass wir alle bekamen, was wir brauchten. Aber eigenes Geld hatten wir nicht.
Ich war 21 Jahre alt, als mein Vater starb. Meine jüngste Schwester und ich waren nach der Ausbildung wieder zu Hause. Das war früher so. Die Mädchen auf dem Lande bekamen eine hauswirtschaftliche Ausbildung und dann musstest du warten, bis du weggeheiratet wurdest. Wenn du Pech hattest, dann war das eben nicht. Wir hatten ja keinen anderen Beruf. Und wenn du verheiratet warst, dann hast du nicht gesagt: Ich bleibe da nicht, ich trenne mich, ich löse die Ehe auf. Du konntest doch nirgendwo hin. Du hattest kein Geld, nur diese hauswirtschaftliche Ausbildung. Du hattest gar keine Chance, so eine Ehe zu beenden.
„Du hast gesagt, ihr hattet als Frauen nur die Ausbildung. Was hast du nach der Volkschule gemacht?“
1943 bin ich zur Landwirtschaftlichen Haushaltungsschule gegangen. Die Hauswirtschaftsschule ging ein halbes Jahr lang. Da bin ich morgens immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und von da mit dem Zug zur Schule. Damals im Krieg, da gab es SchaffnerINNEN. Die kann ich dir da heute noch hinmalen. So was gab es doch früher gar nicht. Aber jetzt waren die Männer alle im Krieg, da mussten das Frauen machen. Die hatten dann auch so ein Schiffchen auf. Das war eine ganz nette, unsere Schaffnerin. Wir mussten immer durch eine Sperre, da stand einer mit einer roten Mütze.
Zur Schule mussten wir unsere Hühner, die wir kochen wollten, immer mitnehmen. Wir haben da alles für den Haushalt gelernt: nähen, kochen, putzen, waschen, Ernährung, Gesundheitslehre, Deutsch, Rechnen. Und wir haben da jeden Tag gekocht, andere machten Gartenarbeit, wieder anderen bügelten. Wenn ich heute bügele, dann denke ich immer noch dran: Der Kopf der Wäsche liegt links. Und die Stosskante immer nach vorne, wenn man sie in den Schrank legt. Hausarbeit, das ist ja sehr, sehr vielseitig. Stärken, Silber putzen, Tisch decken. Das waren bestimmt zehn Fächer.
Morgens fing das an mit der Kochbesprechung, alle um den Tisch, und dann hieß es: Was kochen wir denn morgen? Und jeder wusste dann genau, was er mitzubringen hatte. Weil Krieg war. Dann hieß es: Du bringst morgen ein Huhn mit, du ein Kilo Kartoffeln usw. Und dann wurde dafür erst ein Huhn geschlachtet. Wenn wir den Pudding kalt gestellt haben, vorm Fenster, dann kamen manchmal die Jungs von der Landwirtschaftsschule, wenn die Pause hatten, und haben uns da eine Schüssel weggelotst.
„Jetzt musstest du ja dein Wissen noch praktisch unter Beweis stellen.“
Im Sommer kam ich aus der Haushaltungsschule und im Herbst bin ich dann auf den Lehrbetrieb gegangen. Ich weiß noch, ein Herr hat mich mit dem Kutschwagen an der Bahn abgeholt. Und dann waren da noch zwei Angestellte aus Polen auf dem Betrieb. Franz und Maria. Ein Ehepaar. Der Mann arbeitete mit den Pferden auf dem Hof und die Frau war im Haushalt. Die beiden spülten immer nach dem Mittagessen. Wir hatten so eine große Zinkwanne und die kam dann auf zwei Hocker und darin wurde gespült und wir trockneten dann ab.
„Warst du nicht das einzige Lehrmädchen?“
Nein. Außer mir war da noch eine andere Praktikantin. Und außer uns beiden Praktikantinnen war da noch eine Stütze. Die stand schon über uns und beaufsichtigte uns. Und dann kam die Chefin. Ihr Mann war Soldat. Die hatten auch einen Verwalter. Und das Ehepaar hatte zwei Kinder. Wir mussten das Haus putzen und dann hatten die einen ganz großen Garten. Die trockenen Bohnen haben wir ja nicht aus dem Laden geholt. Die haben wir im Sommer aufgezogen, aufgehängt, und wenn die trocken waren, haben wir die gedöppt. Damals habe ich 20 Mark verdient im Monat. Und die haben nicht mal für mich die Krankenkasse bezahlt. Da war ich siebzehn. Wir durften nie mit zum Einkaufen. Ich bin da nicht vom Hof gewesen. Das ganze Jahr nicht. Und das Kind, die Kleine, die war damals vielleicht so ein Dreivierteljahr alt, als ich kam. Die sollten wir dann nachmittags verwahren. Und wenn man mit dem Kinderwagen so 100 m vom Hof weg gefahren war, dann fing der Wald an. Weiter durfte ich nicht fahren. Man musste mich immer sehen können.
Und sonntags morgens spannte Franz, der Pole, an. Der Hof lag so einen Kilometer vom Dorf entfernt. Dann fuhr die Kutsche vor, wir stiegen alle ein und dann fuhren wir zur Kirche. Danach stiegen wir alle wieder ein und fuhren nach Hause. Das war unser Ausflug. Oben im Haus war damals keine Wasserleitung. Wir mussten jeden Liter Wasser die ausgetretene, enge Wendeltreppe hoch tragen. Morgens wollte ja die Chefin das Kind baden. Dazu brauchte sie zwei Eimer Wasser. Passend warm musste das oben ankommen. Dann schütteten wir ihr das in die Wanne, sie badete das Kind und nachher mussten wir das gebrauchte Wasser ins Plumsklo schütten. Wir kriegten die Zeit schon um ...
„Hast du damals nie das Gefühl gehabt, dass ein paar Dinge in dieser Welt nicht ganz gerecht zugehen?“
Ja, das Gefühl hatte ich. Stell dir mal vor, du wirst da als Landpomeränzchen mit dem Kutschwagen an der Bahn abgeholt und du weißt nicht, wo sie dich jetzt hinfahren. Mein Vater hat den Kotten nicht mal gesehen. Nur meine Mutter war einmal da. Als sie die Stelle für mich ausgesucht hat.
Wir mussten da auch jede Woche 13 Brote backen. Das war eine ganz schöne Arbeit. Den ganzen Teig kneten. Das Brot war ja für den ganzen Haushalt. Und was für mich damals das Verrückteste war: Wenn wir in der Küche alles ausgefegt hatten, dann haben wir Sand gestreut! Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Das war so weißer, trockener Sand. Und wir mussten jeden Tag die Tische scheuern. Jeden Tag!
Auf dem Lehrbetrieb kam auch der Nikolaus. Und dann hat die Chefin auch von jedem etwas gedichtet. Von mir zum Beispiel hat sie gedichtet:
„Immer munter, ein Lied auf den Lippen, steht Ida am Herd und brät Schweinerippen! Doch manchmal die Ida was vergisst: Tische scheuern, wofür das wohl nötig ist?! Doch sie wird es wieder besser machen, es gibt hier zu tun ja auch hunderterlei Sachen. Der Nikolaus drum nicht böse ist, aber Ida denk dran, dass du das nie mehr vergisst.“
Da kam auch noch drin vor: Wir werden nie den Salat verkehrt herum pflanzen, dann würde uns die Lehrfrau wohl sehr anranzen.
Ich habe dann am Schluss ein Zeugnis bekommen. Das habe ich auch noch:
„Fräulein Ida Schrage, geb. am 8.6.1926, war vom 1.4.1944 bis zum 7.4.1945 in dem von mir geführten landwirtschaftlichen Haushalt als Hauswirtschaftslehrling tätig.
Sie war sehr fleißig und strebsam und hat die ihr gestellten Aufgaben mit großem Verständnis, besonderem Geschick und seltener Frische durchgeführt. Mit ihren Leistungen war ich sehr zufrieden und muss darüber hinaus ihre Umsicht und Klugheit besonders loben. Ihr lebhaftes Interesse galt sowohl den Arbeiten in Küche und Haushalt als auch denen im Garten. Sie hat sich ein hohes Maß an theoretischen und praktischen Kenntnissen erworben, die sie trotz ihrer Jugend sicher zu verwerten weiß.
In der Hausgemeinschaft war mir Fräulein Ida Schrage ein besonders angenehmes Mitglied. Ihre Führung war sehr gut, immer frohen Mutes und hilfsbereit dabei bescheiden und sehr verträglich mit allen übrigen Hausbewohnern. Ich entlasse sie mit den besten Hoffnungen und Wünschen für die Zukunft.“
„Deine Eltern haben dich da einfach hingeschickt. Hast du dich nie aufgelehnt gegen solche Entscheidungen?“
Nein. Das gab es nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Wo sollte ich denn hin? Wir haben manchmal so untereinander geschimpft, aber das half ja nichts. Ich muss aber auch sagen, meine Eltern haben es sicher gut gemeint mit meiner Ausbildung,
„Waren deine Eltern streng?“
Nein. Wir haben zwar ab und zu mal einen in den Nacken gekriegt, aber geschlagen wurden wir nicht. Ich denke, geliebt haben uns die Eltern sicherlich. Nur, man wollte das nicht so zeigen, meine ich. Ich habe bei meiner Mutter sicher mal auf dem Schoß gesessen und mein Vater hat mit uns mal Hoppereiter gespielt. Aber so diese, tja, diese Zärtlichkeit, daran kann ich mich nicht so erinnern. Meine Mutter hat uns abends ins Bett gebracht und „Gute Nacht“ gesagt. Und „Schlaf gut“. Aber eins muss ich auch sagen: Man war ja früher als Familie nie allein auf so einem Hof. Nach dem Aufstehen morgens früh war man ja gleich eine Gemeinschaft. Keine Familiengemeinschaft, sondern eine Betriebsgemeinschaft. Wir hatten ja immer Angestellte auf dem Hof, die waren immer dabei. Vielleicht haben sie sich in der Mittagszeit mal auf ihr Schlafzimmer begeben. Aber abends, den Feierabend, den haben wir immer alle zusammen verbracht. Immer waren diese Menschen, die bei uns als Hilfe waren, in der Gemeinschaft dabei. Wir saßen dann alle in einem Zimmer, denn nur in einem Zimmer war es warm. Bei uns Mädchen war das so, wir legten abends nicht die Hände in den Schoß. Nur die Männer. Die brauchten abends nichts zu machen. Die konnten den Kopf in die Hand legen und einnicken. Aber als Frau musstest du dich immer beschäftigen. Sei es Strümpfe stopfen, nähen, Handarbeit.
„Waren die Beziehungen untereinander früher anders als heute?“
Ja, die Beziehungen waren anders und spielten sich fast immer über die Arbeit ab. Wenn eine Kuh kalbte und du sahst schon, das wird nicht einfach, dann kam nicht ein Nachbar, dann kamen gleich zwei oder drei, die mitgeholfen haben. Und es war selbstverständlich, sich gegenseitig zu helfen. Wenn wir früher Korn gedroschen haben, dann mussten wir Kinder durch die ganze Bauernschaft laufen und den Nachbarn sagen: Wir wollen am Donnerstag dreschen, könntet ihr uns helfen? Und wenn die anderen gedroschen haben, gingen wir dahin zum Helfen. Und wenn wir Runkeln vereinzelt haben, da haben wir immer mehrere Leute dabei gehabt. Das haben wir nie alleine gemacht. Alleine hätte man das alles nie geschafft. Ohne Nachbarschaftshilfe. Aber die gibt es ja heute gar nicht mehr.
„Hattest du eine glückliche Kindheit und Jugend?“
Eine gute. Wir wurden gut versorgt. Aber ich muss auch sagen, was wollte man auch Besonderes mit uns machen?! Ich nehme das meinen Eltern überhaupt nicht übel. Wenn zum Beispiel im Dorf Kirmes war, dann fuhren wir erst zur Kirche und nach dem Hochamt wurden die Karussells eröffnet. Während des Gottesdienstes war Ruhe im Dorf. Und dann bekamen wir fünfzig Pfennig. Schiffschaukel fahren und ein Eis, das kostete alles zehn Pfennig. Wir sind dann so lange Karussell gefahren, bis das Geld durch war und Schluss. Und dann hat meine Mutter eine Tüte Berliner mitgenommen. Die gab es dann nachmittags. Aber wir sind nie nachmittags noch mal vom Hof ins Dorf gefahren. Der Weg war weit. Wie wollten wir denn da hinkommen?! Natürlich waren wir auch manchmal sauer. Wenn man dann am nächsten Tag hörte, die waren noch auf der Kirmes und die auch. Aber wir hätten nie gesagt, warum dürfen wir da nicht hin?
„Wie hast du die ersten Jahre nach deiner Hochzeit in der neuen Familie erlebt?“
Außer uns Eheleuten wohnten auf dem Hof noch fünf Verwandte, drei junge Männer, die uns halfen, und ein Hausmädchen. Wir waren also schon ohne Kinder elf Personen. Und ich war auch von den anderen geachtet, obwohl ich noch so jung war. Schwierigkeiten gab es auch, aber die gibt es immer im Leben. Aber Tonius und ich wir haben immer zusammengehalten. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Das war mir das Wichtigste. Die Familie hier habe ich dann immer besser kennengelernt. Wir waren ja den ganzen Tag über zusammen. Es war einfach immer viel zu tun.
„Ich kann mich erinnern, dass der Sonntag euch beiden immer heilig war. Da seid ihr dann auch mal zusammen weggefahren.“
Ja, da sind wir erst zusammen in die Frühmesse gegangen und ich weiß, dass ich das immer sehr schön fand, wenn wir mal für uns allein waren. Da war ich immer ganz glücklich. Das waren wertvolle Momente für mich. Und wenn wir dann sonntags nachmittags einfach mal zusammen losgefahren sind für zwei, drei Stunden, das war immer etwas ganz Besonderes.
„Es gibt ein besonders trauriges Kapitel in deinem Leben: Vaters Krankheit und Tod. Wie hast du die Zeit nach seinem Tod erlebt?“
Ich war innerlich etwas darauf vorbereitet und wusste, was auf mich zukam. Und da habe ich einfach gedacht, ich verlasse mich auf meine große Familie. Ich habe immer Ansprechpartner, ich habe immer jemanden, der mir im Notfall hilft. Und auf den lieben Gott habe ich mich auch verlassen. Ich konnte ja nicht groß zweifeln. Es musste ja weitergehen. Ich habe mir damals gesagt: Ich bemühe mich, so gut es geht, um den Hof und um die Familie. Und wenn ich abends so zu Bett lag, dann dachte ich, wie war das denn nun heute? Und da war ich mit mir ganz zufrieden. Weil ich was leisten konnte. Ich war ja gesund. Und ich dachte, wenn wir das so weitermachen, dann kommen wir über die Runden. Ich wusste genau, wir konnten uns keinen Verwalter leisten. Wir mussten das alleine schaffen. Anfangs hatten wir ja noch die Kühe, und das konnte ich auch. So mit drei Melkmaschinen. Ihr habt ja auch alle mitgeholfen. Alleine hätte ich das nie geschafft. Aber das ging auf Dauer nicht mehr. Deshalb haben wir dann die Kühe abgeschafft und auf Bullenmast umgestellt. Dass ich mal verzweifelt war und gedacht hätte, jetzt geht es nicht weiter, daran kann ich mich nicht erinnern. Manchmal denke ich heute: Wie habe ich das bloß alles geschafft? Woher dann die Kraft und der Mut kommt, das kann ich nicht beschreiben. Ich habe irgendwie immer den Kopf oben behalten. Auch mit viel Tränen.
„Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du mal geweint hättest.“
Ja, damals meinte ich auch noch, das dürfte keiner sehen. Heute dürfte das jeder sehen.
„Wann war damals mal Zeit für dich zu trauern?“
Das war so eine Extrasache. Das wollte ich auch nur für mich machen. Ich war ganz lange traurig. Das war schon fast ein Jahr her, da sagten manche zu mir, wie lange willst du noch schwarz tragen? Aber ich konnte nichts Farbiges anziehen. Das stimmte so für mich. Das erste Farbige, das war so ein schwarz-weißes Kleid mit einem bisschen Gelb drin. Und dann ist es so ganz langsam gekommen. Auch Vaters Sachen habe ich lange aufbewahrt. Ich wollte mich immer wieder an ihn erinnern. Er sollte nicht einfach weg, sondern im Geiste immer noch da sein. Es waren viele schöne Erinnerungen mit ihm verbunden. Ich war viele, viele Jahre tief in meinem Inneren traurig.
„Deine Rolle als Frau hier auf dem Hof war ja für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich?“
Ich hatte gar keinen Platz dafür, mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe nur nach vorne geguckt. Eins nach dem anderen …
„Woher hattest du diese Kraft?“
Du, das ist mein Leben. Ich hab ja auch sonst nicht viel aufzuweisen. Ich hab ja nie irgendetwas hinterhergetrauert. Nach dem Motto, ich will hier mal weg oder ich will mal in Urlaub. Das ist ja bei mir nie hochgekommen. Erstens ging es nicht und zum Zweiten habe ich mich ja hier auch so ein bisschen verwirklicht. Wenn du am Kochtopf stehst, dann ist nach außen nichts sichtbar. Aber glaube mir, das ist auch eine Belohnung für deine Arbeit. Hausfrau und Mutter, das hatte ja früher eine ganz andere Bedeutung als heute. Da konnte man gut mit in der Reihe stehen. Es waren ganz andere Herausforderungen. Aber da kann man mal sehen: Wenn so ein Beruf einmal so abgesackt ist, der kommt so leicht nicht wieder zu Ehren, weil man vieles ja heute nicht mehr können muss. Man kann ja alles fertig kaufen.
„Hättest du auch gerne etwas anderes gelernt?“
Ich wäre gerne Lehrerin geworden. Lehrerin auf einer Landwirtschaftsschule. Gartenarbeit, Haushalt, Wäschepflege, all diese praktischen Dinge. Was wir so konnten. Was anderes hätte ich mir auch gar nicht zugetraut. Lehrerin, das war für mich immer etwas Besonderes. Damals sollte ich mal zur höheren Schule gehen. Aber wie hätten meine Eltern das hier in der Bauernschaft damals machen sollen? Ich hatte ja nicht mal ein gescheites Fahrrad, um zur Schule zu fahren. Es ist nie ein Wort drüber verloren worden. Ich kann nicht mal sagen, dieser Traum ist in mir wach geworden und ich musste den jetzt zudecken. So weit ist es gar nicht erst gekommen. Es ist einfach nichts draus geworden. Wenn ich heute an diesem Abzweig vorbeifahre, wo es zu dieser Schule geht, denke ich noch jedes Mal daran.
„War das für dich auch der Ansporn, uns Kinder so lange wie möglich zur Schule zu schicken?“
Ich wusste, wir können unsere acht Kinder nicht mit Geld ausstatten. Die müssen irgendwann selber ihr Geld verdienen. Die müssen selbstständig sein. Und wenn es damals dieses BAFöG [Bundesausbildungsförderungsgesetz] nicht gegeben hätte, wäre alles anders gelaufen. Da ist uns auch vieles zugutegekommen.
„Wenn du heute dein Leben noch einmal Revue passieren lässt, wie fühlt sich das für dich an?“
Wenn ich mir angucke, wie wir beide hier so miteinander über mein Leben reden, dann macht mich das stolz. Dass ich das so wert bin. Und dass du wohl denkst, meine Mutter hat ein interessantes und lebenswertes Leben gehabt. Und das ist für mich auch die Überschrift von dem Ganzen. Vor allem der Kontakt zu euch Kindern ist mir bis heute das Wichtigste. Da habe ich mich ja mein ganzes Leben lang dran aufgerappelt. Dass ich von euch Kindern so gestützt wurde. Dass das einfach funktioniert hat zwischen uns. Aber es hat auch nur funktioniert, weil jeder seine Meinung gesagt hat. Es wird mir ja auch von eurer Seite vieles gesagt, warum ich sicher heute flexibler und toleranter geworden bin. Das bin ich ja nicht von alleine geworden. Das ist ja durch euch Kinder gekommen. Und darum bin ich heute eine reiche Frau.
Ida Haffert mit Tochter Ingeborg
Ida als Schulkind
Melken
Runkelnhacken
Ein bewegtes Leben
Agnes Sester, geb. 1926 in Gengenbach-Reichenbach/Baden-Württemberg. Mit 28 Jahren heiratet sie Mathias Sester und zieht zu ihm auf seinen Schwarzwaldhof im gleichen Dorf. Nach dem frühen Tod ihres Mannes bewirtschaftet sie den Hof mit ihren vier Töchtern. Die Älteste übernimmt den Hof und Agnes lebt heute im Altenteil auf dem Hof.
Tochter Barbara Sester, geb. 1966, lebt mit Lebenspartner und Tochter in Freiburg und arbeitet als Redakteurin bei der Badischen Bauern Zeitung. Die Geschichte von ihr und ihren drei Schwestern, „Heimkommen oder Protokoll einer Begegnung unterm Nussbaum“, ist im Bauerntöchterband 2 zu lesen.
Im Juni ist der Bauerngarten vor dem Sesterhof besonders schön: Stockrosen, Taglilien, die Rosen wetteifern mit vollen Blüten und in den Beeten kann man den Bohnen beim Wachsen zusehen. So schön wie dieses Jahr ist mir der Garten noch nie vorgekommen. Ich helfe meiner Mutter an diesem Nachmittag, derweil mein Töchterchen Joséphine mit ihrer Kusine im Schwimmbad ist. „Oh, der Rittersporn liegt am Boden, der müsste hochgebunden werden. Hier hast du eine Schnur“, sagt Mutter. Sie kann sich nicht mehr so gut bücken; ihre rechte Hüfte ist nicht mehr die beweglichste. Danach säe ich noch vier Reihen Spinat, für den sie zuvor mit einer Setzschnur vier Reihen akkurat vermessen und mit einem Rechen gezogen hat. „Die Radieschen müssen auch weg, die kannst du noch rausmachen fürs Vesper“, sagt Mutter und stützt sich auf die Hacke.
„Jetzt bist du doch noch Gärtnerin geworden, Mutter?“
Ich habe ja immer einen Garten gehabt, nur habe ich nicht so viel Zeit gehabt, um besondere Blumen zu pflanzen und mich näher damit zu beschäftigen. Aber das stimmt. Wenn ich einen Beruf hätte aussuchen können, wäre ich gerne Gärtnerin geworden. Aber als ich jung war, wurden wir Mädchen nicht gefragt. Der Weg war eigentlich klar: Ein Mädchen musste kochen und nähen lernen, um später an der Seite vom Mann eine gute Hausfrau und Mutter zu sein. Bauernmädchen wurden meist Bäuerinnen oder sie standen in jungen Jahren im Dienst eines Stadthaushaltes, gingen in die Kochschule oder ins Kloster. Auch ich hatte keine Wahl, aber da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin gerne Bäuerin geworden, da habe ich ja von vielen Berufen etwas.
Der Garten begrüßt einen sozusagen, wenn man auf den Schwarzwaldhof in Gengenbach-Reichenbach kommt. Er liegt idyllisch von Wald und Wiesen umgeben in einem kleinen Tal. Streuobstbäume, Kühe, Pferde und Hühner. Das war schon zu Großvaters Zeiten so, der den Hof auf Leibrentenbasis gekauft hatte. Heute bilden die Milchkühe, ein kleiner Weinberg und drei Ferienwohnungen die Grundlage des Hofes, der von meiner ältesten Schwester Maria und ihrem Mann Ernst bewirtschaftet wird. Die Pferde sind heute das Hobby von Maria und ihren Töchtern Hanna, Laura und Britta.
„Am Anfang ist es dir doch schwer gefallen hierherzukommen, oder?“
So kann man das nicht sagen, aber du hättest sehen sollen, wie es hier ausgesehen hat, als ich auf den Hof kam. Alles war so alt, in der Küche war ein großes Loch, das mit Brettern abgedeckt war, dass man nicht in den Keller fiel. Außerdem kam mir der Hof hier in dem Tal so abgelegen vor im Vergleich zum vorderen Reichenbach, wo man jeden gesehen hat, der ins Tal kam. Aber heute würde ich niemals mehr tauschen wollen.
„Außer der exponierten Lage im Dorf, an was von deinem Elternhaus erinnerst du dich besonders gerne?“
Ich hatte eine wunderschöne, unbeschwerte Kindheit. Obwohl wir viel arbeiten mussten, erinnere ich mich zeitlebens gerne daran. Ich wuchs mit zwei älteren Brüdern, einer kleinen Schwester, Mutter, Großvater, Tante, Knechten und Mägden auf. Zusammen mit den Nachbars- und Taglöhnerkindern haben wir viele Streiche ausgeheckt. Mein Vater ist an einer Lungenentzündung gestorben, da war ich noch keine zwei Jahre alt. Mutter war mit Lioba schwanger. Sie wollte nicht mehr heiraten, obwohl viele junge Witwen in dieser Zeit wieder heirateten. Weil sie keinen Stiefvater wollte für uns Kinder, hat sie immer gesagt. Das war mir eigentlich auch recht. In der Schule erzählten die anderen immer, wie sie von ihren Vätern verdroschen wurden. Da war ich froh, keinen Vater zu haben.





























