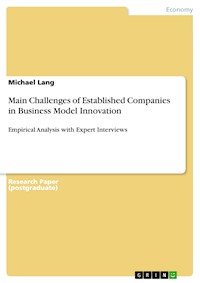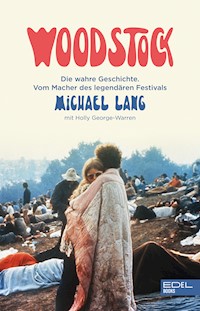
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das beste Buch zum größten Festival aller Zeiten. Jetzt endlich auf Deutsch. Woodstock 1969: ein Meilenstein der Musikgeschichte. Kein Buch beschreibt die einmalige Atmosphäre besser als dieser New-York-Times-Bestseller. Michael Lang, damals Organisator des Festivals, erweist sich als humorvoller, intelligenter Erzähler, der die Magie von Woodstock wunderbar einfängt. Sein Tatsachenbericht zeigt aber auch schonungslos die zum Teil bittere Realität hinter den Kulissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für meine Frau Tamara und meine Kinder LariAnn, Shala, Molly, Harry und Laszlo, die mein Leben mit Liebe erfüllen.
Und für meine Eltern, Harry und Sylvia.
Ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück mehr.
Diesen Punkt gilt es zu erreichen.
Kafka
Inhalt
Prolog
1.Brooklyn
2.The Grove
3.Woodstock, New York
4.Wallkill
5.New York City
6.Downtown
7.Yasgurs Farm
8.Bethel
9.13.–14. August 1969
Three Days of Peace and Music
10.15. August 1969
11.16. August 1969
12.17. August 1969
13.Nachwehen
Epilog
Danksagung
Die vollständigen Setlisten
Quellen
Prolog
Es ist 10 Uhr am Montag, 18. August 1969: Jimi Hendrix spielt vor vierzigtausend Zuschauern. Etwa eine halbe Million Menschen sind in der Nacht zuvor abgereist. Viele müssen arbeiten, andere sind zu ihren Familien zurückgekehrt, die sich wegen der widersprüchlichen Meldungen über das Chaos in Woodstock Sorgen gemacht haben. Während ich von der Bühne auf die Menge hinabschaue, sehe ich, wie immer mehr Menschen aufbrechen. Jimi registriert das auch und sagt: »Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Wir jammen hier bloß ein bisschen. Ihr könnt gehen oder klatschen.« Er blickt hinauf zu ein paar Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brechen – es sind die ersten seit geraumer Zeit. »Der Himmel steht uns noch bei, wie ihr seht«, murmelt er.
Wir, die wir ganz nahe bei der Bühne stehen, sind völlig gebannt von Jimi und seiner Band of Gypsys. Die Jungs haben die ganze Nacht durchgemacht, womöglich sind sie sogar noch viel länger wach – wie viele von uns, die seit Tagen kaum mehr als ein paar Stunden geschlafen haben. Trotz allem haftet Jimi, der deutlich Dreck unter seinen Nägeln hat, in seinem weißen Fransenhemd immer noch etwas Majestätisches an. Jerry Velez, der blutjunge Percussionist, bearbeitet schweißgebadet die Congas. Juma Sultan schwingt wie ein purpurner Derwisch die Maracas und seine Percussionschlegel. Und dann sind da noch Jimis alte Kumpel aus Armyzeiten: Gitarrist Larry Lee mit einem grünen Fransentuch um den Kopf, das seine Augen bedeckt, und Billy Cox, Jimis treuer Bassist, der einen bunten Turban trägt. Im Hintergrund immer in Bewegung der famose Experience-Drummer Mitch Mitchell.
Jimi entschuldigt sich, weil er zwischen zwei Songs seine Gitarre stimmt. »Nur Cowboys sind nie verstimmt«, sagt er lachend. In einem Augenblick scherzt er mit dem Publikum und ruft einem »Mädchen in gelben Unterhosen« hinterher, mit der er am Abend zuvor herumgeschäkert hat, in einem anderen dirigiert er die Band mit einem Blick oder einer Handbewegung und schließlich versinkt er in seinem Riff, taucht mit seiner Gitarre in ferne Sphären ab. Als er wieder auftaucht, konzentriert er sich ganz auf die relativ kleine, aber enthusiastische Menge vor ihm. Mitgefühl und Dankbarkeit schwingen mit, als er das Wort an uns richtet: »Ihr habt alle sagenhaft viel Ausdauer – drei Tage lang habt ihrs ausgehalten! Ihr habt der Welt gezeigt, was ein bisschen Liebe, Verständnis und Musik ausrichten können.«
Kurz darauf erleben wir etwas vollkommen Einzigartiges: Von »Voodoo Child« leitet er über zu »The Star-Spangled Banner«. Billy Cox und Larry Lee strecken sich, fast so, als stünden sie stramm. Ich bin, wie alle anderen, völlig gebannt davon, wie Jimi die Melodie aufbaut, wie er Rückkopplungen und Verzerrungen hinzufügt. Die Nationalhymne, das wird mir schlagartig klar, wird nie mehr dieselbe sein wie zuvor. Jimi hat sich in unsere kollektive Erfahrung eingeklinkt. All das emotionale Chaos und die Verwirrung, die wir als in den 1960er-Jahren aufgewachsene junge Amerikaner durchlebt haben, strömen in diesem Moment aus den Lautsprechern. Jimis Song versetzt uns auf ein Schlachtfeld, auf dem uns Raketen und Bomben um die Ohren fliegen, auf Demonstrationen und Friedensmärsche, bei denen sich die Polizei und wütende Bürger gegenüberstehen. Es ist eine eindrucksvolle Stellungnahme gegen den Krieg, gegen ethnische und soziale Ungerechtigkeit und ein Weckruf, der uns mahnt, die Risse zu kitten, die durch unsere Gesellschaft gehen.
Während ich Jimi zuhöre, wandern meine Gedanken zurück zu einem Abend in einem kleinen Nachtclub in Manhattan, in dem ich als 16-Jähriger aus Brooklyn John Coltrane Saxofon spielen sah. Auch er nahm mich mit auf eine musikalische Reise, und wie Hendrix war er eine Offenbarung.
Dieses ganze Unternehmen – das Festival und der Weg dorthin – war gekennzeichnet von Augenblicken wie diesen. Was getragen war von unerschütterlichem Optimismus und wahnwitzigen Ideen und sich anfühlte wie eine Abfolge etlicher Beinahecrashs und kleiner Siege, die nur durch das Zusammenwirken engagierter und nimmermüder Helfer errungen wurden, gipfelte in einem dreitätigen Festival, wie es die Welt zuvor noch nie gesehen hatte. Erinnerungsfetzen flackern auf. Ich sehe die schwangere Joan Baez im Regen stehen, wie sie einfach nur den Augenblick genießt. Ich sehe Jerry Garcia, der an der free stage rumhängt und sich mit ein paar Kids, die er nie zuvor gesehen hat, einen Joint teilt. Ich sehe die Blitze, die nachts über den Himmel zucken, und die Mitglieder der Hog-Farm-Kommune, die den Leuten vor der Hauptbühne, die ihre Plätze nicht verlassen wollen, Schalen mit Müsli reichen. Ich sehe, wie Crosby, Stills and Nash um halb vier Uhr morgens auf der Bühne stehen und »Suite: Judy Blue Eyes« spielen, den Song, der mich Monate zuvor von den Socken gehauen und davon überzeugt hatte, die damals noch unbekannte Band zu buchen. Ich sehe, wie Pete Townshend Abbie Hoffman mit seiner Gitarre eins überbrät und Sly Stone mit seiner Family die Menge zu einem mitreißenden call and response animiert, das niemanden unberührt lässt.
Unter denjenigen, die bis jetzt geblieben sind, sehe ich eine Menge müder Gesichter; es sind die Hardcorefans und diejenigen, die einfach nicht gehen wollen.
Ich gehe quer über die Bühne und nehme den Weg über die provisorisch errichtete Fußgängerbrücke in unser Trailerlager, wo ich ein paar Minuten für mich allein sein will, bevor ich mich mit den Folgen und Nachwirkungen dieses sagenhaften Wochenendes beschäftige. In den vergangenen vier Tagen habe ich insgesamt vielleicht sechs Stunden geschlafen, und so langsam spüre ich das auch.
Meine Partner John Roberts, Joel Rosenman und Artie Kornfeld sind bereits abgereist. Mir wird klar, dass ich Joel und John das ganze Wochenende über nicht gesehen und fast nichts von ihnen gehört habe, und ich frage mich, was sie von der ganzen Sache halten. Wie es Artie ergangen ist, weiß ich. Als ihm klar wurde, dass es keine Möglichkeit gab, die Menge davon abzuhalten, unsere Zäune zu überrennen, dass von den Zehntausenden, die zu unserer kleinen Party kamen, keiner für ein Ticket zahlen würde, wurde er kurz panisch. Doch er sammelte sich schnell wieder, und während er diverse LSD-Trips einwarf und den Künstlern, die er zur Bühne führte, die Erlaubnis, sie filmen zu lassen, abzuringen versuchte, hatte er die beste Zeit seines Lebens.
Wir alle hatten die beste Zeit unseres Lebens.
Für mich war Woodstock ein Test, bei dem es darum ging herauszufinden, ob die Menschen meiner Generation tatsächlich aneinander glaubten und an die Welt, die wir aufbauen wollten. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir Verantwortung übernahmen? Konnten wir das friedvolle Miteinander, das uns vorschwebte, tatsächlich verwirklichen? Ich war überzeugt davon, dass, wenn wir unseren Job richtig machten und mit dem Herzen dabei waren, wenn wir den Weg ebneten und den richtigen Ton trafen, alle sich mit ihrem höheren Selbst verbinden würden und etwas ganz und gar Unglaubliches schaffen konnten.
Woodstock wurde zu einem Symbol für unsere Solidarität. Das bedeutete mir am meisten – die gegenseitige Verbundenheit, die alle empfanden, die auf dem Festival arbeiteten, die dorthin kamen, um es mitzuerleben, und die auch Millionen von Menschen erreichte, die nicht dabei sein konnten, aber davon berührt wurden. An diesem einen Wochenende im August, zu einer Zeit, zu der es in unserem Land ziemlich hoch herging, zeigten wir uns von unserer besten Seite und schufen – wenn auch nur für kurze Zeit – genau die Art von Gesellschaft, nach der wir uns alle sehnten. Alles war richtig, die Zeit, der Ort, unsere Einstellung – wir waren richtig. Schlussendlich zelebrierten und bestätigten wir damit unsere Menschlichkeit. Es war meines Wissens eines der wenigen Ereignisse in der Geschichte, in der etwas durch und durch Freudvolles für Schlagzeilen sorgte.
Auf Max Yasgurs 600 Morgen Farmland gab jeder für sich seine Vorbehalte auf und alle wurden zu einer einzigen großen Familie. Zusammenzurücken, sich an der Musik und aneinander zu erfreuen und Teil einer so großen Menge zu sein, während ein Ungemach aufs nächste folgte – die vielen Staus, der ganze Regen –, war ein einschneidendes Erlebnis. Keine dieser Widrigkeiten konnte unsere Stimmung trüben. Tatsächlich rückten wir durch sie nur noch näher zusammen. Wir nahmen uns als das wahr, was wir im Kern tatsächlich sind: Brüder und Schwestern – und genau so nahmen wir einander an. Wir teilten alles, wir applaudierten jedem, wir überlebten gemeinsam.
Während Jimi sein Set beendet, verlasse ich meinen Trailer und schwinge mich auf mein Bike, um den Hügel hinaufzudüsen. Ich fahre eine BSA Victor, die beim Anlassen oft Zicken macht, aber heute Morgen springt der Motor gleich beim ersten Versuch an. Bei meinem Weg über das Areal, das sich mittlerweile in einen riesigen Sumpf verwandelt hat, steigt mir der strenge, üble Geruch der im Abbruch befindlichen »Stadt« in die Nase. Während ich den Hügel hinauffahre, sehe ich, wie die Crew Jimis Equipment abbaut und sich Hunderte von Menschen anschicken, den Müll von den völlig zertrampelten Feldern einzusammeln. Die Bühne, auf der eine total ausgelaugte Crew Kabel aufrollt und Instrumente verpackt, hebt sich eindrucksvoll von dem schlammigen Flickenteppich ab. Ein überdimensionales Leinentuch flattert darüber im Wind. Es sieht aus wie ein riesiges Segel, das sich von seinem Mast losgerissen hat, und erinnert mich an das Schiff aus Nimmerland. Es ist mit uns zu einem großen Abenteuer aufgebrochen und hat alle wieder sicher nach Hause gebracht. In der Ferne erkennt man den See, der uns als Haupttrinkwasserreservoir gedient hat; sein Wasserstand ist sichtbar gesunken. Noch weiter hinten, auf den Hügeln rund um das Gelände, sieht man Menschen, die von den Zeltplätzen strömen und sich auf den Heimweg machen. Die Erfrischungsstände hinter mir sind leer und verlassen. Sanitärwagen und Gülletransporter fahren über die inzwischen wieder passierbaren Straßen zum Festivalgelände hinab. Im Wald zu meiner Linken jenseits der Hurd Road entdeckt man allenthalben bunte Stoffreste und farbige Markierungen – Überbleibsel der vielen Marktstände, die hier aufgebaut worden waren.
Ich stelle den Motor ab und parke meine Maschine neben den Trümmern eines ehemaligen Gartenstuhls, in dessen Umkreis auch noch ein versiffter Schlafsack, eine kaputte Sandale und eine zerbeulte Feldflasche liegen. Das lange Wochenende, das hinter uns liegt, hat uns auf die Probe gestellt, doch wir haben den Test bestanden.
Der Weg, der uns hierherführte, war außergewöhnlich – gelegentlich sogar ein wenig magisch. Hunderte von Menschen begleiteten mich auf dieser Odyssee und arbeiteten unermüdlich selbst gegen die ärgsten Widrigkeiten an.
Ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergehen wird. Finanzielle Probleme sind absehbar und man wird sich um die angeschlagene Woodstock-Ventures-Gesellschaft kümmern müssen. Aber das Wichtigste ist, dass Woodstock überhaupt zustande gekommen ist.
Während ich hier oben vom Hügel aus hinabschaue, erinnere ich mich an den vergangenen Freitag, an den Moment, als Richie Havens, ein Kerl wie ein Baum, in einem orangefarbenen Dashiki die Bühne betrat. Er eröffnete das Festival, was schlicht und einfach daran lag, dass er und seine Band bereits da waren und als Erste loslegen konnten. Als wir über die Brücke zur Bühne gingen, verriet sein Blick großes Erstaunen und dann flackerte sogar ein wenig Angst in seinen Augen auf, angesichts der atemberaubend großen Menschenmasse, die sich über mehrere Kilometer vor der Bühne zu erstrecken schien.
»Wir fangen gerade an zu begreifen«, sagte ich.
Woodstock war eine Chance, ein Augenblick, ein Zuhause, etwas, worauf wir alle gewartet und hingearbeitet hatten. Als Richie zu singen begann und rhythmisch auf seine Akustikgitarre eindrosch, als wäre es eine talking drum, war ich mir zum ersten Mal richtig sicher, dass alles gut würde. Die Show lief, das Festival hatte begonnen. Es war der Moment, auf den alles ausgerichtet war, was wir in den vergangenen zehn Monaten getan hatten – und ich war überglücklich.
Plötzlich hält ein Pick-up hinter mir an und jemand reißt mich aus meinen Träumen. »Michael! Artie hat gerade angerufen. Sie brauchen dich an der Wall Street – und zwar pronto!«
Kapitel 1
Brooklyn
Ich sitze im dunklen, verqualmten Five-Spot-Club in der Bowery in Lower Manhattan und erlebe, wie John Coltrane mit seiner Musik die Grenzen auslotet – ohne Netz und doppelten Boden. Er wirkt, als sei er einfach gespannt zu sehen, wo ihn seine Musik hinführt, er lässt sie heraus und sein Saxofon folgt seiner inneren Stimme. Er sorgt sich nicht um das, was vor ihm liegt. Er weiß um die Gefahren, die damit einhergehen, aber auch, dass alles irgendwie gut werden wird und dass es unheimlich spannend ist, auf dieser Grenze zu balancieren. Genau dort wollte er sein. Für mich, den 16-jährigen Grünschnabel aus Brooklyn, war das ein völlig neues Konzept. Die Vorstellung, keine konkrete Form einhalten oder vorgegebenen Regeln folgen zu müssen, sondern zu improvisieren, einer inneren Inspiration zu folgen, leitete mich fortan.
Ich wuchs in den späten 1940er- und 1950er-Jahren in Bensonhurst inmitten zahlreicher jüdischer und italienischer Familien auf. Meine Eltern, Harry und Sylvia Lang, hatten osteuropäische Wurzeln, und wie viele andere Mittelschichtfamilien in diesem Viertel führten sie ein einfaches Leben. Mein Vater war Heizungsinstallateur und besaß ein eigenes Unternehmen, Lang Engineering. Um die Buchhaltung des Betriebs kümmerte sich meine Mutter. Nebenbei war mein Vater aber auch Erfinder. In jungen Jahren hatte er ein Ballastsystem für Marine-U-Boote und eine Schadstofffilteranlage für Kohlekraftwerke entwickelt. Ich vermute, dass er wohl ein wirklich spannendes Leben hätte führen können, wenn meine ältere Schwester Iris und ich nicht gewesen wären.
Mein Vater hat mich immer zur Selbstständigkeit erzogen. Sie war für ihn das Wichtigste. Sie musste man sich bewahren, komme was wolle. Schon früh zeigte er mir, wie man sich aus heiklen Situationen heil wieder herauslavieren kann. »Verantwortung übernehmen und weitermachen«, lautete sein Motto, sich nur so viel Abstand zu den Dingen zugestehen, dass man in der Lage ist, klare Gedanken fassen zu können, und den eigenen Instinkten vertrauen. Das war seine Strategie, mit der auch ich immer gut gefahren bin.
Neben der Firma investierten meine Eltern mit wechselndem Erfolg immer wieder in diverse Nebenprojekte. Das Coolste war ein lateinamerikanischer Nachtclub an der Upper West Street, das Spotlight. In den 1950er-Jahren war Mambo der letzte Schrei und Musiker aus Puerto Rico und Kuba lockten das Publikum in Scharen an. Der Spotlight-Club war nichts anderes als ein langer, dunkler Raum mit einer großen Bar an einer der Längswände. Im hinteren Bereich befand sich eine große Tanzfläche und am Ende der Bar gab es eine Empore für die Band. Tagsüber wirkte der Raum ziemlich trist, aber sobald es dunkel wurde, funkelte und glitzerte die Einrichtung um die Wette und alles sah richtig glamourös aus. Im Stockwerk darunter gab es einen großen Keller, der sich über die gesamte Tiefe des Clubs erstreckte. Der berühmte Kapellmeister Tito Puente, der auch unter dem Namen El Rey bekannt war und lateinamerikanische Musik als Vorläufer der heutigen Salsa berühmt machte, lagerte dort einige seiner Trommeln. Ich war elf oder zwölf und hatte gerade selbst mit dem Schlagzeugspielen begonnen, als ich El Rey im Spotlight-Club traf. Er sah wahnsinnig gut aus mit seinen tiefschwarzen Haaren und bestärkte mich darin, mit dem Schlagzeugspielen weiterzumachen. Er ließ mich sogar ein paar Takte auf seinem eigenen Kit spielen. »Oye Como Va« war damals eines seiner bekanntesten Stücke, das ein Jahrzehnt später, nachdem es Santana in Woodstock gespielt hatten, auch zu einem Hit für die Band wurde.
Der frühe Rock ’n’ Roll, der zu seinem Siegeszug ansetzte, als ich noch klein war, beeindruckte mich gewaltig. Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard und vor allem Bill Haley and the Comets’ »Rock Around the Clock« sowie der Film Die Saat der Gewalt, dessen Titelsong diese Nummer war, hatten es mir angetan. Damals gab es in unserem Viertel viele Musiker, die auf der Straße a capella sangen. Mit einem fantastischen Doo-Wop-Sänger, der im selben Block wohnte wie ich, spielte ich Stickball.
Ich war der Einzige in meiner Familie, der ein Instrument spielte, und mit zwölf schloss ich mich einer Rock-’n’-Roll-Band an – was hauptsächlich bedeutete, dass ich fortan mein Drumkit etliche Treppenabsätze rauf- und runterschleppen konnte, um an so angesagten Orten wie dem jüdischen Gemeindesaal am Bay Parkway auftreten zu dürfen. Trotz allem vermittelten mir diese Gigs eine Ahnung davon, welche Kraft von der alles verbindenden Musik ausgeht. Darüber hinaus spielte ich noch Schlagzeug im Musikkorps der Seth Low Junior High. Doch Umzüge und Uniformen waren nichts für mich. Als ich am St. Patrick’s Day zum ersten Mal mit dem Korps die Fifth Avenue entlangmarschierte, bog ich in null Komma nichts in die Sixtieth Street ab und damit hatte es sich für mich. Das war die erste und letzte Parade, an der ich teilnahm.
Jeden Sommer fuhr ich in ein Ferienlager ins Sullivan County, hundertfünfzig Kilometer nördlich von New York City in den Catskill Mountains. Ich war sehr gerne in der freien Natur, vor allem liebte ich das Reiten. In meinem letzten Jahr im Ferienlager, ich war damals elf, überredete ich einen ziemlich lustlosen Stallburschen dazu, mich an seiner Stelle die Pferde pflegen und Urlauber auf Ausritte begleiten zu lassen. Er vertraute mir ein prächtiges Paint Horse namens Bobby an. Ohne Sattel in vollem Galopp auf ihm durch die Gegend zu reiten, war für mich der Inbegriff der Freiheit. In diesem Sommer machte ich auch meine allererste sexuelle Erfahrung, in einer Scheune.
Im Winter fuhren wir mit der Familie immer mit dem Auto runter nach Miami, und im Herbst ging es Richtung Norden nach Kanada, wobei uns der Indian Summer mit den bunt verfärbten Laubwäldern immer wieder aufs Neue faszinierte. Meine Eltern liebten diese langen Autofahrten mit Iris und mir. Ich war vom Autofahren ebenso begeistert wie mein Vater, der mir schon zeigte, wie es geht, als ich erst zehn oder elf war. An dem Tag, an dem ich meinen Lernführerschein erhielt, dank dem ich begleitet fahren durfte, fuhr er mit mir nach Manhattan und ließ mich durch ein unglaubliches Verkehrschaos nach Brooklyn zurücknavigieren. Kurz nachdem ich die Prüfung bestanden und meinen richtigen Lappen hatte, kaufte ich mir ein Motorrad. Und mit diesem Bike war ich ziemlich waghalsig unterwegs. Ich legte mich auf den Sitz, um den Luftwiderstand so weit wie möglich zu verringern, und gab auf dem Belt Parkway ohne Rücksicht auf Verluste Gas. Nach ein paar Jahren hörte ich auf, auf der Straße zu fahren, weil mir klar wurde, dass ich sonst irgendwann draufgehen würde, doch der Kick, den ich von der Raserei bekam, war wie eine außerkörperliche Erfahrung. Es war ein Gefühl, das ich immer wieder nachzuerleben versuchte.
Es war nicht lange nach meinem vierzehnten Geburtstag, als mein Freund Irwin Schloss und ich zum ersten Mal Gras rauchten. Sein älterer Bruder Marty, der heute als radikaler Rabbi in Israel lebt (und in den 1980er-Jahren die Bar-Mizwa für einen der Söhne von Bob Dylan zelebrierte), leitete damals das Cauldron, ein irres makrobiotisches Restaurant im East Village, das seiner Zeit ziemlich weit voraus war. Marty beeinflusste uns stark. Er beschäftigte sich mit fernöstlicher Philosophie, führte ein sehr unbürgerliches Leben – und eines Tages gab er Irwin ein bisschen Gras. Damals war Marihuana zwar unter Jazzmusikern und Beat-Autoren schon sehr angesagt, aber weit davon entfernt, ein Thema für die breite Öffentlichkeit zu sein. Unseren ersten Joint rauchten Irwin und ich an einem Herbstnachmittag im Seth Low Park direkt vor unserer Schule. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Wir hatten die Tüte mit gelbem Papier gedreht und nach dem Anzünden hörte man die ganze Zeit über die Marihuanasamen darin aufplatzen. Das war lange vor der Zeit der Hydrokulturen und der Züchtung samenloser Pflanzen.
Eine Wirkung konnte ich beim ersten Mal nicht feststellen. Marty hatte uns erklärt, wie man inhaliert. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich es versuchte, bis ich endlich high wurde, aber als es dann so weit war, hatte ich einen stundenlangen Lachflash. Es war ein echtes Aha-Erlebnis. Fortan legten Irwin und ich beim Kiffen Musik auf und begannen uns dann irgendwann schlappzulachen, bis der Fressflash einsetzte. Meine Experimente mit Marihuana und später auch LSD brachten mich weiter als jedes Zweirad oder Auto, das ich je besaß.
An den Wochenenden kaufte ich Nickelbags, Marihuana im Wert von 5 Dollar, das in kleinen braunen Umschlägen verkauft wurde. Ich lümmelte in meinem Zimmer rum, stellte den Radiosender WJZ ein und hörte mir die Freitagnachtsendung von Symphony Sid an, durch die ich auf Musiker wie Charlie Parker, John Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Max Roach und Celia Cruz aufmerksam wurde. Dabei saß ich am offenen Fenster, rauchte meinen Joint und blies den Qualm in die Nachtluft hinaus. Ich liebte es, Jazz zu hören, wenn ich stoned war. Während der Sendung sagte Symphony Sid manchmal, dass er müde sei und dass Zuschauer, die etwas hätten, das ihn wach halten könne, eingeladen seien, ihn im Studio zu besuchen. Irgendwann wurde er nach einer Marihuanarazzia von WJZ gefeuert.
Bald fand ich heraus, dass mein Freund Kenny, der die Schule geschmissen hatte, ein leidenschaftlicher Kiffer war. Wir gingen zu ihm nach Hause und zogen uns die Joints rein. Seine Eltern waren nie zu Hause. Als ich eines Tages von einem Besuch bei Kenny zurückkam, stellte mich meine Mutter zur Rede. Sie hatte meinen Schrank aufgeräumt und dabei ein paar Gramm aus meinem Vorrat gefunden. Ich wollte das Zeug unbedingt retten, also musste ich mir blitzschnell was einfallen lassen. Da kam mir die Idee: Ich griff mir die Encyclopædia Britannica, schlug unter Cannabis sativa nach und hielt meiner Mutter den Artikel unter die Nase. Ich wusste, dass das, was dort geschildert wurde, ziemlich harmlos war, denn ich hatte mir den Eintrag bereits durchgelesen, als ich mit dem Kiffen begonnen hatte. Ziemlich sachlich wurde darin erklärt, dass Marihuana nicht abhängig macht. »Ich weiß, was ich tue«, erklärte ich meiner Mutter. »Dass Gras eine Einstiegsdroge ist und unweigerlich zum Konsum härterer Sachen führt, ist bloß ein Ammenmärchen. Das Rauchen macht Spaß und hilft mir dabei, Dinge von einer anderen Warte aus zu betrachten. Und du weißt ja, dass ich keinen Alkohol trinke.«
Dieses Gespräch entschärfte die Situation insoweit, dass wir uns, als mein Vater nach Hause kam, alle zusammen an den Küchentisch setzten und nüchtern über die Angelegenheit sprachen. Meine Eltern verhielten sich dabei ziemlich vernünftig. Sie waren nicht gerade begeistert von dem, was ich tat, ließen sich aber mit der Erklärung beruhigen, dass der Konsum nicht schädlich sei. Dass sie selbst die Prohibition miterlebt hatten, hatte sicher auch etwas damit zu tun, dass sie so gelassen reagierten. Mein Vater hatte kurzzeitig sogar mal für einen Schwarzbrenner gearbeitet. Im Schuljahr 1958/59 gab es an unserer Schule bereits eine kleine Kampagne gegen Drogenkonsum. »Seht euch vor, Marihuanakonsum ist der erste Schritt in die Drogensucht«, hieß es da. Die wirklich großen Antidrogenkampagnen begannen aber erst später. Die Behörden machten zu jener Zeit noch hauptsächlich Comics und Rock ’n’ Roll für die Jugendkriminalität verantwortlich.
Mit sechzehn kam ich zum ersten Mal mit LSD-25 in Kontakt – dem klassischen Pharmazeutikum, das vom Schweizer Chemiekonzern Sandoz entwickelt worden war. 1961 war LSD als Droge noch so gut wie unbekannt. Das war noch vor Timothy Leary und seinem Slogan „Turn on, tune in, drop out!“, und die Substanz selbst wurde erst fünf Jahre später verboten. Ich hatte also keine Ahnung, auf was ich mich da einließ. Meinen ersten Trip schmiss ich bei Kenny. Er zeigte mir eine kleine Phiole mit einer klaren, blauen Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie er daran gekommen war oder wer ihm erklärt hatte, wie man das Zeug einnimmt. Mit einer Pipette träufelte ich mir ein klein wenig Flüssigkeit auf ein Stück Würfelzucker, steckte mir den Zucker in den Mund, wo er sich langsam auflöste, und wartete.
Und dann wurde urplötzlich alles glasklar und hyperreal. Jeder meiner Sinne war geschärft. Einige sogar mehr als das. Nie werde ich das Gefühl vergessen, das sich einstellte, als ich alles plötzlich ganz klar sah. Ich liebte es, Musik aufzulegen, wenn ich auf LSD war. Man ging voll auf in dieser Welt, ganz gleich ob man Jazz, klassische Musik, indische Klänge oder später auch Psychedelic Rock von Leuten wie Hendrix oder den Mothers of Invention hörte. Es spielte keine Rolle, was es für Musik war: Sie saugte einen geradezu auf. Man selbst wurde zur Musik.
LSD eröffnete mir eine ganz neue Art des Denkens. Ich begann Bücher zu lesen wie Hermann Hesses Siddhartha, die Schriften von Khalil Gibran und Aldous Huxleys Die Pforten der Wahrnehmung (Orig. The Doors of Perception – die Essaysammlung, auf die der Name der Band von Jim Morrison und Ray Manzarek zurückgeht). Mit einem Mal war ich ein Reisender. Trips zu werfen bedeutete, sich selbst an seine Grenzen zu bringen, die eigene Bequemlichkeit und das, woran man gewohnt ist, hinter sich zu lassen. Es war, als gebe man die vernunftgesteuerte Kontrolle ab. Schon bei meinem ersten Trip hatte ich den Eindruck, dass sich eine Tür zwischen meinem Bewusstsein und meinem Unterbewusstsein öffnet, zwischen mir und dem Kosmos. Ich konnte einen umfassenden Blick auf meine eigene Persönlichkeit werfen. Ich war mit allem verbunden. Ich fühlte mich immer sehr wohl in diesem veränderten Bewusstseinszustand. Der ein oder andere meiner Bekannten flippte auf LSD schon mal aus, aber ich hatte nie Probleme mit den Empfindungen, die die Droge hervorrief, ich konnte sie immer gut verarbeiten. Es war eine Lernerfahrung, eine Offenbarung. Eine Paranoia habe ich kein einziges Mal erlebt. Ich war nie auf einem Horrortrip.
Als ich zum zweiten oder dritten Mal auf LSD war, beschlossen meine Freunde und ich, mit der U-Bahn nach Manhattan zu fahren. Ich saß gleich neben der Türe und beobachtete, wie sich der Typ mir gegenüber in einen Hasen verwandelte. Zuerst zuckte er mit der Nase, dann wuchsen ihm Schnurrhaare und lange Ohren. Das rief bei mir keine Panik hervor, ich ließ es einfach geschehen und beobachtete die Metamorphose interessiert. Um etwa vier Uhr in der Frühe kamen wir am Times Square an und schlenderten durch die leeren Straßenschluchten. Ich war ungeheuer fasziniert von allem, was ich sah, und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich alleine war. Meine Freunde waren verschwunden. Irgendwann, nachdem ich, wie mir schien, meilenweit gelaufen war, kam ich in einen dunklen Wald. Ich setzte mich auf eine Bank und verlor mich in einem stundenlangen Dialog mit der Natur. Dann blickte ich auf und stellte fest, dass die Sonne aufgegangen war. Ich sah das Empire State Building vor mir aufragen und das holte mich zurück in die Realität. Es stellte sich heraus, dass ich lediglich im Park der Little Church Around the Corner nahe der Fifth Avenue gelandet war.
In dem Sommer, als ich die elfte Klasse beendet hatte, entdeckte ich Greenwich Village. Ich war zuvor schon ein paarmal mit meiner Familie dort gewesen. Wir hatten in einem Theater an der Christopher Street Die Dreigroschenoper gesehen oder waren einfach ein bisschen herumspaziert. Aber 1961, als ich Kenny und seine neue Freundin Kathy, eine aparte Rothaarige, dort in einem kleinen Laden names Village Corner traf, war ich auf Anhieb begeistert von der nachbarschaftlichen Atmosphäre, dem kulturellen Vibe und den Menschen, die dort lebten. Kenny und Kathy hatten eine Freundin, eine unglaublich gut aussehende Afroamerikanerin namens Pauline. Sie und Kathy teilten sich ein Apartment am West Broadway 500. Zwischen Pauline und mir funkte es sofort. Ich verbrachte fast den ganzen Sommer bei ihr und machte mich in dem Apartment der beiden breit.
Pauline und Kathy arbeiteten als »Hostessen«, wobei Pauline keine Kunden bediente, sondern sich um die Organisation kümmerte. Sie vergab Termine und brachte die Mädchen an zuvor verabredete Orte, wo sie sich mit ihren »Dates« trafen. Ich habe mir keinen großen Kopf um das gemacht, was sie tat. Ich dachte mir einfach, das ist ihr Leben und ihre Art und Weise, Geld zu verdienen. Ich hatte zuvor schon die ein oder andere Freundin gehabt, aber die Zeit mit ihr war wirklich außergewöhnlich. Abends warf sie sich in Schale, wie Frauen das damals taten, trug High Heels und enge Cocktailkleider, ganz das glamouröse Callgirl, immer elegant, nie trashy. Ihre Kundschaft bestand aus wohlhabenden Geschäftsmännern, die viel Geld für ihre Dienstleistungen bezahlten – sie nahm mehrere Hundert Dollar für ihre Services. Das war damals eine Menge Holz.
Die Mädchen wohnten in einem kleinen Hinterhofgebäude auf der Grenze zwischen dem Village und dem heute als SoHo bekannten Viertel, das damals noch sehr industriell geprägt war, mit vielen alten Fabriken und Lagerhallen, die erst ganz allmählich zu Künstlerlofts umgebaut wurden. In dem Apartment der beiden herrschte ein unkonventionelles, bohemehaftes Flair. Matratzen lagen auf dem Boden, Kerzen brannten in jeder Ecke, ständig lief Musik, dunkle Schals hingen vor den Fenstern und über den Lampen. Wir verbrachten allerdings nicht viel Zeit dort, in der Regel waren wir nur zum Schlafen da. Nachmittags zeigte mir Pauline das Village. Meist trug sie dabei einen Rock über einem hautengen Body und eine Perücke. Den Abend begannen wir in der Regel im Village Corner und zogen dann von dort aus weiter ins Village Gate oder Five Spot, um Jazz zu hören. Ich fand es immer faszinierend zu beobachten, wie vier oder fünf Musiker ohne jegliche Vorgabe miteinander spielen und improvisieren konnten. Gelegentlich endete unser Abend auch in Harlem, wo wir uns die Jazz- und R&B-Clubs ansahen.
Die ganze Welt, in der Pauline lebte, faszinierte mich. Allmählich entwickelte sich aus der ehemaligen Beatszene die Folkszene als neue Gegenkultur. Das Leben zwischen all den Fotografen, Malern, Minderheiten und Außenseitern, die ihren eigenen Weg gingen, statt mit der Masse mitzuschwimmen, war ungeheuer inspirierend. Die Leute machten kleine Läden auf, deren Angebot auf die speziellen Wünsche der Anwohner zugeschnitten war. Bei A Different Drummer etwa am St. Mark’s Place im East Village konnte man Secondhandklamotten kaufen. Die Mode veränderte sich, die Leute zogen sich anders an als früher. Ich ließ meine Haare wachsen. Das Village präsentierte mir einen sehr reizvollen Lifestyle, der so ganz anders war als das, was ich aus Bensonhurst kannte.
Nach etwa zwei Monaten erklärte mir Pauline, dass sie den Eindruck habe, ich würde mich in sie verlieben, unsere Beziehung jedoch nichts für die Ewigkeit sei. Sie entlarvte mich als genau den Grünschnabel, der ich war, und wollte vermeiden, dass ich mich zu sehr an sie band. Es tat weh, aber sie sorgte dafür, dass es eine sehr freundschaftliche Trennung wurde. Ich sah Pauline nie wieder, doch der Sommer mit ihr veränderte mich. Sie öffnete Türen, die sich nie wieder schlossen.
In meinem letzten Jahr an der Highschool bekam ich – dank meines Studienberaters Mr. Bonham – die Chance, früher als geplant an die Uni zu wechseln. Die New York University erlaubte mir, mich schon im Januar einzuschreiben, allerdings unter der Voraussetzung, dass ich die Highschool in Abendkursen beendete. Und so kehrte ich bereits Anfang 1962 ins Village zurück.
Meine Eltern waren sehr angetan davon, wie sich die Dinge entwickelten. Es war immer ihr Ziel gewesen, dass ich studiere, und die NYU war damals nicht teuer, außerdem konnte ich von Brooklyn aus dorthin pendeln. Im Sommer ergatterte ich einen Job in einem angesagten Laden namens Village Cobbler an der Bleecker Street. Wir verkauften ausgefallene Ohrringe, Lederwaren, Kunsthandwerk und eine Menge anderen Nippes. Ich liebte das Leben inmitten der sich entwickelnden Folkszene im Village. Die neue Musikrichtung war gerade mächtig im Kommen und eine ganz neue Generation von Singer-Songwritern erklomm die Bühnen in den Villageclubs. Bob Dylans erstes Album war bereits bei Columbia herausgekommen, aber gelegentlich trat er immer noch irgendwo im Viertel auf. Ich trieb mich herum in den Kaffeehäusern und Clubs rund um die Bleecker und die MacDougal Street – Café Wha?, Bitter End, Gerde’s Folk City und Gaslight – und sah dort Leute wie Bob Gibson, Phil Ochs, Jack Elliott, Fred Neil und Dave Van Ronk. Im Washington Square Park wimmelte es von Bongospielern und allen möglichen anderen Musikern, Künstlern und Dealern. Gras bekam man dort rund um die Uhr.
Ich saß oft in einem kleinen Kaffeehaus namens Rienzi’s an der MacDougal Street und beobachtete die flippige, bunte Menge durch das Fenster. Richtige Hippies waren das damals noch nicht, eher eine frühe Vorform. Um das lebhafte Villagetreiben zu dokumentieren, hatte ich mir eine Super-8-Kamera zugelegt. Ich plante eine Doku mit dem Titel A View from Rienzi’s und machte dafür auch einige Aufnahmen, ein fertiger Film wurde daraus allerdings nie.
Kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag im Dezember erhielt ich ein Schreiben mit der Aufforderung, mich für den Militärdienst mustern zu lassen. 1962 waren die Vereinigten Staaten noch nicht direkt in den vietnamesischen Bürgerkrieg involviert, doch die Situation spitzte sich mehr und mehr zu. Meiner Meinung nach gab es für die USA keinen Grund, sich in einen seit bereits über vierzig Jahren schwelenden Konflikt in Südostasien einzumischen. Ich hatte nichts gegen die Vietnamesen. Drei Wochen lang ging ich in der Hoffnung zum Psychiater, eine Untauglichkeitsbescheinigung zu erhalten. Dem Arzt war schnell klar, dass ich keinen Respekt vor Autoritäten hatte und niemals auf einen anderen Menschen schießen würde, nur weil mir das befohlen wurde. Er schrieb einen Bericht, der mit dem Fazit endete, dass ich kein guter Kandidat für den Militärdienst sei. Ich dachte, damit wäre für mich alles geklärt und ich hätte die Untauglichkeitsbescheinigung bereits in der Tasche. Stattdessen wurde ich zur Musterung in die Brooklyner Borough Hall bestellt.
Ich ließ das ganze Prozedere an Tests und ärztlichen Untersuchungen über mich ergehen und wartete nur darauf, dass man mich vortreten ließ und mir mitteilte: »Sie sind nicht das, was wir suchen.« Doch das passierte nicht. Schließlich entschied ich mich, die Anweisungen der Uniformierten, die uns während der Musterung begleiteten, zu missachten, scherte aus der Reihe aus und rannte nach unten ins Büro des Psychiaters. Ich stürmte in den Raum und platzte los: »Hören Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich meine Papiere überhaupt angesehen haben, aber Sie werden mich in Ihrer Truppe nicht haben wollen.« Anschließend besprach ich meine Angelegenheit in Ruhe mit dem Therapeuten. Ich erklärte ihm, dass ich moralische Bedenken gegen den Krieg als solchen hatte und das Töten anderer für sinnlos hielt. Der Vietnamkonflikt war damals noch nicht so weit fortgeschritten, dass das Militär verzweifelt Soldaten suchte. Vier, fünf Jahre später sah das völlig anders aus, da war es kaum möglich, sich der Einberufung zu entziehen. Ich hingegen erhielt nach meinem langen Gespräch mit dem Seelenklempner meine Untauglichkeitsbescheinigung.
Das war das Letzte, was ich von der Einberufungsbehörde hörte. Es war mir gelungen, mich dem Einsatz in einem Krieg zu entziehen, an den ich nicht glaubte. Ich hätte mir damals niemals vorstellen können, dass am Ende des Jahrzehnts Millionen gleichgesinnter junger Menschen in Woodstock die gleiche Auffassung wie ich vertreten und sich für den Frieden einsetzen würden.
Kapitel 2
The Grove
Während der Regen auf die nicht überdachte Bühne prasselt, regt sich zunehmend Unmut in der Menge. Ein paar Idioten beginnen, mit Colaflaschen und Steinen um sich zu werfen und lauthals Musik zu fordern. Bei dem Wetter kann ich keine Band mit elektronisch verstärkten Instrumenten auf die Bühne schicken, auch wenn ein durchgeknallter britischer Sänger verkündet, dass seine Band, Crazy World of Arthur Brown, gerne auftreten würde und dabei sogar auf einen Stromschlag hoffe. »Das würde wunderschön aussehen«, erklärt er. Mir bereitet die Vorstellung des brutzelnden Arthurs kein besonderes Vergnügen.
Was wir brauchen, ist ein mitreißender Akustikact.
Als der Regen endlich etwas nachlässt und die Crew beginnt, das Wasser von der – aus zwei Tiefladern bestehenden – Bühne zu schippen, entdecke ich John Lee Hooker hinter der Bühne. Rauchend und cool wie immer sitzt er da und wartet auf seinen Auftritt. Das ist mein Mann!
Zwanzig Minuten später hängt das Publikum dem fünfzigjährigen Bluesveteranen an den Lippen. Er ist vermutlich schon unter weitaus schlimmeren Bedingungen aufgetreten. Mit tief in die Stirn gezogenem Porkpie und Sonnenbrille spielt er zunächst seinen Klassiker »Boogie Chillen’« und danach einem improvisierten talking blues, in dem er darüber sinniert, wie es ist, im Regen zu spielen. Das Publikum ist gebannt von seiner Darbietung, und ich staune, welche Macht die Musik über die Menschen hat, dass sie sie derart ergreift und verwandelt. Zum Ende des Auftritts klettert eine Frau auf die Bühne und legt John Lee einen Blumenstrauß vor die Füße.
Im Frühjahr 1964 begann ich mein Studium an der University of Tampa. Es zeigte sich allerdings rasch, dass Tampa wenig mehr war als eine Stadt voller Astronauten. Mich hielt es nur sechs Monate dort. Die Atmosphäre war mir einfach zu spießig, zu verkrampft. Ich zog also wieder nach New York und ging zurück zur NYU, reiste zwischendurch aber immer wieder gerne nach Florida. Einer meiner Freunde aus Bensonhurst, Bob West, begleitete mich oft nach Miami. Mit einem New Yorker Kennzeichen Richtung Süden zu fahren, war damals nicht ganz ohne. Sogenannte Freedom Riders aus dem Norden, die in den Süden fuhren, um dort für die Durchsetzung der gesetzlich festgeschriebenen Bürgerrechte zu kämpfen, gerieten oft in Schwierigkeiten. Auch meine Schwester gehörte zu den Aktivisten. Nachdem sie ihr Jurastudium abgeschlossen hatte, übersiedelte sie mit ihrem Mann, Paul Brest, der Anwalt war, nach Mississippi und arbeitete dort knapp zwei Jahre lang für den Legal Defense Fund, der sich dafür einsetzte, die Rassentrennung an den Schulen abzuschaffen.
Im Süden wurden Leute aus dem Norden – insbesondere solche mit langen Haaren – nicht selten schief angesehen. Einmal fuhren Bob und ich mit einer Corvette nach Florida und machten irgendwo in South Carolina an einem Imbiss Halt. Unsere Haare waren zu der Zeit ziemlich lang. Wir setzten uns an die Theke, und während wir Kaffee bestellten, fiel uns ein Schild neben der Milchmaschine auf, auf dem stand: DER KU-KLUX-KLAN HAT DICH IM VISIER. Ohne darüber nachzudenken, wo wir gerade waren, brachen wir in schallendes Gelächter aus, wodurch wir die Aufmerksamkeit einiger Gäste erregten. Die Stimmung in dem Laden heizte sich in Windeseile auf, bis wir letztlich – fast wie in einem Film – die Beine in die Hand nahmen, zu unserem Auto rannten und uns vom Acker machten. Eine Horde junger Halbstarker war uns auf den Fersen. Sie sprangen auf einen Pick-up und nahmen die Verfolgung auf, doch gegen unsere Corvette hatten sie natürlich keine Chance.
Während eines weiteren Ausflugs nach Florida landeten Bob und ich auch in Coconut Grove, einer lauschigen, tropischen Kommune südlich von Miami. Sie war nicht weit entfernt vom Campus der University of Miami und gefiel uns sehr mit ihrem künstlerischen Flair und ihrer entspannten Atmosphäre. Coconut Grove war für mich eine große Offenbarung – der perfekte Ort zum Leben.
Ende 1965, während des Wintersemesters an der NYU, hatte ich vom Büffeln die Nase voll. Ich wollte nach Miami ziehen und einen Headshop eröffnen. Immer wieder hatte ich erlebt, wie meine Eltern in neue Unternehmen investiert hatten, ganz gleich ob sie sich mit der jeweiligen Branche auskannten oder nicht, und dachte daher: Warum nicht? »Learning by doing« hieß ihre Devise und so wollte ich es auch halten. »Studieren ist nichts für mich«, erklärte ich ihnen. »Ich will endlich auf eigenen Beinen stehen.« Wie immer waren sie zwar skeptisch, unterstützten mich jedoch. Ich brach mein Studium an der NYU nach dem Wintersemester ab und entwickelte Ideen, knüpfte Kontakte und konzipierte Strategien, wie sich die Idee mit dem Headshop umsetzen ließ. Ich verkaufte ein bisschen Gras, um über die Runden zu kommen, und hatte etwa vier-, 5000 Dollar auf der Bank, die teils noch von den Geschenken stammten, die ich zu meiner Bar-Mizwa bekommen hatte, sowie aus Einnahmen durch diverse Nebenjobs, die ich über die Jahre gespart hatte. Damit hatte ich erst mal genug, um Waren zu kaufen, einen Laden zu mieten und ein Geschäft aufzubauen.
Während meines letzten Semesters an der NYU hatte ich wieder engeren Kontakt zu Ellen Lemisch. Ellen und ich hatten uns schon als Kinder im Optikerladen ihres Vaters kennengelernt. Sie und ihre eineiige Zwillingsschwester lebten in einem großen Apartment an der Upper West Side. Sie boten Zimmer zur Untermiete an, und ihre Wohnung war ein wahrer Tummelplatz für allerlei interessante Leute, die sich dort die Klinke in die Hand gaben. Es war fast so etwas wie ein alternativer Salon – ständig war Leben in der Bude. Ellen und ich verliebten uns ineinander, und sie beschloss, mit mir nach Florida zu gehen. Sie kannte zahlreiche Kunsthandwerker, die kleine Vorratsdosen und andere hübsche Dinge zur Aufbewahrung von Cannabisprodukten herstellten, und so legten wir uns nach und nach ein kleines Warendepot für den Shop an.
Im East Village hatte der junge Unternehmer Jeff Glick mitdem »Head Shop« den allerersten Laden dieser Art eröffnet. Er lag an der East Ninth Street und das Angebot umfasste Zigarettenpapier, Pfeifen und allerlei anderen Kram für den Cannabiskonsum. Darüber hinaus bot Jeff frühe Plakate von Peter Max, einem bekannten Pop-Art-Künstler, und andere psychedelische Kunstwerke an. Jeff war ein echt netter Kerl und brachte mir die wichtigsten Grundlagen bei, um einen Laden wie seinen zu eröffnen. Außerdem stellte er für mich einen Kontakt zu Peter Max her. Als ich Peter von meinen Plänen erzählte, lud er mich in sein Apartment an der Upper West Side ein, damit ich mir Plakate für meinen Laden aussuchen konnte. Vermutlich hoffte er auf eine Großbestellung, denn er rollte Dutzende von Plakaten vor mir aus. Doch mit meinem schmalen Budget konnte ich mir nur sechs davon leisten. Glücklicherweise störte er sich nicht daran und wir wurden auf Anhieb gute Freunde – und sind es bis heute.
Ellen und ich besorgten uns einen geräumigen Mietwagen, packten all unsere Habe hinein und machten uns auf den Weg nach Miami. Nachdem wir lange vergeblich nach einem Ladenlokal in der Coconut Grove gesucht hatten, fanden wir im Herbst 1966 endlich ein leeres Geschäft im Süden von Miami, in der Nähe der Universität. Wenig später eröffnete unser Head Shop South am Sunset Boulevard mit viel Tamtam und Rock ’n’ Roll. Für die Eröffnungsparty hatte ich eine regional bekannte Band gebucht und der Laden war brechend voll. Die Kids in Südflorida sahen damals noch ziemlich spießig aus, es gab hier bei Weitem noch nicht so viele Langhaarige wie in New York oder San Francisco. Aber sie waren interessiert und wollten sehen, was bei uns los ist. Dummerweise galt das auch für den Polizeichef der Stadt und ein paar Sicherheitskräfte des privaten Securityunternehmens Wackenhut, die ähnlich arbeiteten wie die spätere Drogenvollzugsbehörde DEA. Sie kamen zur Eröffnung, sahen sich um, und am nächsten Tag ließen sie den Laden schließen, weil wir keine Lizenz vorweisen konnten. Wir waren in einem sehr konservativen Viertel gelandet, und den Leuten dort passte es gar nicht, dass wir vor ihrer Tür so einen Laden eröffnet hatten.
Ich brachte den Fall vor Gericht. Die Anhörung fand in einem vollgepackten Saal statt, in dem sich nur ein paar wenige Freaks unter die mir vornehmlich ablehnend gegenüberstehende Bürgerschaft mischten. Ein Professor der University of Miami schlug sich allerdings auf meine Seite und setzte sich wortreich für meine Rechte ein. Leider ließ er sich dabei etwas zu sehr von seinem eigenen Furor mitreißen, sodass er mit seinem Engagement endgültig dafür sorgte, dass ich wieder dichtmachen konnte. Mein Antrag auf Erteilung einer Verkaufslizenz wurde abgelehnt. Ich überlegte, in Berufung zu gehen, doch noch bevor sich die Gelegenheit dazu bot, nahm mich der Polizeichef – ein Mann, der ursprünglich aus der Bronx stammte – zu einem vertraulichen Gespräch zur Seite. »Hör zu«, sagte er mir, »das hier ist nicht New York. Du bist hier im konservativen Süden. Die werden dich hier niemals so ein Geschäft eröffnen lassen.«
Ich ließ mir diese Worte durch den Kopf gehen und streckte meine Fühler erneut in der Grove aus, um zu sehen, ob dort inzwischen nicht doch ein Ladenlokal frei geworden war. Ellen und ich zogen unterdessen in ein Motel am Bayshore Drive und später mieteten wir einen alten Holzbungalow von einem Saxofonspieler namens Twig an der Twenty-seventh Avenue.
Die Leute, die in der Grove wohnten, waren ein erstaunlich heterogenes Völkchen. Während in der South Grove die großen Industriebosse in herrschaftlichen Anwesen residierten, wimmelte es im Rest des Viertels von gesellschaftlichen Randfiguren: Künstlern, Kunsthandwerkern, Musikern, Fischern, Schmugglern und ein paar Hippies. Um Folkmusik zu hören, ging man ins Gaslight. Dessen Inhaber war Sam Hood, der Sohn des Mannes, dem der New Yorker Gaslight-Club gehörte. Der eher öffentlichkeitsscheue Musiker Fred Neil, der ursprünglich aus Florida stammte, aber lange in New York gelebt und im Village für Furore gesorgt hatte, war in seine Heimat zurückgekehrt und lebte ebenfalls in der Grove. Er wiederum zog andere Singer-Songwriter wie David Crosby an, die oft ins Viertel kamen, um im Gaslight aufzutreten und sich mit Fred zu treffen.
Die direkt an der Biscayne Bay gelegene Grove war mit ihrer entspannten Atmosphäre das genaue Gegenteil des konservativ-verstockten South Miami. Im Herzen der Grove entdeckte ich ein großes, weiß verputztes Steincottage mit einer von Fenstern umschlossenen Veranda, auf der wir Plakate ausstellen konnten. In direkter Nachbarschaft befanden sich Adam Turtles Schreinerwerkstatt, der Ludicious Leather Shop, die Ateliers der Bildhauer Lester Sperling, Michael »Michelangelo« Alocca, David Dowes und Gail Douglas sowie das Studio des Malers Tony Scornavacca. Außerdem hatte Dr. John Lillys Dolphin Research Center seinen Sitz in der Grove – in einem ehemaligen Bankgebäude im Stadtzentrum. Während seiner frühen Forschungen zur Kommunikation mit Delphinen verabreichte Dr. Lilly den Tieren, mit denen er arbeitete, unter anderem LSD. Später nahm er die Droge gemeinsam mit den Tieren ein und schwamm mit ihnen durch ein Salzwasserbecken, das in einem der ehemaligen Tresorräume eingebaut worden war.
Die Miete und die Kaution für den Laden in South Miami hatten alle meine Ersparnisse verschlungen. Daher rief ich meine Eltern an und bat sie um ein Darlehen, das sie mir auch gewährten, ohne weitere Fragen zu stellen. Mein Vater traf Vorkehrungen, mir durch meinen Onkel Sam, den Bruder meiner Mutter, der in Miami lebte, 3500 Dollar aushändigen zu lassen. Sam war völlig außer sich, als er hörte, wozu das Geld benötigt wurde: »Ein Headshop?«, echauffierte er sich. »Hast du denn noch alle Tassen im Schrank?« Er konnte nicht begreifen, dass mein Vater das unterstützte.
Diesmal beantragte ich vor der Eröffnung eine Lizenz zur Führung eines Souvenirladens. Anfangs half Bob West Ellen und mir, das Geschäft zu führen. Das Ladenlokal hatte fünf Räume, in denen wir unsere Waren ausstellten. Glasvitrinen voller Raucherzubehör, darunter eine große Auswahl an Zigarettenpapieren, türkischen Wasserpfeifen und anderen exotischen Pfeifenarten. Die Nachfrage nach Postern war 1966 immens angestiegen, sodass wir alle freien Wand- und Deckenflächen nutzten, um Schwarz-Weiß-Plakate von Ikonen der Popkultur – wie z. B. den Marx Brothers, Allen Ginsberg, Bob Dylan, Lenny Bruce und Marlon Brando in Der Wilde – zu präsentieren. Neben Peter Max und seinen Pop-Art-Postern führten wir auch Werke von einigen Künstlern aus San Francisco, die die fantastischen Flyer zu den Filmore-and-Family-Dog-Shows gemacht hatten. Die Durchgänge zwischen den verschiedenen Zimmern waren mit Perlenvorhängen abgetrennt und einige Räume wurden mit Stroboskop- oder Schwarzlicht beleuchtet. Und natürlich wurde bei uns ständig Musik gespielt – Beatles, Stones, Mothers of Invention, Dylan, die Byrds und so weiter. Am Wochenende liefen die Geschäfte großartig. Freitagabends war überall Party angesagt und wir hatten bis Mitternacht geöffnet. Der Laden wurde zum Treffpunkt für die aufkeimende Gegenkulturbewegung in Miami.
Wenn der Laden geschlossen war, gingen wir segeln oder trafen uns mit Freunden, bei denen wir kochten, Musik hörten oder Trips schmissen. Ich kaufte einen alten VW-Bus, mit dem man hervorragend durch die Grove cruisen konnte; vorne hatte er nach oben klappbare Safarifenster, die sich nach außen hin öffnen ließen. Gelegentlich machten wir damit Mystical-Midnight-Trips. Wir nahmen LSD, dröhnten uns so richtig zu, fuhren mit dem Bus an den Strand oder zum E-Werk und beobachteten die Sterne.
Für mich war die Droge weiterhin eine Art experimentelle Substanz. Trips waren für mich eine lehrreiche Erfahrung, sie erweiterten mein Bewusstsein und führten mich auf einen klaren, spirituellen Weg. Ich fand es toll, andere auf einen Trip mitzunehmen und sie dabei zu führen. Ich legte ganz bestimmte Platten auf, um für eine Art musikalische Reise zu sorgen. Zu Beginn waren es Jazzalben, später Stücke des indischen Sitarvirtuosen Ravi Shankar und Songs von Frank Zappa und den Mothers of Invention.
Irgendwann war es aus zwischen Ellen und mir und sie zog zurück nach New York. Ein paar Monate später kam ich mit Sonya Michael zusammen, einer hübschen Blondine Ende zwanzig. Sonya malte und teilte sich ein Atelier mit Don Keider, einem Künstler und Musiker. DK spielte Vibrafon und Schlagzeug, und er war derjenige, über den ich später meinen künftigen Woodstock-Partner Artie Kornfeld kennenlernte. Sonya, DK und ich gründeten die Firma Sodo Posters (Sodo als Abkürzung für Sonya und Don). Für sie entwarfen die beiden anderen großartige Schwarzlichtplakate mit Titeln wie »Speed«, »Lucy in the Sky«, »Mushroom Mountain« und »The Trip«. Und diese Poster verkauften sich so gut, dass wir sogar andere Headshops im ganzen Land damit versorgten.
Rund um den Laden entstand ganz allmählich eine eigene Szene, und 1967 bezog die Redaktion des alternativen Magazins Libertarian Watchdog einen der Hinterräume. Es dauerte nicht lange, bis das alles die Bullen auf den Plan rief. Keine Frage: Denen war ich schon lange ein Dorn im Auge. Immer wieder hatten sie versucht, mich zu schikanieren, etwa indem sie meinen Kunden für irgendwelche Lappalien Strafzettel ausstellten – z. B. wegen Unaufmerksamkeit als Fußgänger im Straßenverkehr. Besonders schlimm wurde es nach einem Beitrag im Lokalfernsehen unter dem Titel »Marihuana in Miami«, der am 13. Juni 1967 ausgestrahlt wurde. Man hatte mich in meinem Laden gefilmt. In dem Beitrag sah ich aus wie sechzehn und erklärte – als vermeintlicher Dreikäsehoch –, wie einige unserer Produkte den Konsumenten zu psychedelischen Erfahrungen verhelfen könnten. Die Gesichter einiger anderer Interviewpartner, die in dem Beitrag zu Wort kamen und über ihren Drogenkonsum sprachen, hatte man unkenntlich gemacht, aber ich betrachtete uns als Vorreiter einer neuen Bewegung im Süden und wollte den Leuten unseren Laden und unser Angebot ohne Angst und Hemmungen vorstellen und erkennbar dazu stehen.
Schon bald wurde ein ganzer Trupp Motorradpolizisten exklusiv vor unserem Laden postiert. Jeden Freitag- und Samstagabend parkten sie an der Ecke und schrieben so viele Strafzettel wie möglich. Und wenn es noch irgendwie mittels fadenscheiniger Anschuldigungen oder Verdächtigungen hinzubiegen war, verhafteten sie mich. Diese ganze schikanöse Aktion lief über mehrere Monate und mit einigen der Beamten freundete ich mich während dieser Zeit sogar ziemlich gut an. Es waren nette Kerle, etwa in meinem Alter, und irgendwann siegte ihre Neugier und wir kamen ins Gespräch. Einer von ihnen, »Bob the Cop«, unterstützte uns später sogar beim Woodstock-Festival.
Die Lokalpolitiker waren wild entschlossen, dem Marihuanakonsum in ihrem Einflussbereich einen Riegel vorzuschieben, und planten eine groß angelegte Razzia in der gesamten Grove. Dank eines Freundes, der im Büro des Staatsanwalts arbeitete, wussten wir jedoch lange im Voraus Bescheid. Außerdem lag uns eine Liste vor mit rund neunzig Namen von Personen, für deren Wohnungen Durchsuchungsbeschlüsse genehmigt worden waren. Der Laden stand nicht darauf, wohl aber meine Privatadresse an der Twenty-seventh Avenue, wo ab und an eine Party stieg.
Als ich von der Razzia erfuhr, plante ich bereits den Umzug in ein anderes Haus im üppig begrünten Teil der tropisch anmutenden South Grove, in der es überall herrlich nach Jasmin duftete. Ich hatte ein hübsches Häuschen im spanischen Stil von einer Frau namens Mary Whitlock gemietet, einer Dame, die noch der alteingesessenen Südstaatenaristokratie angehörte. Am Tag der Razzia hatte ich meinen gesamten Hausstand bereits in das neue Domizil gebracht, bis auf ein paar Dinge, mit denen ich den Polizisten ein bisschen Unterhaltung verschaffen wollte. Alles, was sie an meiner alten Adresse an der Twenty-seventh Avenue fanden, waren ein Plattenspieler, auf dem laut Musik lief, und Stroboskoplichter, die nonstop flackerten.
Wir hatten auch anderen Bescheid gesagt, die auf der Liste standen, sodass ihre Häuser am Tag der Razzia ebenfalls sauber waren und niemand vor Ort war, den man hätte verhaften können. Während Dutzende von Polizeiautos auf dem Parkplatz der Florida Pharmacy auf ihren Einsatz warteten, waren wir mit unseren Fahrrädern in der Grove unterwegs. Das Ganze hatte etwas von einem Film mit den Keystone Cops: Während eine Reihe von Einsatzwagen die Grove in die eine Richtung entlangfuhr, strampelte eine ebenso große Gruppe langhaariger Zausel auf ihren Drahteseln in die entgegengesetzte Richtung. Die einzigen zwei, drei Leute, die an dem Tag verhaftet wurden, waren ein paar arme Schlucker, zu denen die Nachricht von der Razzia nicht durchgedrungen war.
Während sich der Head Shop South zum Treffpunkt der Alternativszene von Miami mauserte, nahm ich mir vor, mehr Musik in die Gegend zu bringen. Alle wollten damals die Bands, deren Platten sie hörten, auch live sehen. Das erste sogenannte Be-in mit den Grateful Dead hatte im Januar 1967 im Golden Gate Park in San Francisco stattgefunden, wenig später wurden Be-ins auch im New Yorker Central Park organisiert. Ich veranstaltete ein ähnliches Event in unserem kleinen Park in der Grove. Die Veranstaltung, bei der ein paar Bands aus dem Umland auftraten, stieß auf großes Interesse. Leute mit Akustikgitarren saßen am Rand und spielten und über allem lag der Duft von Räucherkerzen und Tabak.
Die meisten Bands aus New York und Kalifornien, die auf Tour gingen und in Miami Station machten, traten in einem großen Rockclub namens Three Image auf. Die echten Stars sah man im Dinner Key Auditorium, einem ehemaligen Segelflugzeughangar der Pan Am, der im Hafenviertel der Grove gelegen war. Nachdem sich Jim Morrison im März 1969 dort während eines Konzerts der Doors angeblich auf offener Bühne entblößte, wurde die Location allerdings für Auftritte von Rockstars gesperrt. Ende 1967 veranstaltete ich zunächst ein paar Shows in einem Amphitheater am Key Biscayne. Zu den dort auftretenden Musikern zählte auch Ravi Shankar, der bereits beim Monterey-Pop-Festival im Juni für Furore gesorgt hatte. Ich suchte immer wieder nach besonders reizvollen Orten für Konzerte und stieß dabei auch auf das Reservat der Seminolenindianer im Herzen der Everglades, wo man Gras rauchen konnte, so viel man wollte, ohne dabei von den Bullen behelligt zu werden. Ich traf mich mit den Stammesältesten, um meine Idee mit ihnen zu besprechen, doch leider konnten wir uns auf keinen geeigneten Termin einigen.
Jeder, der sich der alternativen Szene zugehörig oder irgendwie verbunden fühlte – von Timothy Leary bis hin zu Jerry Garcia –, schaute, wenn er in Miami war, bei meinem Laden vorbei. Im Dezember stattete mir Paul Krassner, der Herausgeber von The Realist, einen Besuch ab. Ich hatte ihn einige Jahre zuvor in New York kennengelernt, als ich an seinem Seminar »From Mickey Mouse to the Green Berets« an der New School for Social Research teilnahm. Krassner kam in meinen Laden in Begleitung von Abbie Hoffman, also Captain America höchstpersönlich. Hoffman stellte sich vor und wir verstanden uns auf Anhieb bestens. Er hatte einen wunderbaren Humor. Ihm ging es letztlich darum, die alternative Szene immer größer werden zu lassen und auch auf diesem Wege Einfluss auf den Mainstream zu nehmen. Während ihrer Zeit auf den Keys gründeten er und Paul die Youth International Party, deren Anhänger sich Yippies nannten. Später begegnete ich Abbie wieder in New York, und auch in Woodstock hinterließ er einen bleibenden Eindruck.
Abbie Hoffman: Ich lernte Michael Lang etwa ein Jahr vor (Woodstock) kennen. Er hatte damals einen Laden in der Coconut Grove. Ich hielt irgendwo da unten eine Rede und blieb noch ein paar Tage länger, weil es so schön warm war und ich gerade Revolution for the Hell of It schrieb … Er erzählte mir, dass er eine – wie sich herausstellte ziemlich vage – Idee für ein Festival habe. Auf mich wirkte er wie ein kleiner Headshopbesitzer, der zwar einen großen Traum hat, aber nicht über die visionäre Energie verfügt, tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen, das meiner Meinung nach wohl als das größte kulturelle Event des Jahrhunderts hätte gelten können. Aber genau das hat er gemacht.
Eine weitere faszinierende Szene in Miami entwickelte sich rund um das Seaquarium, wo die diversen Delfine lebten, die die Rolle des Flipper in der beliebten gleichnamigen TV-Serie spielten. Ihr Trainer, Richard O’Barry, wurde später einer der allerersten Tierrechtsaktivisten. Während seiner Arbeit mit den Tieren wurde ihm bewusst, wie intelligent Delfine sind und wie ausgeprägt ihr Kommunikationsbedürfnis ist. Nachdem Cathy, eine der Flipper-Darstellerinnen, Depressionen bekam und starb – Rics Ansicht nach beging sie Selbstmord –, änderte er sein Leben. Er hielt es für unmenschlich, Delfine gefangen zu halten, und setzte sich fortan für deren Rettung ein. Ric verband eine enge Freundschaft mit dem Musiker Fred Neil, der davon überzeugt war, dass er mittels Musik mit den Tieren kommunizieren könne. Viele von Freds Freunden kamen in die Grove, um ihn und die Delfine zu sehen.
Ric O’Barry: Ich erinnere mich noch, wie Fred seinen Kopf unter Wasser hielt und rundum Bläschen aufstiegen, während er versuchte, den Delfinen etwas vorzusingen. Er spielte für sie auch auf seiner 12-saitigen Gitarre. Bei bestimmten Akkorden tauchten die Delfine auf und klopften gegen das Instrument. Fred zufolge war es der Ton, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Er brachte auch Freunde mit, die für die Delfine musizierten: Joni Mitchell, Ramblin’ Jack Elliott, David Crosby und andere klasse Typen. Die Leute wunderten sich, was plötzlich all diese Langhaarigen im Seaquarium verloren hatten.
Mit Ric, der mein Nachbar war, freundete ich mich an. Inspiriert durch unsere Erlebnisse in Monterey im vorangegangenen Jahr entschlossen wir uns, das erste Florida-Musikfestival auf die Beine zu stellen. Es sollte unter freiem Himmel stattfinden, sich über mehrere Tage erstrecken und eine große Bandbreite an Künstlern präsentieren – ähnlich wie in Monterey. Meine Küche fungierte als Büro, und wir gründeten eine Gesellschaft namens Joint Productions, an der sich auch ein Drummer namens James Baron und mein Freund, der Rechtsanwalt Barry Taran, beteiligten. Nachdem The Grateful Dead im April drei Tage hintereinander im Three Image aufgetreten waren, rief mich der Inhaber des Clubs – ein etwas zwielichtiger Typ namens Marshall Brevitz – an und sagte, dass er sich ebenfalls beteiligen wolle.