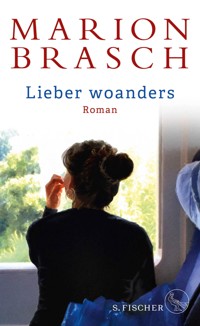Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Marion Brasch nach ›Ab jetzt ist Ruhe‹ »Wunderlich war der unglücklichste Mensch, den er kannte.« Als Marie ihn verlässt, versinkt er in Selbstmitleid. Doch schon bald schubst ihn eine anonyme SMS zurück ins Leben, und Wunderlich tritt eine Reise an. Eine Reise, die vieles verändert und bei der nicht alles mit rechten Dingen zugeht. ›Wunderlich fährt nach Norden‹ ist die Geschichte eines Mannes, der Entscheidungen scheut und sich dem Zufall überlässt. Auf seiner Fahrt wird Wunderlich zum Abenteurer. Doch vor allem entdeckt er, was er vergessen wollte, und findet, was er nicht gesucht hat. Dieser Roman ist eine Liebeserklärung an die sonderbaren Momente des Lebens – so leicht, komisch und berührend, wie uns diese Geschichte nur Marion Brasch erzählen kann.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Brasch
Wunderlich fährt nach Norden
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Etwas hört auf, und etwas beginnt
Wunderlich war der unglücklichste Mensch, den er kannte. Er kannte zwar nicht viele Menschen, doch was spielt das für eine Rolle, wenn das Unglück größer ist als man selbst. Wobei das eigentlich nicht stimmte, denn Wunderlichs Unglück war etwa einen Kopf kleiner als er und hieß Marie.
»Es geht nicht«, hatte sie gesagt. »Wir können nicht zusammen sein.«
»Warum denn nicht? Ich hab dich doch lieb, Marie.«
»Ich weiß, Wunderlich. Ich hab dich auch lieb. Aber während deine Liebe von hier bis ganz dort hinten reicht, kommt meine nur bis ungefähr da.«
Sie hatten auf dem Dach des Hauses gesessen, in dem Wunderlich wohnte, und Marie hatte erst über die anderen Dächer hinweg auf den Horizont gezeigt und dann auf das Haus gegenüber, wo ein dicker Mann im Unterhemd auf dem Balkon stand und rauchte.
»Bis zu ihm?«
»Nein, nicht bis zu ihm. Das war nur eine Metapher.«
Dann hatten sie geschwiegen. Sehr lange. Wunderlich hatte Marie von der Seite angeschaut, doch er konnte sie nicht gut erkennen, weil seine Augen voller Wasser waren.
Irgendwann war Marie aufgestanden und hatte ihn umarmt. »Mach’s gut, Wunderlich«, hatte sie gesagt. »Ich wünsch dir Glück.« Dann war sie gegangen.
Das war jetzt zwei Stunden her. Wunderlich saß noch immer auf seinem Dach und konnte es nicht fassen. Sein größtes Glück hatte sich durch einen einzigen Satz in sein größtes Unglück verwandelt und ihm Glück gewünscht. Das ergab überhaupt keinen Sinn.
»Marie, das ergibt überhaupt keinen Sinn«, sagte er in die Nacht. »Schnauze!«, antwortete die Nacht aus einem geöffneten Fenster im Haus gegenüber. Sonst wusste sie nichts dazu zu sagen.
Wunderlich schüttelte traurig den Kopf und war gerade aufgestanden, um zu gehen, als das Telefon in seiner Hosentasche brummte. Marie! Sie hatte es sich bestimmt anders überlegt und wollte, dass er zu ihr kam. Doch es war nicht Marie. Es war anonym. Für gewöhnlich zeigte das Telefon einen Namen oder wenigstens eine Nummer an, wenn es Nachrichten übermittelte. Doch da stand nur Anonym. Und Anonym hatte ihm eine Nachricht geschickt.
Guck nach vorn.
Mechanisch folgte Wunderlich dieser Aufforderung und schaute nach vorn. Im Haus gegenüber waren inzwischen alle Lichter erloschen, und die Stadt führte ihre üblichen schlaflosen Selbstgespräche.
»Warum tust du das, Marie?«, wandte er sich traurig an sein Telefon und wollte es gerade wieder in seine Hosentasche stecken, als es erneut brummte.
Ich bin nicht Marie.
Er traute seinen Augen nicht. Wie war das möglich? Er schaltete das Telefon aus und wieder ein.
Lass den Quatsch, Wunderlich.
»Jetzt bin ich nicht nur unglücklich, sondern verliere auch noch den Verstand«, jammerte er und schaute besorgt auf die Flasche Rotwein neben sich. Sie war leer. Er schüttelte den Kopf und seufzte tief, dann kletterte er vom Dach, ging hinunter in seine Wohnung, legte sich ins Bett und schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen wurde Wunderlich von den Kirchturmglocken geweckt. Es war Sonntag, und sonntags taten die Glocken immer so, als sei der Tag des Jüngsten Gerichts gekommen. An diesem Morgen hatten sie sich jedoch auch noch Zugang zu seinem Schädel verschafft, wo sie dröhnten, grollten, hämmerten und tosten. Er hielt seinen Kopf zwischen den Händen fest, bis es vorbei war. Ganz langsam quälte sich die Erinnerung an die vergangene Nacht durch den dumpfen, grauen Nebel hinter seiner Stirn: Marie. Fort. Unglück.
Wunderlich stand auf, schleppte sich in die Küche, füllte ein Glas mit kaltem Wasser, trank es aus, füllte ein weiteres Glas und trug es zu seinem Bett. Als er sich gerade wieder hinlegen wollte, brummte das Telefon auf seinem Nachttisch.
Das würde ich an deiner Stelle nicht tun.
Er ließ das Telefon fallen. Es war also nicht der Rotwein, der seine Wahrnehmung getrübt hatte. Vielleicht habe ich einen Nervenzusammenbruch, dachte er. Oder ich werde wahnsinnig. Andere hören Stimmen, ich lese eben Kurznachrichten. – Ihn schauderte. Er legte sich ins Bett, zog die Decke über den Kopf und wartete darauf, dass die Sturzbäche, die plötzlich aus seinen Augen schossen, wieder versiegten. Es dauerte lange. Sehr lange.
Als es vorbei war, setzte er sich auf die Bettkante. Zu seinen Füßen lag das Telefon. Vorsichtig schob er es mit seinem großen Zeh ein Stück von sich weg.
Nichts.
Er streckte seinen Fuß, zog das Telefon wieder zu sich heran und kickte es beherzt etwas weiter weg.
Keine Reaktion.
Wunderlich hob das Telefon auf und knallte es mit einer übermütigen Bewegung auf sein Bett. Aus dem Brummen, das nun folgte, meinte er einen leicht genervten Unterton herauszuhören. Vorsichtig nahm er das Telefon wieder in die Hand.
Bist du bald fertig?
»Wer zum Teufel bist du?«
Sag ich nicht.
»Aber du mischst dich in mein Leben ein, da hab ich ja wohl ein Recht darauf zu erfahren, wer du bist!«
Kann schon sein, ich sag’s dir trotzdem nicht.
»Aber was willst du von mir?«
Weiß ich noch nicht.
»Du weißt es nicht?«
Nö.
»Aber warum ich? Du kennst mich doch gar nicht.«
Nein? Na, dann pass mal auf. Du bist Wunderlich, 43 Jahre alt, geschieden und hast einen siebzehnjährigen Sohn, den du vor elf Jahren zum letzten Mal gesehen hast. Du wolltest mal Bildhauer werden, musstest deinen Traum aber wegen einer chronischen Sehnenscheidenentzündung aufgeben. Seitdem machst du Gelegenheitsjobs und gibst privat Zeichenunterricht. Als du zwei warst, bist du mit dem Dreirad gegen einen Gartenzaun gefahren, davon hast du die kleine Narbe auf der rechten Seite deiner Stirn. Du findest Sülze eklig und kannst vor elf Uhr vormittags keine feste Nahrung zu dir nehmen. Du bist wehleidig, schnell eingeschnappt und ganz schön nachtragend. Du hast Phantasie, bist aber meist zu faul, etwas daraus zu machen, weswegen du dich für langweilig und durchschnittlich hältst. Du bist gegen ziemlich alles allergisch außer gegen Deutsche Eiche. Vor sechs Jahren hast du das Rauchen aufgegeben und rennst aus panischer Angst davor, fett zu werden, täglich durch den Park. Außer, wenn du Liebeskummer hast. Oder einen Kater. Oder beides. Und du siehst mit offenem Mund ziemlich bekloppt aus.
Wunderlich schloss den Mund, um ihn sofort wieder für ein erregtes »Woher weißt du das alles!?« zu öffnen.
Keine Antwort.
»Hallo?«
Das Telefon schwieg.
Er schaltete es aus und wieder ein.
Nichts.
Er entfernte den Akku und setzte ihn wieder ein.
Das Display blieb dunkel.
Wunderlich kapitulierte und ging ins Bad. Das Telefon nahm er mit. »Wegen Marie«, sagte er. »Nicht wegen dir.«
Zwanzig Minuten später saß er geduscht am Tisch und schlürfte seinen Kaffee. Vor ihm lag das Telefon. Spuk, dachte er. Alles nur ein böser Spuk. Er nahm es in die Hand und wollte gerade Maries Nummer wählen, als es ihm mit einem fordernden Brummen zuvorkam.
Keine gute Idee.
»Ach, leck mich doch«, knurrte Wunderlich und wählte Maries Nummer.
»Wunderlich«, sagte Marie.
»Marie«, sagte er.
Sie schwiegen eine Weile.
»Ich will nicht, dass es vorbei ist«, sagte er irgendwann.
»Ich weiß. Aber so ist es nun mal.«
»Du bist grausam, Marie.«
»Ja, das bin ich wohl. Und das tut mir auch sehr leid.«
»Aber können wir nicht …«
»Nein, Wunderlich. Wir können nicht.«
Dieser große Kloß in seinem Hals.
»Wunderlich?«
Und schon wieder so viel Wasser in seinen Augen.
»Ich leg jetzt auf«, sagte Marie.
Es tat so weh.
»Mach’s gut, Wunderlich.«
Marie legte auf.
Er weinte. Er versuchte sich zu erinnern, wann er das letzte Mal so viel geweint hatte. Er war keine Heulsuse, das hatte er seiner Mutter zu verdanken. Sie war eine strenge Frau gewesen und hatte ihn gelehrt, sich zusammenzureißen. »Nimm dir ein Beispiel an deiner großen Schwester«, hatte sie immer wieder gesagt. »Sie ist ein Mädchen und heult trotzdem nie.« Und es stimmte. Wunderlich hatte seine Schwester nur einmal weinen sehen. Das war bei der Beerdigung des Vaters, der an seinem kranken Herzen gestorben war. Die Augen seiner Mutter waren trocken geblieben, doch seine große, starke Schwester hatte geheult wie ein Schlosshund. Er hatte sich zusammengerissen, den Kloß in seinem Hals hinuntergeschluckt und die Hand seiner Schwester genommen. Da war er das einzige Mal größer und stärker gewesen als sie.
Das Telefon brummte.
16. Februar 1991. Im Kino.
»Was?« Wunderlich starrte ein weiteres Mal fassungslos auf sein Telefon.
Da hast du zuletzt geweint.
Marie hatte ihn verlassen, das war schlimm. Doch Menschen verließen einander, so war nun mal das Leben. Hingegen ein Fremder, der mehr über ihn wusste als jeder andere? Der sogar seine Gedanken lesen konnte? Das widersprach jeder Logik, und Dinge, die der Logik widersprachen, waren ihm suspekt.
Wunderlich seufzte und schaute gedankenverloren aus dem Fenster, hinter dem die Stadt in der Mittagshitze döste. Auf dem Balkon gegenüber stand diesmal die dicke Frau des Unterhemdmannes. Sie goss Blumen, während eine fette Katze um ihre Beine strich. Vielleicht war das Leben dieser Frau genauso trostlos wie seins, doch sie hatte wenigstens einen Mann und eine Katze. Und er? Er hatte Liebeskummer und ein klugscheißendes Telefon. Aber vielleicht war das besser als gar nichts. Vielleicht sollte er einfach akzeptieren, dass es so war. Und vielleicht würde ihn die Gesellschaft von Anonym ja sogar auf andere Gedanken bringen.
Das Telefon brummte.
Die Frau da drüben wird bald eine kleinere Summe im Lotto gewinnen und sich von dem Geld das Fett absaugen lassen.
Wunderlich nahm sich vor, dieser Information nicht mehr Bedeutung beizumessen als dem Wetterbericht.
»Und dann?«, fragte er so gelangweilt wie möglich.
Nichts. Ihr Mann wird es nicht bemerken.
»Bist du Gott oder so was?«
Nö. Aber du darfst mich gern so nennen, wenn du willst.
»Vergiss es.«
Wunderlich stand auf und ging in die Küche, um zu testen, wie sein Magen reagieren würde, wenn er einen Blick in den Kühlschrank warf. Zwei Eier, Salami, ein halber Becher Fruchtquark. Sein Magen blieb ruhig, also schlug er die Eier in eine Pfanne, schmierte sich ein Salamibrot und kochte frischen Kaffee.
Während er aß, schaute er wieder aus dem Fenster. Der Balkon gegenüber war verwaist. Vielleicht sollte man der dicken Frau einen Tipp geben, dachte er. Oder ihrem Mann.
Kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram. Wie wär’s zum Beispiel mit einer Luftveränderung?
»Ich finde, die Luft kann so bleiben, die ist okay«, schmatzte Wunderlich.
Dann eben nicht.
»Prima«, sagte Wunderlich und schlürfte seinen Kaffee. Dabei ließ er das Telefon nicht aus den Augen, doch Anonym schwieg.
Er steckte das Telefon mit einem übertrieben gelangweilten Gesichtsausdruck in die Hosentasche, trug das Geschirr in die Küche und stellte es ins Abwaschbecken. »Hab ich wenigstens meine Ruhe«, knirschte er und drehte den Wasserhahn auf. »Kann ich mich schön wieder ins Bett legen und schlafen«, sagte er etwas lauter. »Nach vorn gucken und schön geradeaus schlafen!«, rief er aus. Er drehte den Hahn zu, trocknete sich betont langsam die Hände ab und holte das Telefon aus seiner Tasche. Keine Nachricht. Dafür drang wie zum Hohn das lustvolle Stöhnen einer Frau durch das zum Hinterhof geöffnete Küchenfenster. Vielleicht ist Luftveränderung doch keine so schlechte Idee, dachte Wunderlich und schloss das Fenster. Er überlegte, wann er das letzte Mal verreist war. Es fiel ihm sofort ein: vor drei Monaten. Ans Meer. Mit Marie. Das Meer fiel also aus. Vielleicht musste er das Gegenteil von dem tun, was er mit Marie getan hatte. Und das Gegenteil vom Meer waren die Berge. Doch Wunderlich hasste die Berge. Auch das hatte er seiner Mutter zu verdanken, die ihn und seine Schwester in stundenlangen Wanderungen durchs Gebirge gehetzt hatte. Sein Vater hatte sich dieser Qual jedes Mal unter dem Vorwand entzogen, die dünne Luft da oben sei nichts für sein krankes Herz, und war zu Hause geblieben, worauf ihn seine Frau einen Simulanten und Schlappschwanz geschimpft hatte.
Wunderlich konnte den Orgasmus der Frau sogar durch die geschlossenen Doppelfenster hören. Er verdrehte die Augen. Er musste hier weg, das war klar. Erst einmal laufen. Sein Kopf war verkleistert von Kater und Tränen und wirr von den Merkwürdigkeiten des Vormittags. Da musste Luft ran und Luft durch. Also zog er seine Sportsachen an, steckte das Telefon ein und verließ seine Wohnung.
Der Nachmittag lag träge in den Straßen. Es hatte seit Wochen nicht geregnet, und obwohl es erst Ende Juli war, begann sich das Laub an den Bäumen schon zu verfärben. Die Stadt war in den Ferien wie ausgestorben, und wer keine Ferien hatte, drängte sich mit Millionen anderen an den Ufern der Seen am Stadtrand oder auf den Wiesen der Freibäder.
Wunderlich atmete tief ein, lief los und überholte eine kleine alte Frau, die tapfer ihren Rollator vor sich herschob. Es war Oma Zeisig aus dem ersten Stock, die ihre tägliche Nachmittagsrunde drehte. Nach Oma Zeisig konnte man die Uhr stellen. Sie ging zweimal, morgens um acht und nachmittags um drei, und das bei jedem Wetter. Nach ihrem Spaziergang trank sie beim Bäcker einen Kaffee, nachmittags gab es ein Stück Kuchen dazu.
Oma Zeisig war eine der Letzten ihrer Art, denn man sah kaum noch alte Leute in der Gegend. Sie waren entweder gestorben oder weggezogen. Oma Zeisig war hiergeblieben. Und wie er lebte sie im einzigen Haus der Straße, das aus der Zeit gefallen schien mit seiner bröckelnden, grauen Fassade. Das Treppenhaus roch nach Keller, der Keller roch nach Rattenkot, und unterm Dach nisteten die Tauben.
Oma Zeisig war eine stille Frau. Wenn Wunderlich ihr auf der Treppe begegnete, half er ihr mit dem Rollator. Dann bedankte sie sich leise, tätschelte mit ihrer durchsichtigen Hand die seine und nannte ihn »mein Junge«. Er wusste nicht viel über sie. Die Bäckersfrau hatte einmal erzählt, sie sei beim Zirkus gewesen. Irgendetwas mit Pferden. Wunderlich fand Zirkuspferde blöd, doch Oma Zeisig mochte er.
Er ließ die alte Frau weit hinter sich und lief. Die Straße hinunter, über die Kreuzung, die Straße weiter und in den Park hinein, am Spielplatz vorbei, dreimal um den Teich und den Berg hinauf, den er den Mörderberg nannte. Der Berg war nicht sehr hoch und der Weg nach oben nicht besonders anstrengend, doch das Wissen, einen Mörderberg bezwungen zu haben, gab ihm ein Gefühl von Überlegenheit und Stärke.
Auf dem Weg nach oben kam ihm eine Läuferin entgegen, die er fast täglich im Park traf. Sie war sehr hübsch und hatte eine tolle Figur in ihrem engen schwarzen Sportdress. Doch jedes Mal, wenn sie ihm entgegenkam, hielt er die Luft an, weil sie eine Schweißfahne hinter sich her zog, die ihresgleichen suchte. Selbst schwerster Männerschweiß konnte nicht dagegen anstinken. Außerdem war ihr Blick so finster, als stünde das Ende der Welt kurz bevor. Wunderlich hielt die Luft an, bis sie weit genug weg war, dachte an Marie und daran, wie gut sie gerochen hatte. Überall. Und er redete sich ein, es sei der Mörderberg, der ihm schon wieder die Tränen in die Augen trieb.
Oben auf dem Berg war Wunderlich allein. Er streckte sich, machte ein paar Dehnungsübungen, legte sich in den Schatten eines Baumes und schloss die Augen. Ein gutmütiger Wind strich über seine Stirn, die Vögel zwitscherten, und mit etwas Phantasie konnte man den fernen Sonntagsverkehr auch für Meeresrauschen halten. Er döste und wollte gerade in ein weiches Nichts hinübergleiten, als sich das Telefon in seiner Hosentasche meldete.
Läuft wie ein Reh, stinkt wie ein Eber.
Anonym.
»Du schon wieder«, sagte Wunderlich und gähnte gekünstelt, um zu verbergen, dass er sich ein bisschen freute. »Was meinst du?«
Die Frau eben. Ein Widerspruch auf zwei Beinen.
»Ja. Und?«
Sie hat auch Liebeskummer.
»Prima. Und?«
Das Horoskop hat ihr heute früh eine Flugreise prophezeit. Sie hat Last Minute gebucht und fliegt morgen nach Mallorca.
»Ein Horoskop. Toll. Und weiter?«
Sie guckt nach vorn.
»Sie guckt nach vorn?« Wunderlich lachte höhnisch und zeigte dem Telefon einen Vogel. »Du hast sie doch nicht mehr alle. Sie ist abergläubisch und macht, was ein blödes Horoskop ihr sagt. Das ist doch total bescheuert.«
Sie tut wenigstens was, während du in Selbstmitleid ersäufst.
»Jaja. Quatsch du nur«, sagte Wunderlich grimmig und steckte das Telefon in die Tasche. »Horoskop. So ein Schwachsinn. Ich brauch kein Horoskop, das mir sagt, wo’s langgeht.«
Er atmete tief ein und lief den Berg hinunter. – Mallorca. In den Ferien. Mit schlecht riechenden Frauen. Das kam überhaupt nicht in Frage. – Er ließ Spielplatz und Teich hinter sich. – Und warum sollte er überhaupt so weit weg? Er könnte ja auch mit dem Zug irgendwohin fahren, wo es schön war. – Er lief aus dem Park, die Straße hinunter. – Und warum musste es überhaupt schön sein? Wo es schön war, lungerten ja immer alle herum. – Über die Kreuzung, die Straße entlang. – Aber es ging ihm schlecht, da sollte es wenigstens schön sein. Nur ohne viele Leute.
Zu Hause angekommen, duschte Wunderlich und kochte sich einen Kaffee. Er hatte einmal einen Film gesehen, in dem ein Mann mit dem Zug nach Finnland fuhr. Ein einsamer Mann in einer melancholischen Landschaft. Ich bin auch einsam und melancholisch, dachte er, zog seinen alten Schulatlas aus dem Bücherregal und legte ihn vor sich auf den Tisch. Finnland ist gut, dachte er und schlug die Nordeuropa-Karte auf. Nicht so weit weg, aber weit genug. Außerdem hatte er in letzter Zeit genug verdient, dass er sich einen Urlaub würde leisten können. Oder lieber Norwegen? Sein Freund Hans fuhr jeden Sommer nach Norwegen zum Angeln. »Kopf leerfischen« nannte er das. Einmal hatte er ihn mitgenommen, doch während Hans alle paar Minuten irgendetwas aus dem Wasser zog, fing Wunderlich keinen einzigen Fisch. Und während sein Freund seinen Kopf leerfischte, füllte sich der seine mit schlechter Laune und lärmendem Heimweh.
»Die Fische spüren deine Unruhe, deshalb beißen sie nicht«, hatte Hans damals gesagt. »Das ist wie mit den Frauen.«
Wunderlich fand diese These zwar zweifelhaft, doch der Erfolg gab seinem Freund recht. So wie sich dessen Eimer mit schönem Fisch füllte, mehrten sich in seinem Adressbuch die Namen schöner Frauen. Manchmal hatte Hans sogar bis zu drei Frauen gleichzeitig, ohne dass sie voneinander wussten. Wunderlich redete sich ein, so ein Leben sei nichts für ihn, doch insgeheim hatte er seinen Freund immer beneidet. Bis Marie zu ihm kam. Seitdem hatten Hans und er sich kaum noch gesehen. »Macht ihr mal«, war die einsilbige Antwort seines Freundes, wenn Wunderlich sich mit ihm verabreden wollte. Er ahnte, dass Hans eifersüchtig war, nur wusste er nicht, ob auf Marie oder auf ihn. Und irgendwann hatte er aufgehört, Hans anzurufen.
Doch jetzt war Marie nicht mehr da. Hatte ihn sitzenlassen. Auf seinem eigenen Dach. Einfach so. – Er nahm einen großen zornigen Schluck aus seiner Kaffeetasse, und als er sie wieder auf den Tisch knallte, schwappte etwas Kaffee auf den Atlas und bildete im Atlantik westlich von Norwegen eine interessante Inselformation. Mit grimmiger Miene schaute er zu, wie ein beachtlicher Ausläufer der Insel langsam über den Polarkreis kroch, um sich kurz darauf mit den Lofoten zu vereinen. Wunderlich hielt ihn nicht auf. Und ihn würde auch nichts aufhalten. Er würde weggehen und Marie vergessen. Und wenn sie irgendwann bereuen und um ihn weinen würde, wäre es zu spät.
Er richtete sich auf und straffte seinen Oberkörper, als könne er damit sich und der Welt beweisen, wie ernst es ihm war mit seinem Entschluss. Doch die Welt war da draußen und kümmerte sich nicht um ihn. Da war nur das Telefon auf dem Tisch, das sich nervös in sein Bewusstsein zurückdrängte.
Pass auf, du Pfeife!
Der Kaffeestrom hatte die Lofoten inzwischen passiert, unbeeindruckt eine Schneise in den Ozean gelegt und tropfte jetzt sehr entschlossen aus der Atlaswelt hinunter auf den Tisch. Dort ergoss er sich in einen hübschen kleinen See, an dessen Nordufer das Telefon eine Art Staudamm bildete.
Wunderlich stöhnte, holte einen Lappen aus der Küche und beendete das Schauspiel.
Wurde ja auch Zeit. Oder willst du mich umbringen?
»Keine schlechte Idee«, sagte Wunderlich und trocknete das Telefon ab. »Aber das geht nicht, oder?«
Keine Ahnung.
»Keine Ahnung?« Wunderlich runzelte die Stirn. »Du weißt, wer ich bin, du kannst meine Gedanken lesen, du kannst die Zukunft anderer Leute vorhersagen, aber du weißt nicht, ob man dich töten kann? Das versteh ich nicht.«
Musst du auch nicht.
»Das ist verrückt.«
Total verrückt.
Wunderlich dachte nach.
»Und wenn ich dich einfach nicht mitnehme auf meine Reise? Dann wärst du doch gewissermaßen tot, oder?«
Kann schon sein. Aber ohne dein Telefon gehst du sowieso nirgendwohin.
Anonym hatte recht. Ohne sein Telefon war Wunderlich aufgeschmissen. Er hatte sich lange dagegen gewehrt, eines zu besitzen, weil er nicht gern telefonierte, doch für seine Schüler musste er erreichbar sein. Und kaum hatte er das Telefon, wollte er nicht mehr darauf verzichten. Es wurde ihm Wecker und Pizzaservice, Arbeitsvermittler und Liebesbote – ein Kompass durch sein seltsames Wunderlich-Leben. Und jetzt war es das Zuhause von Anonym, und Anonym schien gerade der einzige Freund zu sein, den er hatte.
»Na gut«, sagte er. »Ich nehme dich mit.«
Wunderlich hatte noch nie eine Reise gemacht, deren Ziel er nicht kannte. So planlos er sich auch durch sein Leben treiben ließ, so unheimlich war es ihm, nicht zu wissen, wo er die nächste Nacht verbringen würde. Eigentlich verreiste er überhaupt nicht gern. Er war davon überzeugt, dass man fremde Länder und Landschaften auch sehr gut kennenlernen konnte, ohne sie persönlich zu besuchen. Es gab tolle Bildbände und interessante Dokumentationen im Fernsehen, und ein Roadmovie oder die Geschichte eines Abenteurers gaben ihm tausendmal mehr, als selbst schwitzend in Überlandbussen zu sitzen oder stundenlang auf irgendwelchen Flughäfen herumzulungern. Ganz abgesehen von den Krankheiten, die man sich unterwegs einfangen konnte. Wunderlich wusste, dass er ein Langweiler war, doch das war ihm egal. Bis jetzt. Diesmal würde er eine Reise machen, bei der alles dem Zufall überlassen bliebe. Er hatte vier Wochen Zeit, genügend Geld und nichts zu verlieren.
Mit einer pathetischen Geste klappte er den Atlas zu und ging in den Keller, um sein altes Zelt zu holen. Er hatte es nur einmal benutzt, und das war jetzt fünfundzwanzig Jahre her. Damals war er mit zwei Freunden in einem alten Kombi durch Europa gefahren und hatte in Frankreich eine hübsche Holländerin kennengelernt. Sie war drei Jahre älter als er, hatte maisgelbes Haar und einen leichten Überbiss. Am Tag brachte sie ihm holländische Flüche bei, und nachts weihte sie ihn in die Kunst der lautlosen Liebe ein. In jenem Zelt.
»Godverdomme«, fluchte Wunderlich, als er sich im engen Keller durch sein halbes Leben wühlte. Er hatte irgendwann aufgehört, den Dingen hier eine Ordnung zu geben und sie einfach nur noch abgestellt oder hineingeworfen. Sein Zelt fand er ziemlich weit hinten, begraben unter einem kaputten Staubsauger und einem Karton mit alten Gipsabdrücken.
Jetzt trage ich meine Vergangenheit in die Zukunft, dachte Wunderlich, als er die Treppe hinaufstieg. Er fand den Gedanken seltsam, doch das Gefühl, einen alten Gegenstand in ein neues Abenteuer mitzunehmen, hatte etwas Beruhigendes.
Er trug das Zelt aufs Dach und breitete es aus. Es roch etwas muffig, schien aber sonst in Ordnung zu sein. Nachdem er es zum Lüften über einen Schornstein gelegt hatte, blinzelte er in die Sonne, die sich langsam senkte und warmes Licht über die Dächer der Stadt goss, die er bald verlassen würde.
»Ich verlasse die Stadt«, sagte Wunderlich feierlich. Als könnte der Satz nur wahr werden, wenn er ihn wirklich aussprach.
ICH VERLASSE DIE STADT, schrieb er auf ein Blatt Papier und notierte die Dinge, die er für die Reise brauchen würde.
Ich verlasse die Stadt, kritzelte er auf eine Zeitschrift, als er im Thai-Imbiss auf seine Suppe wartete.
Er steckte das Heft zurück in den Zeitschriftenhalter neben seinem Stehtisch und beobachtete einen Gast, der es sich nahm und das Cover studierte. Keine Regung im Gesicht des Mannes, vermutlich hatte er den Satz überlesen. Wunderlich griff sich eine weitere Zeitschrift und schrieb die Worte mit größeren Lettern quer über das üppige Dekolleté einer bekannten Popsängerin.
»Interessant!« Eine hochgewachsene Frau stand plötzlich neben ihm und schaute belustigt auf das Bild. »Und wie soll die Stadt mit diesem Verlust leben?«
Wunderlich spürte, wie er errötete. Er kannte die Frau, sie wohnte in seiner Straße, und bevor er mit Marie zusammengekommen war, hatte er sich manchmal vorgestellt, wie es wäre, sie anzusprechen. Doch sie war die Sorte Frau, die auch an der Seite eines Mannes, der kleiner war als sie, hochhackige Schuhe tragen würde. Wunderlich würde sie zwar trotzdem überragen, aber das spielte keine Rolle. Frauen wie sie waren immer zu groß, immer zu schön und immer unerreichbar. Und jetzt schaute sie ihn mit einem spöttischen Blick an, dem er sich glücklicherweise entziehen konnte, weil in diesem Augenblick die Nummer seiner Suppe aufgerufen wurde. Wunderlich drängte sich an der Frau vorbei, holte seine Suppe ab und setzte sich draußen an einen freien Tisch. Er aß und beobachtete dabei eine Familie, die einem dieser geräumigen Vans entstieg, von denen es in seiner Gegend inzwischen viele gab. Vater, Mutter, zwei kleine Mädchen, Zwillinge. Fluchend zerrte der Mann den Doppelkinderwagen aus dem Kofferraum, während die Frau genervt die beiden schreienden Kinder zu beruhigen versuchte.
Sein Telefon brummte.
Sie werden sich scheiden lassen. Sie behält die Kinder, wird drei Jahre später wieder heiraten und in eine andere Stadt ziehen, wo sie auch nicht glücklich wird. Ihr neuer Mann betrügt sie, sie fängt an zu trinken und vernachlässigt die Kinder, worauf sie dem Vater zugesprochen werden. Sie nimmt eine Überdosis Tabletten und aus die Maus.
»Scheiße«, sagte Wunderlich.
So ist das Leben.
»Könnte man nicht verhindern, dass sie das andere Arschloch kennenlernt?«
Könnte man, geht uns aber nichts an.
Die Frau setzte die Mädchen in den Kinderwagen, und als sie sich wieder aufrichtete, sah sie zu ihm herüber. Er lächelte unsicher und nickte, sie lächelte zurück. So, als wollte sie sich für irgendetwas bei ihm entschuldigen. Ihm lief ein Schauer über den Rücken, er schaute schnell wieder weg.
Willst du auch wissen, wie es mit ihrem Mann weitergeht?
»Ich weiß nicht.«
Er bekommt vier weitere Kinder mit einer anderen Frau. Er verliert seinen gutbezahlten Architektenjob, kann sich aber von der Abfindung und ein paar Ersparnissen eine kleine Tischlerwerkstatt einrichten, um in dem Beruf zu arbeiten, den er mal gelernt hat. Er führt ein einfaches, aber glückliches Leben und wird steinalt mit einem Dutzend Enkeln und doppelt so vielen Urenkeln.
»Schön.«
So ist das Leben.
Wunderlich schlürfte seine Suppe und schaute der Familie hinterher, die im gegenüberliegenden Hauseingang verschwand. Es war ein seltsames Gefühl, in die Zukunft wildfremder Menschen schauen zu können, aber nicht zu wissen, was sein eigenes Leben noch für ihn bereithalten würde. Und irgendetwas sagte ihm, dass es sinnlos war, Anonym danach zu fragen. Und überhaupt, wollte er das wirklich wissen? Ja. Nein. Vielleicht ein bisschen.
Nachdenklich trug Wunderlich seine Suppenschüssel in den Laden und musterte aus den Augenwinkeln die hochgewachsene Frau, die mit den Stäbchen in ihrer schlanken Hand gerade gekonnt ein paar Nudeln vom Teller hob. Vermutlich konnte sie alles in Perfektion, und vermutlich würde sie mit diesen perfekt lackierten Fingernägeln später mal in einem sehr geschmackvollen Sarg liegen, nachdem sie einen eleganten Tod gestorben war. Das Telefon hüllte sich diesmal in Schweigen.
Wunderlich bezahlte und schlenderte nach Hause. Aber Marie. Was würde aus Marie werden? Kaum hatte er diese Frage gedacht, brummte sein Telefon. Diesmal war es jedoch nicht Anonym, sondern ein Zeichenschüler, der wissen wollte, wann der nächste Kurs begann.
»Ich verlasse die Stadt«, sagte Wunderlich.
»Oh. Warum denn das?«
Wunderlich meinte, Bestürzung in der Stimme des Schülers zu hören. »Nur so«, beeilte er sich zu sagen. »Ich komme ja wieder.« Der Schüler schien erleichtert. Ach so, na dann. Es habe sich so endgültig angehört. – Wunderlich versprach, sich zu melden, wenn er wieder da sei, und legte auf. Es erfüllte ihn mit Genugtuung, dass sein Schüler sich offenbar Sorgen gemacht hatte. Nur kurz, aber immerhin. Wenigstens einer, dachte er und seufzte.
Zu Hause holte er das Zelt vom Dach. Es roch nach Sonne und trockenem Gras – ein Duft, der ihn augenblicklich in ein Hochgefühl versetzte. Er legte die Platte seiner Lieblingsband auf, und während diese ihre wütenden Gitarren durch seine Wohnung peitschte, lief er hin und her und packte.
In der Nacht träumte er schlecht. Er saß auf einem Stuhl in einem weißgetünchten Zimmer ohne Fenster. Außer ihm befanden sich zwei Personen in diesem Zimmer, die ihm fremd waren. Auf dem Stuhl rechts von ihm saß ein Mann mit Hut und zu seiner Linken eine ältere Frau mit bleichem Gesicht. Der Mann neutral, die Frau unangenehm. Überall in dem Zimmer verteilt standen Gepäckstücke herum: Koffer, Reisetaschen, Rucksäcke. Irgendwann stand der Mann auf und erklärte, er werde gehen und jemanden suchen, der sich um das Löwenbaby kümmerte, das plötzlich in Wunderlichs Arm lag und sich ängstlich an ihn schmiegte. Der Mann nahm einen der herumstehenden Koffer und verließ das Zimmer. Die Frau neben ihm rührte sich nicht, und obwohl er sie nur von der Seite sehen konnte, wusste er, dass sie kalte Augen hatte. Nach einer Ewigkeit kehrte der Mann zurück. Ohne Koffer, doch dafür mit einer Pistole in der Hand. Er richtete sie auf das Löwenbaby und erschoss es. Wunderlich spürte noch das warme Blut des Tieres auf seiner Haut, dann wachte er auf. Schweißgebadet.
Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt einen Albtraum hatte. Manchmal träumte er von seiner Mutter, die vor zwei Jahren gestorben war. Sie war dement gewesen und hatte zum Schluss in einem Heim gelebt, wo er sie nur selten besuchte. Nachdem sie tot war, schaute sie alle paar Monate in seinen Träumen vorbei, ging schlechtgelaunt darin umher und machte ihm Vorwürfe, dass er sich nicht genügend um sie kümmerte.
Wunderlich ging ins Bad, trank kaltes Wasser aus der Leitung, kühlte sein Gesicht, legte sich wieder ins Bett und starrte an die Decke. Die Kirchturmglocke schlug vier Uhr, und er war hellwach. Was zum Teufel hatte der Traum zu bedeuten? Und was hatte der Löwe darin zu suchen? Wunderlich hatte zuletzt einen im Fernsehen gesehen, in einem Dokumentarfilm über die westafrikanische Steppe. Und auch sonst hatte er mit Tieren nicht viel zu schaffen. Als kleiner Junge hatte er mal zwei Mongolische Rennmäuse besessen, die ihn jedoch bald langweilten, weil sie tagsüber meist schliefen. Er verlor das Interesse an den Nagern, bis eines Tages im Käfig der vermeintlichen Mäusebrüder neun nackte, blinde und über die Maßen hässliche Rennmausbabys lagen. Seine Mutter schrie auf, als sie die Brut entdeckte, und als Wunderlich aus der Schule nach Hause kam, waren die Tiere fort. Alle. Seine Mutter erklärte ihm, sie habe sie in ein Tierheim gebracht, wo man sich besser um sie kümmern könnte. Seine Schwester verriet ihm später, die Mutter habe die Mäusefamilie einem Bekannten überlassen, der als Pfleger im Schlangenhaus des Tierparks arbeitete. Wunderlichs Trauer über den Verlust der Mäuse hielt sich in Grenzen, doch der kühle Pragmatismus seiner Mutter erschütterte ihn zutiefst.
Er versuchte, sich ihr Gesicht vorzustellen. Es war das Gesicht einer alten Frau, die in ihrem Leben nur selten gelächelt hatte. Ein vergrämtes Gesicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln und kleinen, argwöhnischen Augen. Ein Gesicht, von dem man sich kaum vorstellen konnte, dass es einmal jung gewesen war und von Sehnsucht sprechen konnte. Wunderlich drehte sich auf die Seite und suchte nach einem anderen Gesicht. Er fand es.
»Ach, Marie«, flüsterte er. Dann schlief er ein.
»Ach Marie«, sollte Wunderlich in den nächsten Tagen noch sehr oft sagen. Dabei gebrauchte er die Worte in den verschiedensten Tonlagen, Lautstärken und Gemütszuständen. Er seufzte sie, als er zärtlich den kleinen Holzaffen streichelte, den Marie ihm einmal geschenkt hatte. Er murmelte sie, als er nachts vor ihrem Haus hin und her ging. Er setzte sie zornig unter den Brief, den er ihr schrieb. Er heulte sie trunken zu ihren Lieblingsliedern. Er stöhnte sie mit der Hand unter der Bettdecke, um sie danach in sein Kissen zu schluchzen. Und eines Nachts schrie er sie auch. Ganz oben auf dem Mörderberg.
Jetzt ist es gut, schrieb Anonym in dieser Nacht. Jetzt kannst du die Stadt verlassen.
Wunderlich war einverstanden.
Tag Eins
Wunderlich verließ die Stadt am nächsten Morgen. Er duschte doppelt so lange wie sonst, wusch sich die Haare und schnitt seine Nägel, rasierte sich, trank zwei große Tassen Kaffee und stellte aus dem spärlichen Inhalt seines Kühlschranks ein überraschend üppiges Proviantpaket zusammen: Brote mit Wurst und Käse, ein Stück mageren Speck, eine Thunfischdose, zwei Tomaten, eine Zwiebel, vier hartgekochte Eier, ein paar Äpfel und eine angebrochene Flasche Wodka. Wunderlich wusste, dass er sich nicht mit so viel Wegzehrung hätte belasten müssen – er besaß genug Geld, um sich unterwegs etwas kaufen zu können. Dennoch, der Proviant gab ihm das gute Gefühl, eine lange Reise und ein wahrhaftes Abenteuer vor sich zu haben. Und so füllte er eine große Flasche mit Wasser, wuchtete seinen Reiserucksack auf den Rücken, verschloss die Wohnungstür und machte sich auf den Weg zum Bahnhof.
Die Straßen waren menschenleer, die Luft noch frisch, und die Vögel zwitscherten. Es ging ihm gut. Eigentlich war es ihm noch nie besser gegangen. So dachte Wunderlich, als er in die Straßenbahn stieg. Er hatte sich vorgenommen, den nächsten Zug nach Norden zu nehmen, alles Weitere würde sich finden. Am Bahnhof kaufte er einen Fahrschein, mit dem er einen Monat lang unterwegs sein konnte, und zehn Minuten später saß er im Zug.