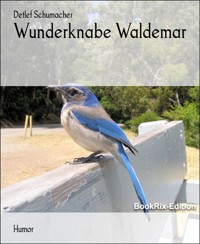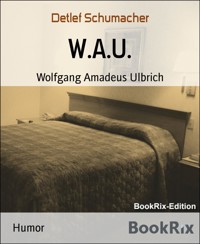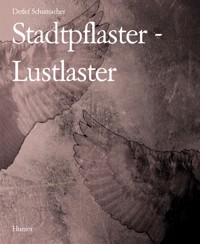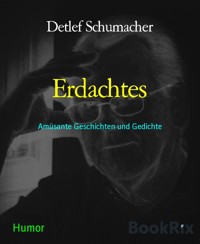0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die unweit Weckelnheims aufsteigenden Kalidämpfe, die Kranke gesund machen, Süchtige von ihrem Laster befreien und ein längeres Leben verheißen, sollen den Gemeindeverbund Wüwe in das Wunderkurland "Weiße Wolke" verwandeln. Das hierfür notwendige Startkapital will eine amerikanische Millionärswitwe sponsern. Diese Großzügigkeit verbindet sie jedoch mit Vorbedingungen, die den Kurlandverantwortlichen einiges Kopfzerbrechen bereiten. Die nationale und internationale Aufmerksamkeit, die dem aufstrebenden kleinen Land nun zuteilwird, zeitigt nicht nur positive Tendenzen; es gibt auch gegensätzliche Bestrebungen, die den Wachstumsprozess auf eine harte Probe stellen.
Dieser letzte Teil der "Würda"-Trilogie findet schließlich das ersehnte glückliche Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Würda - Weiße Wunderwolke
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKurzes Vorwort
Dieses Buch ist der letzte Teil der „Würda“-Trilogie. Wer versäumt hat, die beiden vorangegangenen Bände zu lesen, der sollte es tun.
Auch dieses Werk erhebt nicht den Anspruch, den Tatsachen zu entsprechen oder diesen nahe zu kommen. Dennoch wünsche ich eine erbauliche Lektüre.
So fängt es diesmal an
„Opa, nimm bitte wieder mal die Zähne aus dem Mund, das sieht so lustig aus!“
Beide Enkelkinder schauen gebannt auf meine untere Gesichtshälfte, in der sich die Vorstellung wiederholen soll, die sie einige Male schon mit großem Vergnügen gesehen haben.
„Nein, heute wackele ich mit den Ohren“, sage ich entschieden.
„Das ist langweilig“, mault Enkelsohn Ka, der auf meinem linken Oberschenkel sitzt.
„Mit den Ohren wackeln kann jeder“, meint Enkeltochter Li, die meinen rechten Oberschenkel besetzt hat.
„Ich glaube nicht, dass das jeder kann“, halte ich dagegen und ernte prompt den Hinweis, dass Sebastian Muschke das könne, abwechselnd sogar.
„Wer ist Sebastian Muschke?“
„Der mit den großen Ohren!“
„Ahaaa“, sage ich gedehnt, um Zeit für eine andere Unterhaltung zu finden.
„Ich kann auch mit der Nase wackeln“, erkläre ich überraschend.
„Ooooch, ist ja noch langweiliger“, weist Ka meinen Einfall zurück.
„Dir fällt aber auch gar nichts Neues ein.“
Enkelsohn und Enkeltochter sind enttäuscht und im Begriff, meine Oberschenkel zu verlassen. Rasch halte ich sie davon zurück, weil mir schwant, dass sie meine Einfallslosigkeit Oma Inge hinterbringen werden.
„Jetzt hab’ ich’s!“ versuche ich Begeisterung zu wecken, „wir setzen uns in den Kurex und fahren schnell zu Onkel Thoralf, der uns wieder etwas Spannendes erzählen wird. Zum Beispiel, wie Ziege Else mit ihren Hörnern den amerikanischen Präsidenten Bloodmaker in den Po gestoßen hat.“
Ka und Li verbleiben zwar auf meinen Oberschenkeln, doch begeistert sind sie nicht. Ka gähnt gelangweilt: „Das mit Else hat uns Onkel Thoralf schon hundert Mal erzählt. Dem fällt ebenso wenig ein wie dir, Opa.“
„Warum ist Onkel Thoralf eigentlich unser Onkel?“ will Li wissen.
Die Frage überrascht mich.
„Erzähle! Erzähle!“ kreischt Papagei Didi von seiner Schaukel im Tropenraum her.
Oma Inge eilt herbei, den Kochlöffel drohend erhoben. „Verschweigst du den Kindern etwas?“
„Nein, nein“, stottere ich und beginne sofort mit der Onkel Thoralf-Erklärung.
„Also, das verhält sich folgendermaßen“, nehme ich Anlauf und werfe der Oma einen Verzieh-dich-Blick zu. Seit Inge und ich Großeltern sind, lassen wir’s auch in der Kommunikation ärmer angehen. Es gibt nun weniger zu sagen, denn in den zurückliegenden vierzig Ehejahren sind der Worte viel gewechselt worden. Nun reden unsere Blicke eine beredte Sprache. Natürlich auch in Rücksichtnahme auf die Enkelkinder. Wie würde sich Papa Würdig wundern, wenn ihm Sohn Ka mitteilte, dass Oma und Opa unfreundlich zueinander waren. Ebenso erstaunen würde es Mama Kurliande, von Töchterchen Li ein Gleiches zu erfahren.
Wie schwer es manchmal auch fällt, aber Großeltern müssen den wohlmeinenden und gütigen Schein wahren.
Inge erwidert meinen Blick, der befiehlt: „Erzähle den Kindern ja keinen Blödsinn!“ Dann verschwindet sie wieder in die Küche.
Papagei Didi kreischt ihr nach: „Was gibt’s zu fressen?“
Die gute Oma fährt auf den Absätzen herum, eilt in den Tropenraum und bringt dem bunt gefiederten Schwätzer Manieren bei.
Didi ist eine Gabe des brasilianischen Präsidenten Pepe. Er schenkte uns diesen Schreihals als Dankeschön für die wunderbaren und wohltuenden Tage, die er im Wunderkurland Weiße Wolke verbringen durfte. Weil er sich wie neu geboren fühlte, überließ er uns dieses „Mistvieh“ – wie Inge beliebt zu sagen.
Seine Vorfahren seien Deutsche gewesen, Schwaben, verriet Präsident Pepe. Deshalb werde in seiner Familie die deutsche Sprache gepflegt. Auch der Hausvogel, der Präsidenten-Papagei, sei in diese Pflege mit einbezogen worden. Leider habe ihm der halbwüchsige Sohn des Präsidenten einige ungebührliche Worte beigebracht.
Weil Inge von diesem Tropenvogel und seiner Umgangssprache nichts hielt, gab sie ihm den Namen Didi. Ich widersetzte mich seiner Benennung nicht. Wohl aber widersetzte ich mich ihrem Ansinnen, ihm den Garaus machen zu wollen. Weil all mein wortreiches Bemühen um den Erhalt seines Lebens nichts nützte und Inge schließlich mit gezogenem Küchenmesser auf ihn losging, stellte ich mich mit entblößter Brust schützend vor ihn. Nur Millimeter vor meinem Oberkörper verhielt die Klinge. Inge grollte – die Enkelkinder waren nicht anwesend: „Wenn du das noch mal machst, stoße ich zu!“
„Dann tötest du den Opa deiner Enkelkinder!“ formulierte ich geschickt. Die Prägung „deiner Enkelkinder“ gefiel ihr, ließ sie aber auch erkennen, dass die Familie ohne Opa nicht vollständig sein kann.
Wann immer Didi seinen frechen Schnabel aufriss, klopfte ihm Inge denselben heftig. Der nahm diese Züchtigungen zwar mutig hin, schließlich war er ein Präsidentenvogel, rächte sich an der wütend Davoneilenden aber stets mit der Beleidigung: „Alte Klapperschlange!“
Weil es Inge einmal gar zu bunt geworden war, klebte sie ihm den Schnabel mit Leukoplast zu. Die darauf folgende Stille im Haus verwunderte mich. Als ich entdeckte, was mit Didi geschehen war, machte ich Inge die ärgsten Vorwürfe. Sie zeigte sich unbeeindruckt und kehrte den Spieß um. Heftig gab sie mir zu verstehen, dass auch ich einen zugeklebten Schnabel bekäme, wenn ich nicht endlich aufhörte, den Federwisch in Schutz zu nehmen. Es genüge völlig, wenn eine Person das Sagen habe. Aus Sicherheitsgründen erhob ich keinen Einspruch.
Nun, da sie wieder in der Küche ist, bin ich gezwungen, Ka und Li zu erklären, weshalb Thoralf Tulke ihr Onkel ist. Ich tue es unumwunden mit dem Satz: „Onkel Thoralf ist euer Patenonkel!“
Das genügt, denke ich. Das aber denken die beiden Kleinen nicht. So bohren sie prompt mit der Frage nach, was ein Putenonkel ist.
Mit weitreichenden Ausführungen bis hin zum Mittagessen will ich das Wissen meiner Lieblinge mehren, doch Oma ruft Sekunden später zum Essen. Erleichtert atme ich auf.
Während wir speisen, fragt mich Li in typisch kindlicher Neugier, weshalb mir Suppe aus den Mundwinkeln laufe.
„Weil er ein Sabber-Opa ist“, nimmt Inge mir die Antwort mit grimmiger Freundlichkeit ab. Ungesagt lässt sie, was mir ihr vernichtender Blick kund tut: „Über die Kleckerei auf das saubere Tischtuch unterhalten wir uns, wenn die Kleinen wieder bei ihren Eltern sind!“
Vorerst sind die Kleinen noch nicht bei ihnen. So komme ich nicht umhin, den Putenonkel Thoralf zu erklären. Die Korrektur Patenonkel unterlasse ich, da auch in dieser Hinsicht eine genauere Deutung unerlässlich bliebe. Die Wissbegier beider Enkelkinder, wie erfreulich für deren geistiges Wachstum, geht mir hin und wieder doch auf den Docht. Als ich das Oma Inge einmal gestand, hätte sie beinahe der Schlag getroffen. Nur die schnelle Zurücknahme meiner Unbedachtheit rettete sie vor einem Krankenlager und mich vor dauernden Vorwürfen, sie unter die Erde bringen zu wollen.
Ka und Li halten meine Erklärungen zu Onkel Thoralf nur in fünf Sätzen aus, dann übermannt sie der Schlaf. Vorsichtig hebe ich sie von meinen Oberschenkeln und lege sie in die Kinderhängematte des Tropenraums zum Weiterschlaf. Papagei Didi bedeute ich, den Schnabel zu halten. Er nickt, denn auch er mag die beiden Kleinen, die ihm gern ein Stück Zucker reichen. So gestaltet sich sein Leben leidlich zwischen Würfelzucker und Inges Kochlöffel. Weil es auch ihn nach Siesta verlangt, schließt er die Augenlider. Ich schließe mich an und wuchte meinen Körper in die mir zustehende Hängematte.
Für jedes unserer Familienmitglieder ist ein solches Ruhenetz zwischen Kokospalmen, deren dreizehn in unserem riesigen, von einer gläsernen Kuppel überdachten Tropenraum wachsen, angebracht. Der Stamm der dreizehnten Palme ist unbehängt, weil er als Kletterstamm für Ka und Li dient. Als das so angedacht war, hegte Oma Inge Befürchtungen, weil die 13 eine Unglückszahl sei und den lieben Kleinen beim Klettern eine Kokosnuss auf den Kopf fallen könne.
„Die kann ihnen auch auf den Kopf fallen, wenn sie nicht klettern“, belehrte ich fürwitzig.
„Dir ist sicherlich schon eine draufgeknallt“, schleuderte Inge zurück.
Der nachdrücklichen Bitte Würdigs und Kurliandes beugte sich die Oma. Als auch ich mein Urteil einbrachte, meinte sie, dass ich den Kindern als kletternder Affe ein gutes Vorbild geben könnte.
Zwischen den verbleibenden zwölf Palmen baumeln sechs Hängematten, vier große und zwei kleine. Über diese ist ein Sicherheitsnetz gespannt, damit niemand von einer Kokosnuss erwischt wird.
So liege ich also in meiner Matte und döse vor mich hin. Ich blicke hinauf zur gläsernen Kuppel, die den Tropenraum in einer Höhe von 12 Metern überspannt. Jawohl, 12 Metern, denn diese Höhe hatte ich mir bei Errichtung des Tropenraumes ausbedungen. Ursprung dieser meiner Forderung war ein Gespräch, das ich mit dem Stammeshäuptling einer Südseeinsel geführt hatte. Der weilte bei uns zur Kur, weil ihn ein Zipperlein befallen hatte. Als er uns verließ, war er genesen und freute sich, endlich wieder kräftig und behände die Kokospalmen hinauf- und hinabklettern zu können. Er sei nämlich der ungeschlagene Kletterkönig gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, als ihn das Zipperlein heimsuchte. Nun, wieder kerngesund, könne er den Stammesuntertanen zeigen, wie flink ein 80 jähriger auf der Palme sein kann.
Von ihm also bekam ich die Empfehlung, den Kokospalmen genügend Wachstumshöhe zu gönnen.
Da ihm dieser Rat als Dank für seinen erfolgreichen Kuraufenthalt zu wenig war, schenkte er uns einen Sack voller Palmensamen. Er hegte wohl den Wunsch, dass wir ihn rings in Wunderkurland verstreuen, doch Inge schüttete den Sackinhalt im Tropenhaus aus.
Das liegt nun schon Jahre zurück. Wochen nach der Ausschüttung lugten Palmensprösslinge so zahlreich aus dem Erdreich, dass ich fürchtete, sie würden im fortgeschrittenen Wachstumsstadium das Tropenhaus sprengen. Deshalb zupfte ich alle, bis auf dreizehn, aus dem Boden. Das tat ich bei Nacht, als Inge fest schlief.
Als sie am nächsten Morgen den Verlust Hunderter Sämlinge feststellte, war sie in ihrem Schmerz darüber kaum zu besänftigen. Sie bezichtigte mich, wie nicht anders zu erwarten, dieses Frevels. Ich gab ihr jedoch mit Unschuldsmiene zu verstehen, dass einige der in den Tropen beheimateten Palmwurzelmäuse dieses vernichtende Werk vollbracht hätten. Zur Erhärtung meiner Behauptung verglich ich die Mäuse mit Maulwürfen, die sich im Erdreich voranbuddeln und in kürzester Zeit wegfressen, was ihnen schmeckt.
Als Inge wutentbrannt zum Spaten griff, um diesen heimtückischen Biestern auf die Spur zu kommen, gebot ich ihr mit der Bemerkung Einhalt, dass ich sie bereits vernichtet habe. Ich hätte hierzu die gesamte letzte Nacht geschuftet.
Das beruhigte die Erboste. Auch deshalb, weil dreizehn Pflänzchen erhalten geblieben waren. Während ich dieser Notlüge nachlächle, fallen mir die Augen zu, und ich schlafe zufrieden ein. Ich träume natürlich nicht, weil ich während jedes Mittagsschlafs traumlos bleibe. Woran das liegt, weiß ich nicht. Inge hingegen träumt bereits während des Mittagsschlafs, und zwar sehr heftig. Ihre Bewegungen beschränken sich nicht nur auf die Veränderungen ihres Gesichts (Schneiden von Grimassen, Zusammenpressen der Lippen oder friedliches Lächeln), sondern sie äußern sich auch in mehr oder minder heftigem Gestikulieren der Arme. Vor allem nachts gerät ihre Akrobatik zur Gefahr für mich, weil sie meinen Wunsch nach getrennten Betten rigoros abgelehnt hatte. Als wir betagter wurden, gab ich ihr zu verstehen, dass es für einen gesunden Altersschlaf wichtig sei, mindestens einen Meter Bettabstand voneinander zu haben. Darauf fragte sie mich entrüstet, ob ich noch normal sei, ich liebe sie wohl nicht mehr.
„Keiner liebt dich, wieso ich“, verplapperte ich mich, bereinigte meinen Lapsus aber flugs mit dem Geständnis: „Keiner liebt dich so wie ich!“
Inge war’s nicht zufrieden, denn sie misstraute mir auch nach zig durchstandenen Ehejahren. Als ich eines Tages auf ihrem kastanienbraunen Haar ein graues entdeckte und das nicht ungesagt ließ, wurde mir die folgende Zeit zum Wechselbad der Gefühle.
Inge ließ ihr Haar tönen, zunächst in blond, was gar nicht zu ihrem Teint passte, dann in schwarz, was ihr Ähnlichkeit mit Amanda Straps, der Amüsierdame für männliche Kurgäste, verlieh. Schließlich kehrte sie zu ihrer Ausgangsfarbe zurück. Als sie sich so vorstellte, rief ich begeistert: „Du bist schön wie am ersten Tag!“
Diesen Freudenausbruch nahm sie mir übel, weil sie, wie sie sagte, am ersten Tage keine Haare gehabt hätte. Ich beseitigte diesen Fauxpas mit dem Hinweis, dass auch ich unmittelbar nach der Geburt haarlos gewesen sei.
Inges Haarschopf blieb nun unverändert kastanienbraun. Jedes Mal war sie mächtig stolz, wenn bedeutende Herren aus aller Welt, die in unserem Wunderkurland Genesung oder Verjüngung suchten, ihr die schönsten Komplimente machten.
Als ich mich deshalb wieder einmal veranlasst fühlte, ihre unvergängliche Jugend und ihren Liebreiz zu preisen – in regelmäßigen Abständen ist das vonnöten -, meinte sie herablassend, dass ich mir das hohle Geschwätz sparen könne. Sie stehe jetzt im Blickpunkt ganz anderer Persönlichkeiten: Männern von Format, Geist und Witz.
Um wenigstens ein bisschen diesen formatierten Herren zu ähneln, wollte ich einen Witz loswerden. Einen niveaulosen, über den man trotzdem lachen kann. Das Lachen verging mir noch vor seiner Pointe.
Inge wandte sich auch längst verblichenen Geistesgrößen zu, allen voran dem weltweit bekannten Dichter Goethe. Mit Nachdruck wies sie darauf hin, dass dessen Genital ihr stets Bewunderung abringe. Die Heiterkeit in der Gesprächsrunde der kurenden Herren veranlasste sie, mir klar zu machen, dass ich zur Entfachung solch fröhlichen Humors unfähig sei.
Vorsichtig bemerkte ich, dass nicht Goethes Genital, sondern sein Genie beachtlich sei. Sie darauf abwehrend: „Das ist doch völlig wurscht. Dein Genital ist ebenso kümmerlich wie dein Genie.“
Dass meine Gattin auf den Dichterfürsten aufmerksam wurde, verdankte sie einem Professor, der am Pariser Goethe-Institut seines Amtes waltete. Der hatte ihr erklärt, dass es die Bedeutung eines Ortes ungemein hebe, wenn der Herr Geheimrat Goethe in diesem irgendwann einmal seine Spuren hinterlassen hätte. Inge wollte ganz schnell wissen, welche Spuren das sein könnten. Bremsspuren kämen wohl am ehesten in Betracht, weil ihr aus der Schulzeit bekannt sei, dass Goethe vornehmlich mit der Kutsche reiste.
„Köstlich ihr Humor, gnädige Frau“, schüttelte es den Herrn Professor heiter, wobei ihm beinahe die obere Gebisshälfte entfallen wäre.
Die beiden heckten dann den Plan aus, Wunderkurland Weiße Wolke auch kultur-historisch bedeutsam zu machen.
Wie wohlig wurde es so manchem Goethe-Fan, wenn er andächtig unter der Goethe-Linde saß, die zuvor den vulgären Namen „Lust-Linde“ geführt hatte. Dass dem Verweilenden Vögel auf den Kopf kackten, gereichte ihm zu beglückender Ehre.
Bei all ihrer Anziehungskraft, die Inge auf die vornehmlich älteren Herren ausübte, war es mir hin und wieder auch vergönnt, ein wenig von ihrem Fluidum abzubekommen.
Als ich ihr einmal voller Hingabe den Schlagertext rezitierte: „Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit ganz genauso wie heut“ (gesungen von Bernd Spier), wandte ein betagter Herr sein ergrautes Haupt mir zu und fragte, seit wann ich der Dame, er meinte meine Gattin, schon den Hof mache.
Inge stahl mir die Antwort: „Seit 40 Jahren.“
„Erstaunlich“, darauf der Herr, „und immer noch voller Hoffnung und Zuversicht?“
„Mit wachsendem Erfolg“, kam ich Inge zuvor.
„O lala“, darauf der Graumelierte, „sie taugen zum Minnesänger.“
Er lachte, als hätte ihn jemand gekitzelt. „Ein bisschen sehr weit zurückgegriffen zwar, aber im Ernst, junger Mann, …“
Ich straffte mich und strich mein ebenfalls in Grautönen befindliches Haar mit eleganter Handbewegung über lichtere Stellen des Kopfes.
Inge würdigte mein Tun mit einem verächtlichen „Pah!“, und der Herr brachte seinen Satz wie folgt zu Ende: „… sie hätten das Zeug zu einem Schauspieler. Mit dem freien Rezitieren klappt es schon ganz gut. Auch vom Aussehen her machen sie eine passende Figur.“
Mein Brustkorb schwoll um ein Weiteres. Inge guckte mich an, als würde sie an mir etwas noch nie Wahrgenommenes entdecken.
Der Herr in Grau war mit der Lobpreisung meiner Person noch nicht am Ende. „Ihr Kopf ist sehr charakteristisch und gleicht dem Stan Laurels, wenn Sie wissen, wen ich meine.“
Ich wusste, wen er meint, und das passte mir nicht. Inge hingegen geriet in zunehmende Bewunderung meines Habitus. Ein Glück, dass sie bislang noch keinen Dick-und-Doof-Film gesehen hatte.
„Sie meinen“, fragte sie den Graumelierten, „mein Mann würde ein guter Schauspieler sein?“
„Schauspieler nicht schlechthin, sondern Filmschauspieler.“
In Inges Augen kam Glanz. Das hätte mich froh stimmen sollen, doch mein Ego knickte ein, weil ich die Charakteristik meines Kopfes bislang besser gewertet hatte.
„Liebling“, schreckte sie mich auf, „du ein Filmschauspieler! Wie werden die Enkelchen stolz sein, in dir nicht mehr den zahnlosen Einfaltspinsel zu sehen.“
Sie umfasste mich herzlich. Eine solche Umarmung hatte ich das letzte Mal zur Silberhochzeit erlebt, als von uns als Silberpaar ein Erinnerungsphoto geschossen wurde.
Der Graukopf, der sich als Filmregisseur entpuppte, berankte mein Haupt mit weiterem welken Lorbeer: „Ich fühle förmlich, nein, ich rieche es sogar, dass Sie …“
Inge raunte: „Hoffentlich hast du dich heute Morgen gewaschen!“
„… zu Höherem berufen sind, als in diesem Kurland nur als Statist dahin zu dümpeln. Ihr geradezu lächerliches Aussehen passt haargenau zur Rolle des Hauptdarstellers Karlo Kinkerlitz im Lustspiel-Film Der vollendete Blödian, dessen Drehbuch ich seit Tagen studiere.“
„Der vollendete Blödian“, freute sich Inge, „ist meinem Alten wie auf den Leib geschrieben.“
Der Regisseur lächelte nachsichtig: „Madame kennen das Drehbuch doch gar nicht.“
„Ich kenne aber meinen Dieter“, zeigte sie sich glücklich, dass ich die Rolle des Blödians nun auch im Film spielen sollte.
„Vielleicht ist für mich ebenfalls eine Rolle dabei“, buhlte sie, „denn schauspielern kann ich ganz gut. Stimmt’s Didi?“
Ich nickte, und der Regisseur sichtete Oma Inge von oben bis unten.
„Aber sicher doch“, diagnostizierte er schließlich, „an der Seite ihres blöden Ehemanns könnten Sie die dumme Pute Heraldine Kinkerlitz spielen. Diese Frau ist so behämmert, dass sie den Verwendungszweck von Kondomen nicht kennt.“
Während sich der Regisseur lautem Lachen hingab, stellte Inge ihr Wissen über die Nützlichkeit dieser Schutzgummis vor. In diesem Zusammenhang erklärte sie, dass es in Würda eine Frau gebe, die diese Verhüterli zwecks Wiederverwendung auswasche. Sie sei sehr sparsam.
Der Regisseur lachte noch heftiger, wobei er hochrot anlief und beängstigende Asthmatöne von sich gab. Inge fiel in dieses alberne Gelächter mit ein.
Dass uns die Mitwirkung an diesem Ulk-Film erspart blieb, war dem überraschenden Tod des Regisseurs zu verdanken, der für allerhand Aufsehen sorgte. Wie sich bei der Untersuchung des 88jährigen herausstellte, war Ursache seines Dahinscheidens das geborstene Zwerchfell. Der Mann war zu Lebzeiten ein durchschnittlicher Komödienregisseur gewesen, der über den Inhalt seiner fabrizierten Filme mehr lachte als die Zuschauer. Als er zu Grabe getragen wurde - seinem vorausgegangenen Wunsche entsprechend auf Würdas Friedhof -, lachten sämtliche Trauergäste aus vollem Halse. Auch das entsprach seiner verfügten Bitte.
Um nun endlich zum eigentlichen Anliegen des dritten Teils der „Würda“ - Trilogie zu kommen, knüpfe ich da an, wo der vorangegangene Teil endete. Wer denselben gelesen hat, wird wissen, dass die amerikanische Millionärswitwe Mrs. Tracy Tulke den Aufbau Wunderkurlands mit reichem Dollarsegen unterstützen wollte.
Diese Großherzigkeit stimmte jeden Bürger froh und heiter.
Umfangreiche Startvorbereitungen
Mit dem allgemeinen Jubel war es natürlich nicht getan.
„Unser neues Land braucht viele fleißige Hände, um es werden zu lassen, was es einmal sein soll.“ Diese pathetischen Worte, gesprochen von Agathe Hiller, brachten ihr sogleich den Posten des Propagandaministers ein. Diesen Begriff lehnte sie jedoch strikt ab, weil er zu sehr an das III. Reich erinnere. Ihren Gatten Adolf bedachte sie dabei eines strafenden Blicks, den der sogleich verstand. Weil er endgültig den Nimbus des anderen Adolf loswerden wollte, damit ihn seine Gattin fortan wie ein vollberechtigtes Mitglied der menschlichen Gesellschaft behandelt, brachte er den Vorschlag ein, seine wortgewandte Ehefrau Überzeugungsministerin werden zu lassen. Die tippte sich an die Stirn, was ihn erkennen ließ, dass er einen anderen Begriff hätte wählen sollen. Sogleich erfand er einen solchen, denn an der Seite einer Ministerin würde auch ihm ein hohes Maß an Beachtung geschenkt sein.
„Agitprop-Ministerin“, schnarrte er und war stolz auf seinen Fund aus dem Sprachgebrauch der DDR, die nur wenige hundert Meter entfernt immer noch ihre Existenz behauptete.
Thoralf Tulke, der den Vorsitz dieser außerordentlichen und beschlussfassenden Volksversammlung unter freiem Himmel führte, erhob Agathe Hiller in die Verantwortlichkeit als Ministerin für Massenwirksamkeit. Mit Handschlag und Küsschen auf deren linke und rechte Wange vereidigte er sie. Als Minister für Innere Angelegenheiten war er zu solcher Handlung berechtigt.
Gatte Adolf sah das mit Stolz. Und nicht nur er, sondern all die anderen auch, die von der verbalen Schlagkraft Agathe Hillers wussten.
Natürlich wären diesbezüglich andere Personen ebenfalls in Betracht gekommen, doch hatten die nicht den Enthusiasmus fördernden Satz ausgestoßen.
Weil jeder froh war - und das waren viele auf dem Würdaer Sportplatz -, eine solche verantwortungsvolle Funktion nicht übertragen bekommen zu haben, spendete man befreit und froh Beifall. Würdaer, Weckelnheimer und Bimstedter waren hier versammelt. Letztere beglückte das Gefühl, nun ebenfalls Bürger des Wunderkurlands Weiße Wolke zu sein. Dass dies der herzlichen Freundschaft Theodora Lieblichs und Dorothea Rülles zu verdanken war, wusste jeder. In großer Dankbarkeit setzten sie beiden Frauen ein Denkmal. Weil Bimstedt mit Denkmalen schon reich gesegnet war, wurde dieses auf dem zweiten Busenberg, der den ersten um 17 cm überragt, aufgestellt. Weithin sichtbar kündete dieses Monument aus Eisen (Schmied Herrmann Ackermann brachte sich mit diesem wieder in die Gunst der Würdaer) von der innigen Zuneigung zweier willensstarker Frauen.
Als es feierlich enthüllt wurde, wunderte sich Theodora, dass ihre Brüste ebenso auslandend gestaltet waren wie die Dorotheas.
„Macht nichts“, glättete die den aufkommenden Unmut der Freundin, „Herrmännchen hat seine gebliebenen erotischen Sehnsüchte in deine Wölbungen gepackt.“
Was blieb da noch zu sagen? Für Herrmann Ackermann hegte die schöne Lehrerin längst keine Sympathien mehr. Er wusste das, gab aber dennoch die Hoffnung nicht auf, die Nähe dieser bezaubernden Frau wieder erreichen zu können. Die aber hatte Gefallen an einem Mann gefunden, dessen gutes Aussehen mit Intelligenz gepaart war. Thoralf Tulke hieß der Glückliche, der von diesem Glück noch nicht wusste. Theodora verschwieg ihre Zuneigung, weil sie ihrem Grundsatz treu sein wollte, ledig zu bleiben.
Mir, dem sie ihre Empfindungen unter dem Siegel strengster Vertraulichkeit mitgeteilt hatte, offenbarte sie die Bedenken, dass eine Eheschließung in ihrem Alter ein Ding der Unmöglichkeit sei und sie auch nicht wüsste, wie sie sich dem Partner gegenüber verhalten soll. Vom Verhalten im Ehebett sagte sie nichts, doch spürte ich, dass dies für sie der springende Punkt war. Sexuell war sie unerfahren wie ein pubertierendes Mädchen.
Ich empfahl ihr, sich ihrer Freundin Dorothea mitzuteilen. Außerdem ließ ich wissen, dass sie längst noch nicht die Grenze an Begehrlichkeit überschritten habe.
„Wäre ich nicht verheiratet, würde ich dir den Hof machen“, gestand ich offenherzig.
„Lass’ das ja nicht Inge wissen“, lachte sie und fragte, ob ich das Buch Unsere Ehe besitze. Ich bejahte und lieh es ihr. Nur zur Information, meinte sie errötend, weil sie als Bibliothekarin der Dorfbücherei und vor allem als Lehrerin über alle Dinge des Lebens Bescheid wissen müsse. Mit dem Wachsen und Gedeihen Wunderkurlands würden auch die geistigen Anforderungen rasch zunehmen.
Als der Beifall für Agathe Hiller verebbt war, fragte Thoralf, ob es noch jemanden gelüste, etwas werden zu wollen. Wider Erwarten schrillte eine Stimme: „Minister nicht, aber Mutter!“
Alle lachten.
„Soso“, rief Thoralf verständnisvoll, „auch eine wichtige Aufgabe.“
Weil er nicht entdeckt hatte, wer die Ruferin war, setzte er scherzend hinzu: „Gibt es jemanden, der dieser Frau dabei behilflich sein möchte?“
Kurze Stille, weil niemand in den Verdacht geraten wollte, ein Draufgänger zu sein.
Sogleich ertönte die schrille Stimme erneut, sehr entrüstet sogar: „Mit Ferkeleien und Unzucht muss nun ein für alle Mal Schluss sein! Glaubt ja nicht, dass der Herrgott seine Aufsichtspflicht vernachlässigt, nur weil hier wieder Dinge vor sich gehen, die er noch nicht abgesegnet hat.“
Die Würdaer erkannten die Ruferin und grienten. Nur einige wenige grienten nicht, weil sie zur Schar derer gehörten, die Pastor Frommel und dem lieben Gott die Treue hielten. Um deutlich zu machen, dass der vorherrschende Glückstaumel blind mache und den Teufel veranlasse, verderblich in die Seelen zu fahren, schrie Gundula Geier fast hysterisch: „Jawohl, ich werde Mutter! Ich bin Mutter, Mutter Gundi von Gottes Gnaden, Hüterin des reinen Glaubens und …“
„Prost Mahlzeit!“, unterbrach sie jemand laut.
„Du bist der erste“, kreischte Gundi schier atemlos, „dem ich den Satan austreibe!“ Die Menge lachte und konzentrierte sich dann auf das, was ich sagte. Wie die anderen Redner dieser Massenveranstaltung auch stand ich auf einem notdürftig errichteten Holzgerüst, um gesehen und gehört zu werden. Um nicht brüllen zu müssen, hatte die Arbeitsgemeinschaft Junger Techniker, ein wertvolles Überbleibsel aus DDR-Zeit, eine Lautsprecheranlage aufgebaut, mittels der wir uns den Zuhörern verständlich machten.
„Liebe Bürger“, sprach ich, „der Himmel ist blau, die Sonne lacht und uns wird das Herz so frei beim Gedanken daran, was auf uns zukommt. In meiner Eigenschaft als designierter Kurminister …“
„Was für ein Ding?“, fragte jemand in unmittelbarer Nähe. „Als degenerierter Kurminister, du Depp“, belehrte meine Gattin Inge, die unmittelbar vor dem Gerüst stand und stolz zu mir aufblickte, ihren Cousin Dietmar Dunkert. Im Arm hielt sie ein Windelpaket, aus dem das kleine Köpfchen unserer jüngst geborenen Tochter Kurliande lugte.
„Schau“, sagte sie zu dem Köpfchen, „dort oben steht dein Papi! Er ist jetzt ein hohes Tier!“
Ja, dachte ich mit stolzem Blick auf sie nach unten, vor Wochen noch warst du ein gefülltes Täubchen, nun bist du eine glückliche Zweifach-Mutter. Mein Hochgefühl als Zweifach-Vater schwang in der Fortsetzung meiner Rede mit.
„Als Kurminister werde ich meine ganze Kraft in die Erfüllung der vor uns stehenden Aufgaben investieren.“ Ich schmückte mich mit Fremdwörtern.
„Dein Mann redet heute aber schlau“, flüsterte Dietmar Inge zu.
„Muss er ja, weil er es nun mit vielen schlauen Leuten zu tun bekommt.“ Ihr zwingender Blick veranlasste ihn, bewundernd auch auf sie zu schauen. Dabei entdeckte er das winzige Windelpaket in ihren Armen. Als er das Köpfchen Kurliandes wahrnahm, fragte er, mit einem Blick in meine Richtung: „Ist das tatsächlich von ihm?“
„Von wem denn sonst!“ entrüstete sich Inge so laut, dass Einige kopfschüttelnd zu ihr sahen. Inge kopfschüttelte mit und knurrte in Richtung Dietmar: „Du bist aber auch selten dämlich!“
„Ich will nicht viel Worte machen“, sprach ich weiter, „denn als Kurminister muss ich erst Erfahrungen sammeln. Deshalb gebe ich an Herrn Backenstoß weiter, den die meisten von euch bereits kennen. Wer nicht, der wird ihn jetzt kennen lernen. Bitte Benito!“
Auch ihn duzte ich seit geraumer Zeit. Diese Vertraulichkeit förderte unsere enge Zusammenarbeit, die schon erste Erfolge zeigte. Von diesen und was es noch zu tun gebe, wollte Benito Backenstoß, Minister für Äußere Angelegenheiten, nun sprechen.
„Sehr geehrtes Publikum“, begann er, „seit einigen Wochen bin auch ich Bürger dieses inzwischen weithin bekannten Wunderkurlandes Weiße Wolke. Ich bin stolz, das sein zu dürfen. Noch vor einem Jahr glaubte ich, hier werden Not und Erniedrigung niemals enden. Als Walter Ulbricht euch ins Verderben stürzen wollte, weil ihr ihm als kommunistische Versuchskaninchen nicht mehr nützlich wart, nahm sich euer die Bundesrepublik Deutschland an. Initiator dieses Befreiungsaktes aus den Klauen des sowjethörigen Regimes war ich, Benito Backenstoß, damals noch Sekretär des Amtes für Gesamtdeutsche Fragen. Sehr bald erkannte ich jedoch, dass das hochherzige Verhalten der Bundesregierung nur ein tönerner Riese ist, der zum Zwerg schrumpft, sobald Geld eine größere Rolle zu spielen beginnt. Deshalb habe ich dem so genannten Goldenen Westen den Rücken gekehrt.
Nun zu uns, den wenigen Leuten, die Wunderkurland verwalten. Ich sage bewusst nicht regieren, weil Regieren immer den Beigeschmack von Beherrschen hat. Ihr seid das Volk und wir sind ein Teil von euch. Wir wohnen nicht in noblen Palästen, sondern in ebensolchen Hütten wie ihr.“
Ich unterbrach ihn und sagte, dass Herr Backenstoß natürlich „Häuser“ gemeint habe.
„Pardon, natürlich Häuser“, setzte Benito seine Erklärung fort. „Wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht wie Krümel picken“, brachte er sich witzig in Volksnähe. „Auch ich habe als Kind Ähren lesen müssen, um nicht Opfer des drohenden Hungertodes in der Nachkriegszeit zu werden.“
„Menschenskind“, entfuhr es Inge, „ich muss Kurliande die Brust geben. Du passt auf!“ befahl sie Cousin Dietmar, „dass niemand zuguckt!“
Dietmar postierte sich mit verschränkten Armen vor seine Cousine, die sogleich die Bluse aufknöpfte und unsere liebe, kleine Kurli vor dem Verhungern bewahrte.
„Liebe Mitbürger, grundsätzliche Angelegenheiten zum Wohle unseres kleinen, aber weltweit einzigartigen Staates sind bereits erledigt. Nach außen hin sind wir durch die Grenztruppen der DDR abgesichert, die auf Befehl Ulbrichts ihre Wachsamkeit verstärkt haben. Nicht aber, weil uns der Staatsratsvorsitzende der DDR plötzlich ins Herz geschlossen hat, sondern weil er verhindern will, dass Bürger seines Landes zu uns flüchten, um hier ein besseres Leben führen zu können. Das erinnert euch, liebe Leute, an die Zeit, als ihr Bürger Glücklicher Dörfer werden solltet. Kurz vor diesem Ziel seid ihr wieder da gelandet, wo ihr schon immer wart. Einige Schwarzmaler könnten jetzt behaupten, dass der Weg, den wir nun beschreiten, auch im Chaos enden werde. Wie sollte das sein? frage ich euch, wo doch die munter dampfenden Kaliwolken der unerschöpfliche Kraftquell für unser Wohl bleiben werden. Und das für alle Zeit. Von diesem einmaligen und einzigartigen Wunder wissen inzwischen viele Menschen. So lässt sich denken, dass Millionen von Erdenbürgern den sehnlichen Wunsch haben, ein einziges Mal durch die heilenden Dämpfe, die überdies auch ein langes, gesundes Leben verheißen, wandeln zu dürfen. Medizinisch sind diese Dampfwirkungen bereits getestet worden. Auch Dr. Wilhelm Mandschuck, der zunächst große Zweifel hegte, änderte seine Meinung, als das Furunkel an seinem linken Fuß binnen weniger Minuten verschwunden war. Aus Dankbarkeit erklärte sich der von allen verehrte Sanitätsrat bereit, als leitender Kurarzt tätig zu sein.“
Beifall ertönte, denn jeder kannte Schnauz-Wilhelm.
„Von mir musst du aber auch was sagen“, verlangte eine männliche Stimme aus der Menge.
Benito, der den Rufer nicht kannte, überließ ihn mir. Ich setzte die Volksaufklärung mit der Mitteilung fort, dass der als Sauf-Anton bekannte Alkoholiker Anton Knerzel endgültig trocken sei.
„Wer hat ihn trocken gelegt?“ rief jemand.
„Die Kalidämpfe waren es“, erklärte ich. „Weil die Heilkraft der Dämpfe medizinisch begutachtet werden musste, benötigten die Test-Ärzte Versuchskaninchen.“
„Na bitte“, sagte Inge, die ihre Muttermilchübertragung beendet hatte und die Bluse schloss, zu ihrem Cousin, „die haben sogar Ka-ninchen durch die Dämpfe gejagt.“
„Eines dieser Versuchskaninchen war Sauf-Anton“, sprach ich weiter. „Der wollte es zunächst nicht sein, weil ihm Bier und Schnaps so gut schmecken. Als der Leiter der Ärztekommission ihm sagte, dass er weltbekannt wird, wenn der Test gelinge, erklärte sich Anton bereit. Versuchshalber musste er vorher eine halbe Flasche Nordhäuser Doppelkorn sowie einige Biere zu sich nehmen …“
„Acht Flaschen“, unterbrach mich Anton, worauf Gundula Geier plärrte: „Altes Saufschwein!“
Knerzel zurück: „Das war einmal!“
Ich weiter. „Anton, voll bis zur Halskrause, sollte nun durch die Dämpfe wanken. Weil er die letzten Minuten seines Alkoholdaseins noch einmal richtig auskosten wollte, bat er, den Rest der Nordhäuser Korn-Flasche auch noch picheln zu dürfen. Eine beteiligte Ärztin wollte das nicht zulassen, weil sie meinte, Anton werde noch vor dem Dampfgang tödlich zu Boden gehen. Der aber beruhigte, dass er mit ihr noch tanzen könne, wenn sie wolle. Sie wollte nicht, und so nahm der Test seinen geplanten Verlauf. Kaum war Anton durch den Dampf, überkam ihn große Übelkeit.“
„Ich habe gekotzt wie ein Reiher“, rief Anton unfein.
„Als er sich ausgek … - sich entleert hatte“, säuberte ich seine Formulierung, denn auch Töchterchen Kurliande sollte in den Besitz einer reinen Muttersprache kommen, „gönnte die Ärztekommission ihm eine Ruhephase von zwölf Stunden, die Anton auch vollständig für seinen Rausch-Ausschlaf benötigte. In dieser Zeit schickten die Ärzte eine andere Testperson in den Dampf, nämlich Hans Dampf, einen Weckelnheimer, der täglich dreißig Zigaretten und an Feiertagen noch mehr dampfte.“
„Hier bin ich!“, war eine fröhliche Stimme zu vernehmen, die gleich darauf von einem Hustenanfall erstickt wurde.
„Klingt gar nicht gut“, setzte ich fort. „Auch bei ihm zeigten sich die positiven Wirkungen der Kalidämpfe sofort. Als man Herrn Dampf eine Zigarette anbot, wies er sie entschieden zurück. Ihm sei speiübel, jammerte er mit bleichen Wangen. Weil drei Ärzte glaubten, Knerzels und Dampfs Reaktionen seien nur vorübergehend, ließ man die beiden drei Wochen ohne ihr Genussmittel. Das ist ein Zeitraum, in dem ein Säufer bzw. ein Kettenraucher wahnsinnig werden kann, weil die Entzugserscheinungen grausam sind. Nach Ablauf dieser Zeit wurden Anton und Hans gefragt, ob sie nicht Lust verspürten, ihrem alten Laster wieder zu frönen. Beide erwiderten wie aus der Pistole gegeschossen: ‚Bleibt mir vom Leibe mit dem Scheibenkleister!’“