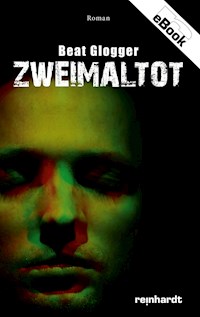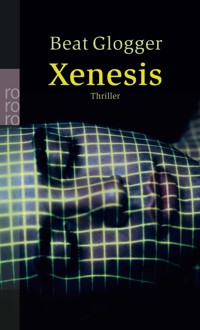
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Virus entsteht. Zwei Babys sterben qualvoll an einer rätselhaften Grippe. Die junge Ärztin Narcy wird entlassen, als sie der Krankheit auf den Grund gehen will. Zusammen mit dem Fernsehreporter Matthew Gallagher gerät sie auf die Spur eines Virus, das immer mehr Todesopfer fordert. Gleichzeitig verschwinden überall auf der Welt Menschen mit einer transplantierten Niere ... In seinem neuen rasanten Thriller entwirft der Autor ein unheimliches Szenario von einer Welt, in der an der genetischen Verbesserung des Menschen experimentiert wird. Dabei entsprechen die medizinischen Fakten und Zusammenhänge dem aktuellen Stand der Wissenschaft. «Es ist die Kombination von detailreichem Faktenwissen und rasanter Handlung, die an diesem Buch fasziniert.» (Neue Zürcher Zeitung) «Glogger kann ohne weiteres in die Bibliothek zwischen Preston und Crichton eingereiht werden.» (ETH Life)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Beat Glogger
Xenesis
Thriller
Die Geschehnisse, die in diesem Buch beschrieben werden, sind der Phantasie des Autors entsprungen. Ähnlichkeiten und Parallelen zu tatsächlichen Begebenheiten sind aber beabsichtigt, denn sämtliche medizinischen Fakten und biologischen Ausführungen entsprechen dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Eine Epidemie wie die geschilderte hat noch nie stattgefunden, doch sie ist absolut möglich.
Die medizinische Wissenschaft hatte endlich einen Weg gefunden, um den akuten Mangel an Organspenden zu beheben. Tiere wurden genetisch so verändert, dass der Mensch ihre Organe nicht mehr als Fremdkörper abstieß. Die so genannte Xenotransplantation hatte vielen tausend Menschen das Leben gerettet. Die Methode galt als sicher. Viele Jahre lang…
Prolog
Singapur, Hotel Sheraton
19.30Uhr
Endlich! Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich rücklings aufs Bett fallen. Er schloss die Augen und wünschte, das sanfte Wippen der Matratze würde nie mehr aufhören.
Natürlich hörte es auf.
Trotzdem blieb er noch einige Atemzüge lang liegen, Arme und Beine weit von sich gestreckt. Als er schließlich die Augen wieder öffnete, füllte die Zimmerdecke sein Blickfeld. Sie war weder weiß noch grau, noch gelb, sondern ein Gemisch aus diesen Farben. Hotelzimmerdecken waren überall gleich. Man gewöhnte sich schnell daran. Er überlegte, ob das vielleicht Absicht war, um Menschen wie ihm den Blick ins Leere zu erleichtern.
Mit einem tiefen Seufzer drehte er sich auf den Bauch. Der Boden war mit einem beigefarbenen Veloursteppich belegt. Hochflorig, um jedes Geräusch sogleich zu schlucken. Beige waren auch die Wände, wie in unzähligen anderen Hotels auf der Welt. In solchen Zimmern fühlte er sich wohl. Dass ihm dadurch manchmal nicht mehr präsent war, in welcher Stadt er sich gerade aufs Bett hatte fallen lassen, war ihm ganz recht. Er schaffte es ohnehin nicht, sich auf all die Orte einzulassen. Zu oft wechselte er die Städte.
Er hob den Kopf und erblickte auf der Ablage an der gegenüberliegenden Wand seinen abgewetzten Aktenkoffer. Der Anblick holte ihn wieder in die Realität zurück. Träge erhob er sich vom Bett und ging zum Fenster.
Er öffnete es.
Und stieß jäh einen kehligen Schrei aus, zog instinktiv den Kopf ein und erwartete den Schlag. Doch der Schatten, der ihn erschreckt hatte, flatterte in den Abendhimmel hinaus. Nur langsam ebbte das Adrenalin in seinem Körper wieder ab. Sein Blick fiel auf den Sims vor dem Fenster – er war von weißem Vogelkot überzogen, genauso wie die Mauervorsprünge zwischen den Stockwerken. Tausende von Tauben hatten sich darauf eingenistet.
Während sein Herzschlag sich langsam beruhigte, lauschte er dem Brummen, das aus der Straßenschlucht zu ihm heraufdrang. Akzente im monotonen Lebensgeräusch der Metropole setzten nur ab und zu eine etwas lautere Hupe oder die Sirene einer Ambulanz oder der Polizei. Lauschend glitt er in jene meditative Ruhe, die er brauchte, um seine Gedanken zu ordnen. Oft fielen ihm abends Lösungen für Probleme ein, bei denen er tagsüber nicht weitergekommen war.
Unten auf der Straße war ein Wagen stehen geblieben. Innerhalb von Sekunden füllte sich die Kreuzung mit Autos; nichts ging mehr, Hupkonzert. Er betrachtete die Szene unbeteiligt.
Dann zog er eine Grimasse und hielt sich mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu, um einen lästigen Juckreiz loszuwerden. Direkt vor seinem Gesicht schwebten flaumige Taubenfedern durch die Luft. Sie tanzten sanft im Wind, der an der noch warmen Fassade aufstieg. Plötzlich löste sich der Juckreiz in einem heftigen Niesen.
Und einem zweiten Niesen.
Daraufhin schloss er das Fenster und suchte nach einem Papiertaschentuch. Geräuschvoll schnäuzte er sich, doch der Juckreiz war wieder stärker, prustete laut aus ihm heraus. Die Nase begann zu tropfen. Er riss zwei kleine Stücke von dem Papiertaschentuch ab und stopfte sie sich in die Nasenlöcher. So hatte er es schon als Junge gemacht, wenn ihn im Frühjahr die Birke im Garten mit ihrem gelben Blütenstaub gepeinigt hatte. Auch gegen Nasenbluten half diese Methode.
Er ging ins Bad. Das grelle Licht der Halogenspots an der Decke blendete ihn. Er stützte sich auf die Marmoreinfassung des Waschbeckens und sah im Spiegel die lächerlichen Papierstopfen aus den Nasenlöchern herausstehen. Das Gesicht, das ihm entgegenblickte, wirkte müde. Er hasste diese Deckenleuchten; ihr gebündeltes Licht machte jede Falte zum tiefschwarzen Krater. Die Tränensäcke quollen ihm förmlich aus dem Gesicht. Wie er aussah, so fühlte er sich auch: erledigt. Erst als in der Dusche das warme Wasser auf seine Kopfhaut prasselte und an seinem Körper hinunterrann, entspannte er sich etwas.
08.00Uhr
Er hatte geschlafen wie ein Stein, und noch immer fühlte er sich erschöpft. Die Sonne schien bereits zum Fenster herein.
Im Bad schauten ihm aus dem Spiegel zwei wässrige Augen entgegen. Das Gesicht war gerötet, die Stirn feucht. Ellbogen und Kniegelenke schmerzten, als hätte ihn jemand mit dem Baseballschläger traktiert.
Er beschloss, nicht zur Arbeit zu gehen, und ließ sich vom Room Service eine Kanne heißen Tee bringen. Kurz darauf sprang er zum ersten Mal in höchster Not vom Bett auf und rannte zur Toilette.
14.45Uhr
Seit dem Vormittag hatten sich seine Gedärme in immer kürzeren Abständen schmerzhaft zuckend zusammengezogen. Die Eingeweide hatten längst hergegeben, was sie herzugeben hatten. Doch der Darm pumpte weiter. Die nächste Krampfwelle durchfuhr seinen Körper. Er biss sich auf die Unterlippe und hielt sich an einem Griff an der Wand fest, um nicht vom Schmerz von der Schüssel geworfen zu werden. Gerade als er meinte das Bewusstsein zu verlieren, war mit einem Schlag Ruhe. Er stützte die Ellbogen auf die Oberschenkel und ließ erschöpft den Kopf hängen. Dann erhob er sich schwerfällig, klatschte kaltes Wasser in sein rot geschwollenes Gesicht und warf zwei Tabletten ein.
Stöhnend wankte er aus dem Badezimmer zum Fenster. Draußen herrschte strahlendes Wetter. Hunger hatte er keinen, trotzdem ließ er sich vom Room Service ein Schinken-Sandwich bringen. Während er das Brot kaute, schaltete er den Fernseher ein. Später würde er sich an kein einziges der Bilder mehr erinnern, die an ihm vorbeizogen.
20.10Uhr
Wie ein Dolchstoß fuhr der nächste Krampf in seinen Bauch. Er schrie laut auf und war schlagartig wach. Auf CNN flimmerte die Zusammenfassung irgendeines Football-Spiels über den Bildschirm; die Stimme des Reporters überschlug sich vor Begeisterung. Vor Schmerz gekrümmt lag er im Bett. Erst jetzt bemerkte er, dass das Kissen nicht vom Schweiß nass war. Direkt vor seinem Gesicht schwamm der halb verdaute Schinken in einer grün-gelblichen Lache. Angewidert hob er den Kopf. Die stinkende Schmiere lief ihm über die Wangen. Er setzte sich an den Bettrand und senkte den Oberkörper vornüber auf die Oberschenkel. Das Erbrochene tropfte auf den Teppich, der es sofort aufsog.
Der Radiowecker zeigte 20.13.Das hieß, er hatte in seiner Erschöpfung doch ein paar Stunden geschlafen. Er schrie laut auf, als eine weitere Krampfwelle seinen Unterleib umklammerte, um sogleich einer rasselnden Hustenattacke Platz zu machen. Mit letzter Kraft ertastete er das Telefon und drückte Reception.
«Einen Arzt, schnell», stöhnte er in den Hörer. Dann verschwammen vor seinen Augen die Leuchtziffern des Weckers. Der Mann, der wenig später auf einer Bahre aus dem Hotel getragen und notfallmäßig ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert wurde, hörte nicht, dass der Notarzt einen Kollaps des Immunsystems als Folge einer allergischen Reaktion diagnostizierte. Auch ahnte er nichts davon, dass dabei in seinem Körper ein biologischer Prozess in Gang gesetzt worden war, der ihn zu einer Art Beweisstück machte. Zum Beweis für einen tödlichen Irrtum der modernen Medizin. Aber der Mann würde dahinter kommen – sehr viel später.
1.Tag
London, St.James Hospital
Mit Tränen in den Augen betrachtete Ellen Livingston ihre Tochter.
Sie fuhr mit dem Zeigefinger zögernd über die blanke Plexiglasscheibe. Darin spiegelte sich ihr bleiches, vom bläulichen Nachtlicht beschienenes Gesicht. Ihr Blick hing an Laura. Ein Pflaster über der Oberlippe des Babys hielt einen durchsichtigen Silikonschlauch fest, damit es sich die Magensonde, durch die es ernährt wurde, nicht aus dem Nasenloch riss. Das Neugeborene trug einen blütenweißen Strampelanzug, aus dem Kabel in verschiedenen Farben hervorstaken und über das Laken zum Kontrolltableau am Kopfende des Bettchens führten. Auf einem der Bildschirme der Überwachungskonsole zog sich monoton die Leuchtspur des Elektrokardiogramms, das den Herzschlag aufzeichnete. Weitere Monitore zeigten den Blutdruck und den Sauerstoffgehalt des Blutes an. Der Herzmonitor piepste regelmäßig, wenigstens das.
Längst hatte Ellen nicht mehr damit gerechnet, noch einmal Mutter zu werden. Gewünscht hatte sie es sich jahrelang. Doch die Ärzte hatten ihnen mitgeteilt, dass Brian zu wenig aktive Spermien produziere. Ein überraschender Befund für das Ehepaar, das immerhin schon ein Kind gezeugt hatte. Die abnehmende Qualität der Spermien, so hatte man ihnen erklärt, sei bei immer mehr Männern ein Problem, wahrscheinlich aufgrund von Umwelteinflüssen. Schließlich hatten sie sich damit abgefunden, weil sie mit Allanah ja glücklich waren.
Wider Erwarten war Ellen dann doch noch einmal schwanger geworden. Im Gegensatz zu Brian hatte sie sich von Anfang an darüber gefreut. Er hatte einige Zeit gebraucht, um sich mit der Tatsache anzufreunden, mit über vierzig Jahren noch einmal Vater zu werden.
Jetzt war sie da: Laura.
Und Ellen war verzweifelt.
Eigentlich hätte die Kleine erst in zwei Monaten zur Welt kommen sollen, doch die Wehen hatten viel zu früh eingesetzt. Ellen hatte das Gefühl, ein kleines Nichts zur Welt gebracht zu haben. Lauras Ärmchen waren so dünn wie einer von Ellens Fingern, und sie lag im Brutkasten. Am Anfang durfte Ellen das Kleine ab und zu aus diesem Kasten herausnehmen. Doch dann wurde Laura krank. Sie bekam Fieber. Eine Infektion, sagte der Doktor, aber sicher nichts Schlimmes. Danach war Laura von Tag zu Tag kränker geworden. Ellen hatte Angst um ihr Baby. Laura sah so klein, so zerbrechlich aus in diesem sterilen Kasten. Und sie konnte das Mädchen nicht einmal zum Trösten in die Arme nehmen.
Das Baby wimmerte leise und bewegte sich unruhig. Ellens sorgenvoller Blick wich nicht von ihm.
«Mrs.Livingston.»
Sie reagierte nicht.
«Mrs.Livingston.»
Ellen schreckte auf. Vor ihr stand ein Arzt, der einer Fernsehserie entstiegen schien: groß gewachsen, braun gebrannt, markant geschnittene Gesichtszüge. Michael McAvoy war Chefarzt der Kinderklinik und einer der Besten seines Faches.
«Das Kind hatte bei der letzten Messung eine Temperatur von 39,7Grad», sagte McAvoy.
Ellen schaute ihn stumm an.
«Wir haben uns deshalb entschlossen, ihm zu dem Paracetamol zusätzlich noch Amantadin zu verabreichen.»
«Ja», flüsterte Ellen und nickte teilnahmslos, während der Arzt weitere medizinische Details zu Lauras Zustand herunterspulte, die sie nicht verstand. Sämtliche Regungen, zu denen sie einmal fähig gewesen war, hatten die Tränen der letzten Tage aus ihr herausgewaschen. Jedes Mal, wenn der Arzt mit ihr gesprochen hatte, war es Laura danach noch schlechter gegangen. Darum war in Ellen eine böse Ahnung gewachsen: Doktor McAvoy sagte ihr nicht alles, was er wusste.
Eine Frauenstimme drang durch Ellens Schmerzpanzer. «Mrs.Livingston. Das bedeutet, dass bei Laura das fiebersenkende Medikament leider noch nicht gewirkt hat.» Erst jetzt bemerkte Ellen eine hübsche Frau neben Doktor McAvoy. Sie trug ebenfalls einen Arztkittel. Ihr schmales Gesicht lächelte. Ein Paar tiefschwarzer Augen sahen sie begütigend an. «Mein Name ist Narcy Perez Corrales, ich bin Infektiologin», stellte sie sich vor. «Ich möchte mir Laura gerne auch noch anschauen.»
Ellen reichte der Ärztin kraftlos die Hand und fragte: «Warum haben die Medikamente ihr nicht geholfen? Doktor McAvoy hat doch gesagt, sie würden in ein paar Stunden helfen. Laura liegt jetzt schon sechs Tage da drin.»
«Ich beziehe mich selbstverständlich nur auf statistische Durchschnittswerte», bemerkte McAvoy trocken, ohne der jungen Kollegin Gelegenheit zum Antworten zu geben.
Narcy Perez Corrales betrachtete mit konzentriertem Gesicht das Kind im Brutkasten. Es hielt die Augen geschlossen und bewegte sich immer wieder unruhig. Narcy fragte sich, was sie daran zweifeln ließ, dass das Baby an einer normalen Grippe litt. Dann hob sie den Blick und sagte zur Mutter: «Laura scheint ein bisschen länger zu brauchen. Sie ist sehr klein und schwach.»
Ellen schüttelte verständnislos den Kopf. «Können Sie denn nichts weiter tun?»
«Genau das wollen wir jetzt herausfinden. Ich arbeite hier, wie gesagt, als Infektiologin», erklärte Doktor Perez Corrales. «Das heißt, ich berate meine Kollegen bei Fällen mit etwas komplizierteren Infektionen.»
McAvoy presste ein kurzes Lachen zwischen seinen perfekt renovierten Zähnen hervor. «Doktor Perez Corrales ist die krankenhauseigene Gesundheitspolizei, gewissermaßen.»
Narcy ignorierte ihn. Sie spürte, dass McAvoy sie nur äußerst widerwillig auf diese Visite mitgenommen hatte. Doch es war nun mal ihre Pflicht als Krankenhaushygienikerin, sich in Fällen von rätselhaften Infektionen einzuschalten. Und Lauras Infektion war rätselhaft. Das wusste auch McAvoy. Trotzdem passte es ihm aus irgendeinem Grund nicht, dass sie sich einmischte. Narcy schüttelte den Kopf, es war jetzt nicht an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Vor ihr stand eine verzweifelte Mutter. «Ich stimme Doktor McAvoy zu; im Moment sind sicher das fiebersenkende Mittel und ein Medikament, das Viren bekämpft, das Richtige für Laura.» Ellen Livingston schaute zu Boden. Narcy hoffte, dass die Mutter nicht merkte, wie wenig überzeugt sie selbst von dem war, was sie sagte. «Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kriegen Laura schon wieder fit. Aber…», sie hielt inne und blickte Ellen so lange ins Gesicht, bis diese ihren Blick erwiderte, «…wie geht es Ihnen?»
Diese Frage öffnete eine Schleuse, und Ellen brach in Tränen aus. Bis jetzt hatte sie sich zusammengenommen, aber die Müdigkeit einer durchwachten Woche hatte ihre Haut dünn werden lassen, und sie spürte deutlich die gespannte Atmosphäre zwischen den beiden Ärzten. Was hatte das zu bedeuten? Sie begann am ganzen Körper zu zittern. «Es wird mir einfach zu viel.» Sie verbarg das Gesicht in ihren Händen.
«Ich bin seit Tagen hier und kann ihr doch nicht helfen…» Ihre Stimme ging im Schluchzen unter.
Narcy legte der weinenden Mutter den Arm um die Schultern und wartete. Dann spürte sie, wie Ellens Kopf an ihre Schulter sackte. Sie strich ihr sanft über den Rücken. «Könnte denn nicht Ihr Mann Sie hier ablösen?»
«Er kommt immer abends her. Er muss ja arbeiten. Morgens bringt er Allanah zur Schule. Mittags kocht er. Mehr kann ich nicht verlangen.»
McAvoy beobachtete, wie die dunkelhäutige Ärztin leise mit der weinenden Frau sprach. Er blieb unbeteiligt stehen, als Doktor Perez Corrales die Mutter zur Tür begleitete und sie verabschiedete.
«Was haben Sie ihr gesagt?», fragte McAvoy, als die Kollegin zurückkam.
«Dass sie sich keine Sorgen machen und sich zu Hause ausruhen soll. Wir können Laura nun noch einmal genau untersuchen und der Mutter morgen mitteilen, was wir herausgefunden haben.»
«Was wollen Sie denn da noch herausfinden?» Er blickte sie unwillig an.
«Ich will herausfinden, woran das Kind erkrankt ist.»
«Die Symptome weisen eindeutig auf Grippe hin», antwortete er unwirsch. «Wenn wir die jetzt noch mit dem Virenkiller angehen, kriegen wir das schnell wieder hin.»
«Es ist ja schön, dass Sie so sicher sind. Trotzdem möchte ich mir das Kind ganz genau anschauen.»
Irritiert beobachtete McAvoy, wie Narcy aus einem Wandschrank ein weiches Paket holte, dieses auf einen fahrbaren Labortisch aus rostfreiem Chromstahl legte und das farbige Klebeband aufriss. Ihre Bestimmtheit ärgerte ihn und forderte ihn gleichzeitig heraus. Von Kollegen hatte er gehört, die junge Kollegin sei mindestens so ehrgeizig wie attraktiv. Sie muss verdammt ehrgeizig sein, dachte er und bemerkte spöttisch: «Doktor Perez Corrales, das halte ich nun doch für etwas übertrieben.»
«Ich will auf Nummer sicher gehen», antwortete sie.
«Vorschrift sind der Mundschutz und ein paar gewöhnliche Einweg-Handschuhe.»
«Ich weiß. Mich macht es aber stutzig, dass das Fieber trotz der Medikamente nicht fallen will. Ich vermute, da steckt eine andere Infektion dahinter.»
«Aber Narcy», entgegnete McAvoy in plötzlich ganz jovialem Ton. «So eine Grippe werden wir doch wohl noch ohne Kostümierung in den Griff bekommen. Sehen Sie doch nicht gleich überall böse Käferchen.»
«Doktor McAvoy, ich weiß, dass es Ihre Patientin ist. Wenn es aber um hygienische Maßnahmen geht, bin ich die zuständige Ärztin. Und ich möchte, dass auch Sie sich für diese Untersuchung einkleiden.» Mit pochendem Herzen wandte sie sich ab und wickelte das Paket auf.
McAvoy mochte es gar nicht, wenn sich junge Karrieristen auf seine Kosten profilieren wollten. Doch er wusste, dass in Hygienefragen sie das Sagen hatte und er sich für den Moment beugen musste. Entnervt holte er ebenfalls ein Set sterilisierter Untersuchungsbekleidung und beschloss insgeheim, mit dem Klinikdirektor über diese Angelegenheit zu reden.
Narcy zog sich Kopfhaube und Mundschutz über, dann stellte sie sich ans Lavabo und reinigte ihre Hände mit desinfizierender Waschlösung. «Und ich möchte, dass sich in Zukunft alle, die mit Laura in Kontakt kommen, so einkleiden. Nicht zu unserem Schutz, sondern zu dem der Patientin.» Sie schlüpfte in den Mantel.
Während McAvoy seine Hände umständlich in ein Paar steriler Latexhandschuhe zwängte, stand Narcy schon bei Laura. Was für ein Häufchen Elend, wie sie da wimmernd in ihrem Bettchen lag. Das Baby hatte dunkles Kraushaar.
Ines hatte solche Locken.
Narcy verdrängte den Gedanken und konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Sie öffnete den Brutkasten und begann mit der Untersuchung. Der Säugling atmete schnell und flach. Narcy betrachtete die feine Schleimspur, die ihm aus dem rechten Nasenloch lief. «Haben Sie das gesehen?», fragte sie.
McAvoy trat an den Brutkasten heran. «Ist bei Influenza ganz normal», brummte er hinter dem Mundschutz.
«Haben Sie das schon mal in den ersten Tagen einer Grippeinfektion gesehen?», hakte Narcy nach. McAvoy sagte nichts darauf, und Narcy ließ die Frage unbeantwortet. Sie drückte dem Baby mit einem sterilen Spatel die Zunge nach unten. Im Rachen waren die typischen Rötungen einer Infektion zu sehen. Die Lymphknoten waren vergrößert. Sie legte das Stethoskop an und hörte sofort das Geräusch auf den Bronchien, das von der erhöhten Schleimproduktion in den Atemwegen herrührte. Nichts Außergewöhnliches. Eine Infektion eben. Warum wollte sie trotzdem nicht glauben, dass das Baby an einer Grippe litt? Das Mädchen musste Schmerzen haben. Es wand sich fortwährend und wimmerte. Narcy schaltete das Otoskop an, um Laura in die Ohren zu schauen. Auch hier fand sie die üblichen Anzeichen einer Entzündung. Als sie das Gerät aus dem Ohr des Kindes nahm und mit dem Lichtstrahl dessen Augen streifte, zuckte das Baby heftig zusammen. Die Ärztin registrierte es, konnte sich aber keinen Reim darauf machen.
«Wissen Sie etwas über eine Infektion der Mutter während der Schwangerschaft?»
«Lief alles rund, bis die Wehen zu früh einsetzten.»
«Ich meine nur. Eine Grippe der Mutter kann schwere Folgen haben. Jedes Jahr kommen so Tausende von Kindern mit Schädigungen zur Welt.»
«Jaja, und bei der Pandemie von 1918 starben sogar 20Millionen Menschen daran!», höhnte McAvoy. Klugscheißerin.
Als sie nach der ergebnislosen äußerlichen Untersuchung dazu übergingen, dem Kind Blut zu entnehmen, übernahm sofort McAvoy die Führung. Narcy ließ ihn gewähren, schließlich war Laura seine Patientin. Der Arzt suchte den Arm des Babys nach einer geeigneten Vene ab. In der Blutprobe ließe sich vielleicht der Erreger nachweisen. Standardmäßig wurden zwei Proben genommen, eine für das Labor des Krankenhauses und eine für das CCD, das Center for Commutable Diseases. Er war überzeugt, dass auch diese Topspezialisten in Sachen Infektionskrankheiten entgegen Narcys Erwartung im Blut des Babys nur Influenza-Viren finden würden. Trotzdem war die Untersuchung durch das CCD wichtig. Denn in der Regel begann eine Grippeepidemie mit Infektionen bei den Kleinsten, bevor sie einige Wochen später die Alten und schließlich die ganze Bevölkerung erfasste. Wenn man also den Erreger früh identifizieren konnte, hatte man schon einen kleinen Startvorteil im Kampf gegen die nächste Grippewelle.
Schließlich stach McAvoy mit der Nadel in das winzige Ärmchen. Das Mädchen zuckte heftig zusammen und schrie. Aber es lief kein Blut in die Spritze, und McAvoy zog die Nadel wieder heraus. Dabei brummte er etwas, das Narcy nicht verstehen konnte.
«Wie bitte?»
«Ich sagte, hier sieht man rein gar nichts.»
«Haben Sie zu wenig Licht?»
«Das liegt ja wohl nicht am Licht.»
Narcy schaute ihn fragend an.
«Auch mit mehr Licht würde ich auf diesem Schoko-Arm nichts sehen.»
Narcy schwieg betroffen. Erst jetzt wurde ihr Lauras Hautfarbe bewusst. Der Vater des Mädchens musste ein Schwarzer sein, denn die Mutter war eine weiße Engländerin.
«Verdammt», fluchte McAvoy und machte eine hastige Bewegung. Im Bett fuchtelte das Kind mit den Ärmchen, als wollte es die Spritze abwehren. Blitzschnell griff Narcy nach McAvoys Hand, um zu sehen, ob der Latexhandschuh verletzt war. Im Gummi klaffte ein kleiner Riss, durch den sie seine Haut sah. Er blutete.
«Lassen Sie das», raunzte McAvoy und zog die Hand zurück. Er wandte sich ab und ging zum Lavabo. Dort streifte er sich den Handschuh ab, suchte im Notfallkasten das Desinfektionsmittel und spritzte sich einen feinen Strahl über die Hand. Während er sich die Hände trockenrieb, sagte er über die Schulter: «Nicht der Rede wert.»
«Mit solchen Verletzungen ist nicht zu spaßen.»
«Jaja. Bis morgen ist das verheilt. Es hat ja schließlich die Grippe und kein HIV.» McAvoy hatte sich ein Pflaster auf den Kratzer geklebt, zog sich nun frische Sterilhandschuhe an und machte sich daran, die Blutentnahme fortzusetzen. Narcy musste ihm beipflichten. An Aids litt Laura definitiv nicht. Trotzdem.
Mexico City, Universitätsrechenzentrum
Triumphierend schlug David Evans mit der Faust auf den Tisch.
«Hab ich dich!»
Mit dem Gesichtsausdruck eines Jungen, dem es nach tagelangem Tüfteln im Keller zum ersten Mal gelungen war, aus Backsoda Schießpulver herzustellen, wandte er den Kopf zu Enrique Salinas, der am Arbeitsplatz neben ihm saß und wie wild auf seine Tastatur einhämmerte. «Ich habe es», frohlockte Evans noch einmal.
Salinas ignorierte ihn.
Der Informatiker war vom Institut für Neurobiologie für eine ganze Woche abkommandiert worden, um den Troubleshooter aus England bei der Fehlersuche zu unterstützen. Für das Institut war es äußerst wichtig, dass der Rechner möglichst schnell wieder zum Laufen gebracht wurde, denn jeder Job, der im Netzwerk hängen blieb, machte mehrere Tage Vorbereitungsarbeit zunichte. Die Forscher der Neurobiologie wollten Experimente im Computer simulieren, bevor sie diese an Zellkulturen oder lebendigen Ratten durchführten. Woran sie forschten, wusste David nicht genau. Irgendwie ging es um neue Therapien für Parkinson und Alzheimer. So viel hatte er von der kurzen Einführung, die ihm der Institutsdirektor Anfang der Woche gegeben hatte, verstanden. Details waren für ihn aber auch nicht wichtig, Hauptsache, die Computer liefen möglichst schnell wieder.
David Evans kümmerte sich ausschließlich um die komplexen Computernetzwerke von Universitäten, Forschungsinstituten oder Pharma-Unternehmen. In ihren Netzen fand er sich auf Anhieb zurecht. Wandelte in blinder Sicherheit durch die Elektronengehirne.
Auch hier am Neurobiologischen Institut der «Universidad de Mexico» hatte er sich tagelang durch das System navigiert. Es war zum Verzweifeln gewesen, aber jetzt hatte er diesen verdammten Bug gefunden. Er musste nur noch den Informatikern vor Ort die nötigen Anweisungen geben. Sie würden die Maschinen wieder hochfahren, und das Institut konnte seine wissenschaftlichen Berechnungen fortführen. David Evans hatte einmal mehr bewiesen, dass er sein Handwerk beherrschte.
«Enrique, Bingo!», intensivierte David seine Erfolgsmitteilung an den Informatikerkollegen.
Endlich löste Salinas den Blick vom Bildschirm, fuhr sich mit der Hand durch die schwarzen Locken, die ihm schweißnass in die Stirn hingen, und entblößte eine Reihe blendend weißer Zähne.
«He, amigo», lachte er. Der Mexikaner stieß sich mit seinem Stuhl vom Tisch ab und rollte einen mannshohen Schrank entlang, durch dessen Glasfront man unzählige Leuchtdioden blinken sah, zu David hin. Er musterte den Engländer. Seine Brille mit runden Gläsern und Metallgestell saß schief auf der breiten Nase. Die dunkelblonden Stirnfransen verliehen dem Gesicht etwas Schuljungenhaftes, obschon gut vierzig Lebensjahre auch ihre Spuren in dem bleichen Gesicht hinterlassen hatten. «Hast du gefunden der Bug!», radebrechte Salinas und klopfte David mit der flachen Hand auf die Schulter. Aufgeregt zeigte ihm David einige Systemmeldungen und erklärte, wie er sie interpretierte.
Noch einmal hieb ihm Salinas auf die Schulter. «Tenemos suerte!» Der Mexikaner erhob sich vom Stuhl und streckte sich. «Ja, Glück gehabt.» David beugte sich wieder vor und drückte einige Tasten. «Ich will nur noch ein paar Parity-Checks aufsetzen, dann wissen wir bald, ob wir das wirklich so fixen können, wie ich denke.»
«Hombre, jetzt genug gearbeitet. Wir jetzt wissen, wo sitzt der Bug. Fixen wir morgen. Gehen wir trinken jetzt ein Bud. Trommeln alle amigos zusammen, vom Institut, und machen fiesta.»
«Ich bin hundemüde.» David schaute auf die Armbanduhr.
«He, amigo.» Salinas markierte Tatendrang, indem er auffordernd mit der Faust der einen Hand in die offene Handfläche der andern schlug. «Warum so ernst?»
«Nein danke, keine fiesta, wirklich nicht.» Natürlich war David erleichtert, das Problem gelöst zu haben, aber wer wollte deswegen gleich die Nacht durchfeiern?
«Hombre! Du bist der Beste! Machst uns Durcheinander in Ordnung und willst ins Bett. Geht nicht.» Er zupfte sich das mit farbigen Blumen bedruckte Hemd zurecht und deutete ein paar Tanzschritte an. «Nur ein Bier! Kenne netten Club im Park. Vamos!»
David sagte nichts.
«Okay, dann lass uns feiern zu zweit. Wer es eilig hat ins Bett, kommt zu früh in Himmel. Ist schlecht übersetzt, aber ist wahr.»
David lächelte matt. Das leichtfertige Wesen des Mexikaners faszinierte und befremdete ihn gleichermaßen. Solches Verhalten war ihm selbst absolut fremd. Er riss sich zusammen.
«Vamos a la cerveza.»
Diesen Spanischversuch quittierte Salinas mit lautem Lachen. Abermals klopfte er ihm auf die Schulter. Dann verließen sie zusammen das Rechenzentrum.
Die Korridore waren um diese Zeit menschenleer. Nur in der Eingangshalle ging eine beleibte alte Frau in einer hellblauen Arbeitsschürze gemächlich mit einem Wischer hin und her, eine feuchte Spur auf dem Marmorboden hinterlassend.
«Hallo, Schöne!», grinste ihr Salinas entgegen und machte ein paar anzügliche Hüftbewegungen. «Kommst mit uns tanzen?» Die Frau hob nicht einmal den Blick vom Wischer und murmelte etwas Unverständliches.
Auf der Straße empfingen die Männer Verkehrslärm und schwüle Luft. Es war zwanzig Uhr, die Stadt begann sich mit Leben aufzuheizen. Sie bogen von der Avenida de la Universidad ab und gingen durch eine Seitengasse in Richtung Park. Aus den weit geöffneten Türen und Fenstern der Lokale klangen Samba-Rhythmen, was Salinas sichtlich beschwingte. «Buenas noches», rief er nach links, «qué tal, amigo» nach rechts. Er bahnte Evans einen Weg durch die dicht bevölkerte Gasse. «Diese Kneipe gehört Raúl», rief er über die Schulter zurück. «Hier kriegst du die beste Margherita!» David verstand im Gewühl von Stimmen und Musik nicht die Hälfte von Salinas’ Wortschwall. Der Lärm, die schwüle Luft und das Flackern der bunten Lichter betäubten ihn. Es fühlte sich an wie Watte im Gehirn. Salinas ging schnell, und David musste sich Mühe geben, den Anschluss nicht zu verlieren. Schließlich überquerten sie den Boulevard de la Revolución und betraten den Park.
Zielstrebig steuerte Salinas auf eine Bar zu. Blue Parrot prangte in verschnörkelter Leuchtschrift auf dem riesigen Strohdach. Kaum hatten sie das Lokal betreten, brüllte Salinas quer durch den Raum: «Dos Caipirinhas.» Gleichzeitig schob er David in Richtung Tresen. Der käsebleiche Brite fühlte sich inmitten all dieser dunkelhäutigen, leicht und farbig gekleideten Menschen fehl am Platz: mit seiner zerknitterten Bundfaltenhose, mit seinem karierten Hemd und in Socken!
Bis sie sich zum Tresen durchgekämpft hatten, standen die Drinks schon bereit. «Mein englischer Freund, David Evans», stellte Salinas seinen Gast dem Barmann vor. Zu David sagte er mit einer Kopfbewegung in Richtung Barmann: «Jorge hat die beste Caipirinha in der Stadt. Und noch mehr!» Er nahm die beiden Gläser vom Tresen und schwenkte eines vor Davids Gesicht hin und her. Gleichzeitig entblößte er seinen blitzenden Goldzahn in Richtung einer künstlichen Blondine mit dunkler Hautfarbe. «Pass auf, die hat es in sich.»
David griff nach der Caipirinha.
Schon hatte sich Salinas wieder abgewandt und grüßte einen Koloss, dem die Sonnenbrille am Kopf angewachsen schien. Dann zog er David dicht zu sich heran, während er etwas zu einer aufgetakelten Frau neben sich am Tresen sagte. Ihre knallroten Lippen verformten sich zu einem aufreizenden Kussmund. Ihr Blick war seltsam abwesend.
David reagierte nicht und konzentrierte sich stattdessen auf das Nippen an der Caipirinha. Er trank sonst kaum Alkohol. Damals, als die Jungs im Quartier die Rangordnung durch Saufen ausgemacht hatten, war für ihn Alkohol tabu gewesen. Erst nach der Operation hatte es ihm der Arzt erlaubt. Doch weder Wein noch Cocktails hatte er jemals besonders gemocht. Selten mal trank er ein Bier. David nippte wieder am Glas. Die Caipirinha schmeckte zu seiner Überraschung vorzüglich. Vor allem süß. Vom hohen Alkoholgehalt merkte er kaum etwas.
Unvermittelt packte ihn Enrique am Arm und zog ihn von der Bar weg auf die Terrasse: Muskelprotze mit gegelten Haaren und Kraftshirts, die den Blick auf Tattoos freigaben, und fast nackte Mädchen saßen in Korbsesseln an niedrigen Tischen. Hinter der Terrasse konnte man in der Dunkelheit einen See erahnen. Wasser spritzte, Männer brüllten, Frauen stießen spitze Schreie aus. David blickte abwesend ins Halbdunkel. Er nieste und wünschte die Klimaanlage im Rechenzentrum zum Teufel. Die pusten einem mit der kalten Luft die Krankheitserreger gleich kiloweise um die Ohren. Da muss sich einer ja erkälten!
«He, amigo, du hast Durst», schreckte ihn Salinas auf. Er nahm Davids Glas und streckte es in die Höhe, während er eines der leicht geschürzten Mädchen fixierte, die auf der Terrasse bedienten. Kurz darauf stand eine neue kalte Caipirinha vor David. Sie schmeckte noch besser.
Er lehnte sich müde zurück und überließ das Reden Enrique. Dieser wechselte von Fußball über Frauen zu Autos wieder zurück zu Frauen. David brauchte nur dann und wann zuzustimmen.
Auf einmal war Enrique weg.
Und sie saß neben ihm.
David hatte die Frau nicht kommen sehen. Sie saß einfach plötzlich da und schaute ihn an.
«Mercedes», sagte sie und hielt ihm neckisch die Hand hin.
Die Caipirinha fuhr in seinem Innenohr Achterbahn. Ein Paar dunkler Augen war auf ihn gerichtet, schaute aber durch ihn durch. Aus einem knallrot geschminkten Mund leuchteten Zähne weiß wie Eisberge.
Sie fühle sich einsam, sagte Mercedes.
Das konnte David verstehen. Weshalb sie sich gerade zu ihm an den Tisch gesetzt hatte, schon weniger. Und ganz unklar war ihm, warum ihr Bein über dem seinen hing. Ihre großen Brustwarzen drückten aufdringlich durch das eng anliegende Top.
David studierte die Tätowierung auf ihrem linken Unterarm: der gewundene Körper einer Schlange, gespannt wie eine Schnappfeder, jederzeit bereit, das Opfer zu attackieren. Auf dem Handrücken lag der Kopf der Schlange. Gebannt starrte David auf die gespaltene Zunge und fühlte eine kribbelnde Hitze in seinem Bauch. Nicht von der Caipirinha oder einer aufkeimenden Erkältung: Mercedes’ Hand lag auf seinem Hosenladen.
Sein Rücken verkrampfte sich, er biss auf den Rand des leeren Glases. Die Hitze stieg aus seinem Unterleib hoch und nahm ihm den Atem. Suchend blickte er sich um, doch Enrique war nirgendwo zu sehen. Das Mädchen fixierte ihn mit stechenden Augen. David war gelähmt wie das Karnickel im Angesicht des Todes.
«Hilf mir bitte, ich fühle mich so alleine», kratzte ihre Stimme. Es klang wie ein Befehl. Ihr Atem roch nach Alkohol. Eben noch schien sie jung, jetzt wirkte sie alt und verbraucht. Ihre Hand machte weiter auf seinem Hosenladen rum.
Solchen Druck hatte David schon ewig nicht mehr gespürt. Seit seiner Scheidung hatte er vor allem gearbeitet. Nur einmal bei einem Geschäftsessen in Japan hatte der Gastgeber zu einer besonderen Nachspeise eingeladen. Gleich drei Frauen hatten in einem Nebenzimmer auf ihn gewartet.
Mercedes knetete weiter. David versuchte zu entkommen. Sie drückte ihn in den Korbsessel zurück. Ihre Augen, ihr Atem nagelten ihn fest. Ein letztes Mal blickte das Karnickel in die ausdruckslosen Todesaugen – und gab auf.
2.Tag
London
Im Westen hing noch das schwere Dunkelblau der Nacht, während sich von Osten her der Himmel mit einem fahlen Rosa zu überziehen begann. Darin trieb der Wind die letzten Wolkenfetzen des heftigen nächtlichen Regens auseinander und verlieh dem Morgen etwas Dramatisches. Narcy Perez Corrales hatte dafür keine Augen, obwohl sie im Upperdeck des Lincoln-Busses einen wunderbaren Ausblick hatte. Mit der U-Bahn wäre sie zwar schneller in der Klinik gewesen, doch an diesem Morgen zog es sie nicht dorthin. Sie hatte eine schlechte Nacht hinter sich. Fortwährend hatte sie an die kleine Laura denken müssen und dabei kaum ein Auge zugetan.
Narcy war Ärztin aus Leidenschaft. Sie hatte das Medizinstudium mit eisernem Willen absolviert und mit den besten Noten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Dass sie die Weiterbildung nach dem Studium nicht zu Hause in Mexiko machte, war für sie selbstverständlich. Die USA kamen aber nicht infrage, obschon es dort sehr gute medical schools gab, die einem in der ganzen Welt die Türen zu den besten Kliniken öffnen konnten. Doch für den Lebensstil im übergroßen nördlichen Nachbarland hatte Narcy nicht besonders viel übrig. Sie hatte es vorgezogen, in die Alte Welt zu gehen und dort neben der medizinischen Weiterbildung auch noch etwas von englischer Kultur mitzubekommen. So hatte sie es sich wenigstens vorgestellt. Doch das Sechzig-bis-siebzig-Stunden-Pensum im St.James Hospital ließ für Musical, Theater, Konzert herzlich wenig Zeit. Immerhin war die medizinische Fortbildung hervorragend, und sie hatte es noch keinen Moment bereut, nach England gekommen zu sein. Aber es war auch immer klar für sie, dass sie irgendwann wieder nach Mexiko zurückwollte. Denn in ihrer Heimat würde sie als gut ausgebildete Ärztin dringender gebraucht.
Ines bin ich das schuldig.
Der Bus hielt vor dem St.James. Im selben Moment bog ein schwarzer Jaguar E auf den Parkplatz ein. Der Wagen von Michael McAvoy. Narcy wartete einen Moment mit dem Aussteigen. Sie wäre dem Kinderarzt nur ungern vor dem Rapport begegnet. Gestern war sie sich nach der Untersuchung von Laura zuerst etwas pingelig vorgekommen. Sie, die junge Ärztin, die dem erfahrenen Kollegen Vorschriften machte. Doch diese Unsicherheit war schnell Ärger gewichen.
Die Hygiene im Krankenhaus ist mein Job. Man mochte sie pingelig finden, Narcy bemühte sich schlicht um Gewissenhaftigkeit. Sie schüttelte den schwarzen Lockenkopf, erhob sich vom Sitz und stieg eilig die enge Treppe vom Upperdeck hinunter. Der Fahrer warf ihr einen entnervten Blick zu und spielte nervös mit dem Gaspedal.
Außerdem ist es Gesetz. An britischen Krankenhäusern waren je nach Größe der Klinik einer oder mehrere Infection Control Doctors Vorschrift. Doch die ICDs, wie man sie im Klinik-Jargon nannte, genossen nur geringes Ansehen, obschon sich die vorsorglichen Hygienemaßnahmen wirtschaftlich auszahlten. Denn sie verhinderten Neuinfektionen und verkürzten die Verweildauer der Patienten. Trotzdem passte es Typen wie McAvoy nicht, dass ihnen jemand auf die Finger schaute. Narcy stellte sich auf eine schwierige Zeit ein.
Sie atmete tief durch, betrat die Klinik durch den Haupteingang und nahm den Lift in den ersten Stock, wo ihr Büro lag. Sie beeilte sich, Regenmantel und Schirm abzulegen, und schlüpfte in den Arztkittel. Es reichte gerade noch für einen schnellen Kaffee vor dem Morgenrapport.
In der Kantine herrschte die für diese Uhrzeit übliche dumpfe Stimmung. Die einen waren müde von der Nachtschicht, die anderen noch nicht ganz wach. Narcy blickte sich mit der dampfenden Tasse auf ihrem Tablett um. An einem Tisch beim Fenster sah sie Meave Richards sitzen. Narcy kannte die Krankenschwester nicht gut, wusste aber, dass sie schon seit Jahren auf der Pädiatrie arbeitete. Noch bevor sich Narcy gesetzt hatte, stöhnte die Schwester: «Heute brauche ich einen Doppelten.»
Die Augenringe in Meaves breitem Gesicht zeigten, dass sie zu jenen gehörte, die die Nachtschicht hinter sich hatten. «Heute hilft aller Kaffee dieser Welt nichts.»
«War’s hart?», fragte Narcy und setzte sich.
«Und ob.»
«Was war denn los?»
«Der ganz normale Wahnsinn.» Meave wischte sich einige Krumen aus den Mundwinkeln.
«Und noch einiges dazu, nehme ich an?»
«Kann man wohl sagen. Auf 226 hat nun auch noch ein Junge Fieber gekriegt. Der hat die ganze Nacht geschrien.»
Auch das noch! Wenn im Zimmer von Laura noch ein Kind erkrankt war, bedeutete dies, dass sich die Infektion ausbreitete. Das Schlimmste, was einer Infektiologin passieren konnte.
Meave machte ein bekümmertes Gesicht. «Das Schlimme war, dass wir kein Mittel gefunden haben, um ihn zu beruhigen. Normalerweise hilft es, das Kind ein Weilchen auf dem Arm herumzutragen. Aber das war letzte Nacht vergebliche Mühe.»
«Zeigt er sonst Symptome?»
«Was bei Grippe halt so üblich ist.» Meave nahm einen Schluck Kaffee. «Schlimm war vor allem, dass er sich auf keine Art beruhigen ließ.»
Narcy wurde hellhörig. «Was zählen Sie denn zu den für Grippe üblichen Symptomen?»
«Na, die Gliederschmerzen halt, Fieber, Schleim in der Nase.»
«Das muss ich mir noch vor dem Rapport ansehen.» Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ Narcy den Kaffee stehen und stürmte aus der Kantine. Meave verschluckte sich an ihrem letzten Bissen Käsebrot und rannte hustend hinter der Ärztin her.
Im Zimmer 226 war eine Krankenschwester gerade damit beschäftigt, den Jungen umzubetten. Kaum sah sie Narcy und Meave herbeistürmen, machte sie ihnen Platz.
Kevin Stuart las Narcy auf dem Schild am Fußende des Bettchens.
«Weshalb ist er hier?», fragte sie die Schwester.
«Leistenbruch. In der fünften Woche operiert.»
Der Junge lag auf der Seite, die Augen halb geschlossen. Die Ärztin beugte sich über ihn und sah sofort den Schleim, der ihm aus der Nase lief. Er war deutlich gelb.
«Geben Sie mir bitte einen Spatel», bat Narcy die Krankenschwester, während sie in ihrer Manteltasche die Untersuchungslampe suchte. Sie knipste die Lampe an und näherte sich damit dem Kind, um ihm in den Mund zu schauen. Dabei strich der Lichtstrahl zufällig über Kevins Augen. Eine heftige Zuckung durchfuhr seinen Körper. Narcy stutzte und blickte Meave an. «Haben Sie das gesehen?»
«Was?»
Narcy richtete den Strahl der Lampe noch einmal auf die Augen des Jungen. Wieder zuckte er heftig zusammen.
«Ziemlich auffällig, meinen Sie nicht auch?»
Meave stemmte die Fäuste in die breiten Hüften – ratlos.
«Herrgott, passen Sie doch besser auf!», schnaubte McAvoy, als er wenige Minuten später davon erfuhr, dass noch ein Kind erkrankt war. In seine Stirn hatte sich eine tiefe Falte gegraben, die sich von der Wurzel seiner Aristokratennase bis zum Haaransatz zog. Er schaute verärgert in die Runde. Außer Narcy Perez Corrales und Meave Richards waren noch einige Krankenschwestern der sich ablösenden Nacht- und Tagschichten anwesend sowie ein paar Assistenzärzte und die beiden Oberärzte der Abteilung: Anne Heimann und Steve Sayer. Anne, eine Deutsche, lugte wie eine alte Lehrerin über den Rand ihrer Lesebrille. Sie war schon seit einigen Jahren Oberärztin, viele im Haus behaupteten, man habe sie auf diesem Posten abgestellt und sie werde es mit ihrer spröden Art nicht weiter schaffen. Steve kam eben vom Nachtdienst und sah entsprechend aus. Man nannte ihn im Krankenhaus den Kronprinzen. Er befand sich, was seine Karriere anging, auf der Überholspur. Obschon er einige Jahre jünger war als Anne, war allen klar, dass er dereinst McAvoys Chefposten übernehmen würde. Steve lehnte erschöpft im Stuhl und zeigte wenig Interesse am Rapport.
«Nicht, dass mich zwei Grippefälle besonders beunruhigen würden», schimpfte McAvoy, «aber die Verbreitung der Infektion zeigt, dass auf der Station zu wenig sauber gearbeitet wird.» Die kunstvolle Pause, die er einlegte, war exakt so bemessen, dass sich alle schuldig fühlen konnten. Mit donnernder Stimme fuhr er fort: «Ich will aber, dass bei uns die Patienten sicher sind. Ich will, dass unsere Klinik besser ist als alle anderen!»
Zuerst herrschte Schweigen im Raum. Allen war klar, dass mit unsere Klinik eigentlich ich, Michael McAvoy gemeint war. Und dem gab es nichts mehr hinzuzufügen. Schließlich getraute sich die einzige Person, die nicht fest zur Belegschaft der Kinderabteilung gehörte, die Stille zu brechen. «Doktor McAvoy, ich gebe Ihnen vollkommen Recht», sagte Narcy. «Sie weisen sehr deutlich darauf hin, wie wichtig die Hygiene auf den Stationen ist. Deshalb habe ich ja auch die verschärften Hygienevorschriften für Zimmer 226 angeordnet. Aber», sie wusste, dass das, was sie jetzt sagen würde, heikel war, «ich bezweifle, heute noch mehr als gestern, dass die Kinder an einer gewöhnlichen Grippe leiden.»
Das Schweigen, das sich jetzt über die Anwesenden legte, war ein anderes als jenes nach McAvoys Schelte. Die Krankenschwestern blickten betreten vor sich hin. Steve Sayer fuhr wie besessen mit dem Eingabestift auf seinem Organizer herum. Anne Heimann wischte sich so vehement ihre Nickelbrille sauber, als wollte sie das Glas durchreiben. Niemand wagte es, Narcy oder McAvoy anzublicken. «Doktor Perez Corrales», begann McAvoy langsam, indem er jedes Wort ganz deutlich aussprach. «Ich schätze Ihr Engagement als Gast auf unserer Abteilung sehr, doch jetzt schießen Sie übers Ziel hinaus. Wie kommen Sie zu der Annahme, dass es sich nicht um Grippe handelt?»
«Die Symptome stimmen nicht», antwortete Narcy selbstsicher.
«Und was, bitte schön, stimmt an den Symptomen nicht?»
Narcy hielt seinem bohrenden Blick stand. «Die Kinder zeigen eine auffällige Reaktion auf Lichtreiz. Das gehört nicht zur Grippe.»
McAvoy seufzte indigniert. «Auch wenn das nach Ihrem Lehrbuch nicht zur Grippe passt, lässt es sich sehr leicht erklären. Die Kinder sind krank, also geschwächt. Bei allgemeiner Schwächung kann es sehr wohl vorkommen, dass man nervös auf äußere Reize reagiert, sei es nun das Licht oder irgendein Geräusch oder anderes.» Er wandte sich an den jungen Oberarzt. «Oder wie sehen Sie das, Steve?»
Steve Sayer legte den Organizer zur Seite. Eigentlich war er Spezialist für Krankheitsübertragungen in der Klinik. Schon seine Dissertation hatte er über Tröpfcheninfektionen geschrieben, summa cum laude. Ein Grund, warum ihn McAvoy seinerzeit ins Team geholt hatte. «Ganz einverstanden», antwortete er nur. Sein Blick flatterte nervös zwischen McAvoy und Narcy hin und her. Die Hygieneärztin starrte mit zusammengepressten Lippen den Chef der Kinderklinik an. Die Zornesfalte, die sich dabei über ihre Stirn zog, hatte Sayer noch nie gesehen. Doch er konzentrierte sich sofort wieder auf McAvoy, der mit dem Knöchel des Zeigefingers entschieden auf den Tisch klopfte.
«Ich halte also fest: Wir behandeln weiter auf Grippe. Und Doktor Perez Corrales wird den Pflegekräften sicher gerne noch einmal die Hygienevorschriften erläutern.»
Der Rapport war beendet.
Mexico City, Universitätsrechenzentrum
Als David Evans im Rechenzentrum eintraf, saß Enrique Salinas bereits vor dem Terminal. Neben der Tastatur hing das Endlospapier bis auf den Boden hinunter. Der Mexikaner studierte die Resultate der Jobs, die über Nacht gelaufen waren. Er war munter wie immer. »Hola, amigo. Endlich raus aus den Federn?»
«Haha», sagte David mürrisch.
Salinas hob mit gespieltem Bedauern die Hände. «Oh, lo siento. Sorry, natürlich sollte zuerst fragen nach deine Nacht.» Er sprang von seinem Stuhl auf und bot David mit einer theatralischen Geste den Platz an.
David ließ sich auf den Stuhl sinken. Der Mexikaner stellte einen weißen Styroporbecher vor ihn auf den Tisch und riss den Plastikdeckel weg. Kaffeeduft stieg in Davids Nase. Salinas schaute ihn erwartungsvoll an.
«Na?»
David nahm den Becher und streckte ihn dem Kollegen hin. «Ganz hell bitte.»
«Da, Milchpulver. Sag schon: wie war die Nacht? Wie war sie?» David atmete tief ein, hielt einige Sekunden die Luft an und ließ sie geräuschvoll wieder entweichen. Dann streute er das Milchpulver in den Becher. «Keine Ahnung.»
«Hombre! Erzähl schon.»
David ließ den Kopf hängen und seufzte. «Blackout.»
Salinas setzte sich rittlings auf einen zweiten Stuhl und klopfte ihm aufmunternd auf den Oberschenkel. «Amigo, ich höre.»
«Ehrlich, Salinas, system error.»
«Aber Mercedes. So eine vergisst man nicht.»
David setzte die Brille ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. «In meinem Kopf herrscht ein Tohuwabohu. Lass mich in Ruhe.»
«Hast du sie genommen?»
«Salinas!» David wurde laut. «Hör auf, ich weiß es nicht!» Er rollte mit dem Bürostuhl in Richtung Computerterminal. Salinas sah ihm mitleidig nach.
«Bist du krank?»
«Mein Schädel brummt. Jeder Muskel schmerzt.» Er nahm einen großen Schluck aus dem Becher. Noch nie hatte ihm Automatenkaffee so gut geschmeckt. Dann blickte er Salinas mit wässrigen Augen an. «Es ist einfach zu viel. Ich bin dauernd unterwegs.»
«Ach was», unterbrach ihn Salinas, «Mercedes hat dir zugesetzt. Und du loco erinnerst dich nicht mal dran. Schade ums Geld.»
«Hör doch auf. Ich hab eine Influenza.» Mit halb drohendem, halb leidendem Blick versuchte David seinem Kollegen den Ernst der Lage klar zu machen. «Ich bin ausgelaugt. Verstehst du? Zu viel Stress. Immer auf Achse. Letzten Monat war ich kaum fünf Tage zu Hause in London.»
Salinas hob bedauernd seine dichten Augenbrauen.
«Dort habe ich es gerade geschafft, etwas Bürokram zu erledigen, Steuern und so. Dann war ich am Besuchstag noch kurz bei Sandy in der Schule.» Ein Lächeln huschte über Davids schweißnasses Gesicht. «War ganz lustig. Habe dort Leute getroffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Ellen, zum Beispiel. Sie hat ein Mädchen, das gleich alt ist wie Sandy. Und sie erwartete noch ein Kind. Mann, war die schwanger!» Salinas hatte eingesehen, dass aus David über die letzte Nacht nichts herauszuholen war.
«Manchmal habe ich bis Ende des Monats schon vergessen, wo ich überall war», fuhr David fort. «Überall herrscht Stress. Und überall sitze ich in so einem klimatisierten Bunker, wo man sich den Tod holt.»
«Ich könnte nicht dauernd unterwegs sein. Wo hast du deine Freunde?», sagte Salinas.
«Ach, weißt du…» David machte eine wegwerfende Handbewegung.
«Ich brauche meine Freunde. Wie gestern Abend. Und meine Familie, die Kinder, die Frau.» Er setzte eine Trauermiene auf. «Ohne sie, ich würde sterben!»
«Und ich würde zu Hause sterben», erwiderte David. «Ich bin gerne unterwegs. Trotz allem. Als Kind bin ich kaum aus dem verdammten Peckham rausgekommen. Alle Kinder aus meiner Straße sind an den Wochenenden aufs Land gefahren und haben was erlebt. Ich saß zu Hause und durfte mich nicht rühren. Samuel, mein Bruder, war bei den Pfadfindern und hat mir immer von seinen Abenteuern erzählt.» David stockte und wendete den Blick ab. «Samuel war ein Draufgänger.» Er schluckte und schwieg.
Salinas räusperte sich. «Amigo, kriege ich schon alleine hin. Gesundheit ist wichtiger.» Er klopfte ihm auf die Schultern und schnappte sich dann einen Computerausdruck vom Stapel. «Hier mach ich fertig – du gehst ins Bett.»
Zehn Minuten später saß David in der U-Bahn. Das Taxi, das ihm Salinas vors Institut bestellt hatte, hatte er nicht genommen, denn er liebte die U-Bahn. Die Augen halb geschlossen, genoss er die sanften Bewegungen des modernen Zugs. Angenehm einlullend. Kein Vergleich zu den alten Rüttelkisten auf der Picadilly oder der Oxford Line zu Hause. David versuchte anhand der Bewegungen des Wagens herauszufinden, wo er sich gerade befand. Dieser Rüttler eben war eindeutig. Nach Eugenia zweigte ein Gleis nach rechts in den Unterhaltsstollen ab. Also muss als Nächstes Centro Médico kommen. Kaum hatte er den Namen der Station gedacht, bremste die Bahn, die Schiebetüren öffneten sich mit einem Zischen, und herein drang der Lärm der Untergrundstation: blecherne Lautsprecherdurchsagen, Stimmengewirr, Klangfetzen von einem Saxophon.
Die folgende leichte Steigung bedeutete, dass gleich die gelbe Linie kreuzte, die nach Pantitlán hinausführte. David stellte sich die Röhren vor. Nach links ging es zum Observatorio, rechts kamen Salto Agúa, dann Pino Suarez. Jetzt kommt ein Streckenabschnitt, der schnell befahren wird. Und sogleich drückte ihn die Beschleunigung der Bahn in den Sitz.
David Evans hatte die kompletten Linienpläne von U-Bahn-Netzen auf der ganzen Welt im Kopf. Diese Fähigkeit hatte er seit seiner Jugend in London trainiert. Im Alter von acht Jahren konnte er die Stationen sämtlicher Londoner Linien rasend schnell in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Den Linienplan ergänzte er dann mit Verzweigungen, Nebengleisen und dergleichen. Er merkte sich Bewegungen, die er auf der Fahrt spürte, Geräusche, die er hörte; er verknüpfte die verschiedenen Linien, und so entstand in seiner Vorstellung allmählich das genaue Schema des U-Bahn-Netzes. Nach einem Jahr hatte er ein dreidimensionales Abbild des Londoner Untergrundes in seinem Kopf.
Mit der Zeit hatte er dann gemerkt, wie gewandt er sich in diesem Modell zurechtfand, und er hatte begonnen, sein ganzes Wissen in einer Art Röhrensystem zu ordnen. Wenn er in seinem Gedächtnis nach etwas suchte, stellte er sich vor, er würde sich durch diese Röhren bewegen. Wobei er sich nie konkrete Röhren im Sinne von Metallrohren vorstellte. Seine Gedankenwelt enthielt keinerlei optische Informationen, wie ein 3-D-Konstruktionsprogramm im Computer ohne Oberflächentextur. Ihm genügte die rein logische Informationsstruktur, und er wusste präzise, wo er etwas finden und wie er sich dorthin navigieren konnte.
In diesem Moment klangen die von der Tunnelwand zurückgeworfenen Fahrgeräusche etwas dumpfer. Die Strecke verbreitert sich hier also auf drei Gleise. In wenigen Augenblicken müssen die Fahrgeräusche wieder heller werden. Die dritte Spur biegt nach links ab, Richtung Cuatro Caminos.
«Tiquete», riss ihn eine Stimme aus seinen Gedanken. Eine harte Hand rüttelte an seiner Schulter. Er öffnete die Augen und blickte auf eine blaue Uniform. Ein Bahnbeamter stand breitbeinig vor ihm. «Ticket please», wiederholte der Kontrolleur.
Hastig durchwühlte David seine Tasche und streckte dem Mann dann eine Mehrfahrtenkarte entgegen. Nachdem der Beamte einen Moment auf die Karte gestarrt hatte, begann sein schwarzer Schnurrbart zu zittern, und er knurrte etwas auf Spanisch. David verstand nichts, fasste es aber nicht als Einladung zum Abendessen auf. Der zweite Beamte stand so plötzlich neben David, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Er war nicht weniger breit gebaut als der erste und verbreitete nicht weniger schlechte Laune. Ohne viel Umschweife hakten die Beamten David links und rechts unter und zerrten ihn an der nächsten Station aus dem Wagen. Die anderen Passagiere schauten unbeteiligt zu. In der U-Bahnvon Mexico City war täglich zigmal zu beobachten, wie ein Controllista einen Schwarzfahrer herauspflückte. Auch David hatte diese Szene schon beobachten können. Darum wusste er auch, was nun auf ihn zukam.
Das Unheil nahte in Gestalt zweier Polizisten, die den Kontrolleuren zu Hilfe kamen, kaum standen sie mit David auf dem Bahnsteig. Die Übergabe des Schwarzfahrers an die Gesetzeshüter ging fliegend vonstatten. Ehe David sich’s versah, stand er mit den Händen auf Kopfhöhe an der gekachelten Wand der Station. Panik erfasste ihn, und die Narben an seinem Unterbauch begannen heftig zu jucken. Instinktiv wollte er mit einer Hand in die Hosentasche greifen, um sich zu kratzen. Doch bevor er diese erreichte, traf ihn ein brutaler Handkantenschlag zwischen Hals und Schulter. Halb betäubt vor Schmerz stützte er seine Hand wieder an die Wand. Im nächsten Moment knallte ihm von hinten ein schwerer Stiefel zwischen die Fersen und schlug ihm die Beine auseinander. Alles geschah blitzschnell und wortlos. Zwei stahlharte Pranken griffen unter seine Achseln, fuhren über die Brust, glitten den Rücken hinunter, tasteten sich die Schenkel hoch und fassten ihm zwischen die Beine. Schließlich wühlten sie in seinen Hosentaschen. Hinter sich hörte David blechernes Quäken aus einem Funkgerät. Als der Polizist seine Hände aus Davids Hosentaschen gezogen hatte, hielt er eine triumphierend seinem Kollegen vors Gesicht. Auf der Handfläche lag eine zerknüllte Aluminiumfolie mit einigen Krümeln einer weißen Substanz. David hätte sich verfluchen können. Wieso nur trug er das Zeug einfach so in der Hosentasche? Nicht genug, dass er darauf angewiesen war, jetzt brachte es ihn auch noch in Schwierigkeiten. Und das in einem Land, wo der Justizapparat nicht gerade einen zimperlichen Umgang mit Verdächtigen pflegte.
Mit metallischem Klicken schnappten die Handschellen hinter seinem Rücken zu. Dann zerrte der Typ Davids linken Hemdsärmel zurück. Er spürte förmlich den Blick des Mannes über seinen Unterarm wandern. Die Innenseite war übersät mit Narben von Nadeleinstichen. Und zwischen Handgelenk und Ellbogen prangte eine gerötete Knolle. Die Polizisten hatten genug gesehen.
Im Polizeirevier drückten ihn die beiden auf eine Holzbank und verschwanden durch eine Tür. Etwa zwanzig Leute befanden sich im Raum. Neben David saß ein Mann mit verfilztem Bart. Sein Kopf hing schlaff vornüber, und er murmelte unverständlich vor sich hin. David rückte von ihm weg. In einer Ecke schluchzte eine ausgemergelte Frau trostlos. Der Geruch von Alkohol und Schweiß lag in der schwülen Luft. David hatte das Gefühl, gleich würde der schwere Dunst seine Nase verkleben. Sein Körper meldete sich zurück: eine fiebrige Welle jagte durch seine Glieder. Schweiß trat ihm aus allen Poren und gleichzeitig fröstelte ihn. Der Polizist hinter dem kleinen Schreibtisch starrte teilnahmslos vor sich hin. Nur von Zeit zu Zeit schreckte er kurz aus seiner Lethargie auf, wenn eine Stimme aus der Gegensprechanlage quäkte. Dann führte er einen der Wartenden durch eine Tür.
Identificación stand darauf.
Endlich war David an der Reihe.
Im Identifikationsraum begann ihn sogleich ein überaus dicker Beamter mit monotoner Stimme auszufragen. «Nombre, Apellido, Sexo, Fecha de nacimiento.» Er tippte Davids Angaben, ohne eine Miene zu verziehen, mit zwei fetten Fingern in einen Computer. Erst danach befreite ein Polizist David von den Handschellen. Er rieb sich die roten Abdrücke an den Handgelenken. Bestimmt würden sich dort bis morgen zwei hässliche Blutergüsse gebildet haben. David kannte das, denn sein Gewebe war dafür äußerst anfällig. Seit er das Medikament schlucken musste, hatte er immer irgendwo einen tiefblauen Fleck.
Die Tür wurde aufgerissen, und ein schlanker Mann in einem weißen Arztkittel trat ein. Inmitten all der blau uniformierten Beamten wirkte er wie ein Fremdkörper. «Ich möchte mir Ihre Arme ansehen», sagte der Arzt in gut verständlichem Englisch. Er besah sich die Einstichstellen. «Tragen Sie ein medizinisches Papier an sich?»
David zeigte ihm seinen Behindertenausweis, und fünf Minuten später war er entlassen. Gleich das erste Taxi, das er heranwinkte, hielt.
London, St.James Hospital
Kaum hatte sich die Tür des Aufzugs geöffnet, hörte Narcy das laute Weinen eines Kindes. Nicht das Babygewimmer, wie es auf der Neugeborenenabteilung fast andauernd aus irgendeinem Zimmer zu hören war, sondern verzweifeltes Schluchzen. Narcy eilte den Flur entlang, um nachzusehen, was los war.
Schon den ganzen Tag über war sie von Station zu Station gehetzt. Hatte sich einen Dauerhusten auf der Geriatrie angeschaut, eine Wundinfektion auf der Chirurgie, ein Ekzem auf der Onkologie. Die Statistik besagte, dass jeder zehnte Patient sich erst im Krankenhaus eine Infektion zuzog. Das zu verhindern war Narcys Job.
Fünfzehn Uhr war schon vorbei, und vor lauter Gerenne war sie noch nicht einmal dazu gekommen, zu Mittag zu essen, geschweige denn, ihren Papierkram zu erledigen. Als sie sich eben zur Kantine aufmachen wollte, gab der Beeper wieder Alarm. Eine Krankenschwester der Kinderabteilung rief dringend nach ihr. Narcy ignorierte den nagenden Hunger.
Sie bog um die Ecke und erblickte vor Zimmer 226 ein weinendes Mädchen. Sie schätzte es auf etwa acht Jahre. Eine Frau versuchte es zu trösten. Daneben stand ein großer Mann dunkler Hautfarbe. Eine Krankenschwester stand mit dem Rücken zur Zimmertür und sah hilflos zu. Als sie die Ärztin kommen sah, seufzte sie erleichtert auf. «Hier kommt Doktor Perez Corrales. Sie wird Ihnen alles ganz genau erklären.»
Bevor Narcy dazu kam, die Schwester zu fragen, worum es ging, klagte die Frau: «Doktor, die Schwester will uns nicht zu Laura lassen!»
Erst jetzt erkannte Narcy Ellen Livingston. Sie sah noch schlechter aus als am Vorabend. Ihr Haar hing schlaff herunter, sie war blass, der Blick flackerte nervös. Narcy berührte sie zur Begrüßung leicht an der Schulter, denn Ellen hatte beide Arme um das weinende Mädchen gelegt. «Beruhigen Sie sich bitte, wir werden das gleich klären.» Narcy legte dem Mädchen ihre Hand auf das Kraushaar. «Was ist denn passiert?»
«Das ist Allanah», antwortete die Mutter. «Sie hat heute schulfrei, und wir wollten alle zusammen Laura besuchen.»
«Brian Livingston», stellte sich der Mann vor und streckte Narcy die Hand entgegen. Er war groß gewachsen, mit einem sympathischen Gesicht und ersten Silberstreifen im schwarzen Haar.
«Ich dachte, es sei besser, wenn das Mädchen da nicht reingeht», mischte sich die Krankenschwester ein. «Ich halte mich nur an Ihre neuen Hygienevorschriften», fügte sie fast entschuldigend hinzu.
«Das war korrekt, Sheila», antwortete Narcy. «Ich bin froh, dass Sie mich gerufen haben.» Sie wandte sich wieder dem Mädchen zu, das sich etwas beruhigt zu haben schien. «Weißt du, Laura ist schlimm krank, und nun ist leider noch ein anderes Baby krank geworden, darum müssen wir sehr aufpassen, wer zu den Kleinen ins Zimmer geht. Wenn du zum Beispiel einen Schnupfen hättest, dürftest du nicht hinein, weil das Laura noch kränker machen könnte. Und um da sicherzugehen, hat Schwester Sheila nach mir gerufen.» Narcy zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht, auch wenn ihr nach diesem Tag überhaupt nicht danach zumute war.
«Das können Sie doch nicht machen.» Ellen Livingston klang verzweifelt. «Erst sagen Sie, Laura hätte eine Grippe, dann wird sie jeden Tag kränker, und jetzt wollen Sie uns nicht mal zu ihr reinlassen. Bitte.»
Brian legte den Arm um die Schultern seiner Frau. «Es ist wirklich etwas viel. Verstehen Sie das bitte. Meine Frau sagt mir, dass sie sich von Doktor McAvoy schlecht betreut fühlt. Er erklärt ihr praktisch nichts, und auch das wenige nur in unverständlichem Fachchinesisch. Eine Grippe kann doch wirklich kein Grund sein, uns nicht zu Laura zu lassen.»
«Leider doch», antwortete Narcy.
Wenn es doch nur eine Grippe wäre!
Den Tag über hatte Narcy mehrere Male auf der Kinderstation angerufen und sich nach Laura erkundigt. Was sie von den Schwestern erfahren hatte, war nicht ermutigend gewesen. Ihr Zustand war unverändert kritisch. Zum letzten Mal hatte Narcy diese Auskunft vor ungefähr einer Stunde erhalten. Doch das wollte sie den Eltern Livingston nicht zwischen Tür und Angel sagen, bevor sie das Baby nicht selbst untersucht hatte. Überhaupt war die offizielle Erklärung auf McAvoys Anweisung hin ja immer noch dieselbe. Also erklärte Narcy den Eltern geduldig, dass eine Grippe zu den ansteckendsten Krankheiten gehöre und dass die Infektion tatsächlich schon von Laura auf ein weiteres Kind übergegangen sei, was in Zukunft verhindert werden müsse.
Brian und Ellen waren dankbar, dass sie endlich etwas umfassender informiert wurden. «Warum geben Sie Laura denn nicht einfach Antibiotika?», fragte der Vater. «Das hilft doch immer.»
«Leider nicht», antwortete Narcy. «Antibiotika wirken nur gegen lebendige Erreger. Der Name Anti Biotika sagt das schon. Aber Viren sind nichts wirklich Lebendiges.»
Plötzlich heulte Allanah laut auf, wohl in erster Linie deshalb, weil sie die Aufmerksamkeit der Erwachsenen wieder auf ihren Seelenschmerz lenken wollte. Der Erfolg stellte sich sofort ein. Ellen kauerte sich zu ihr hinunter und tröstete sie mit leisen Worten.
«Schau, Allanah.» Narcy griff in die Tasche ihres Kittels und zog eine Plastikfigur und einen Apfel hervor. «Diesen Piraten hier hat mir heute ein Kind geschenkt. Und das ist mein Pausenapfel, den ich bis jetzt noch nicht essen konnte. Ein Virus, wie dein Schwesterchen einen hat, ist so etwas wie ein Pirat, und er sieht fast aus wie dieser Apfel.» Das Mädchen stutzte und vergaß das Weinen. «Ganz innen im Apfel sitzen die Kerne. Damit pflanzt sich der Apfelbaum fort. Aus jedem Apfelkern wächst ein Apfelbäumchen.» Allanah schniefte noch zwei-, dreimal ziemlich demonstrativ, aber Narcy spürte, dass sie ihre Aufmerksamkeit geweckt hatte. Sogar die Eltern hörten interessiert zu. So, wie der Apfel eine Schale hat, besitzt das Virus eine Hülle.