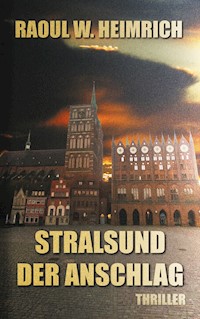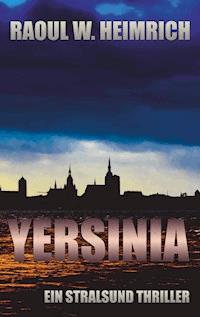
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Einwohner der idyllischen Hansestadt Stralsund ahnen nicht, dass der skrupellose russische Ex-General Kostrakowitsch ihre Stadt zum Schauplatz brutaler Kämpfe um eine der grausamsten Waffen aus der Zeit des Kalten Krieges machen wird. Doch als ihm ungewollt die Krankenschwester Katrin, der Gelegenheitsarbeiter Thomas und der Ozeanologe John in die Quere kommen, gerät die Situation außer Kontrolle. Am Ende steht der Waffe nur die Kriminalpolizistin Johanna im Weg. Wird sie in der Lage sein, deren Einsatz zu verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Raoul W. Heimrich wurde 1964 in Berlin geboren. Bevor er Regisseur wurde, war er Fotograf, Stuntman und Regieassistent. Seine Filmografie umfasst Filme und Serien wie Der Alte, Wasserschutzpolizei Bodensee, Cobra 11, Der Clown, Küstenwache, Ein Fall für Zwei und Aktenzeichen XY ungelöst.
Seine Kenntnisse der hier im Roman vorkommenden Kampftechniken, sind nicht nur theoretischer Art. Er ist lizenzierter Krav Maga Instructor, trägt den 1. Dan in Karate und den 5. Dan im Bujinkan Budo Taijutsu (Ninjutsu).
Raoul W. Heimrichs Lieblingsautoren sind Tom Clancy, Robert Ludlum und Andreas Eschbach.
Er lebt in seiner Wahlheimat Stralsund und arbeitet überall da, wo ihn die Dreharbeiten hinrufen.
Yersinia ist sein erster Roman.
Alle Figuren dieses Romans sind vom Autor frei erfunden.
Jegliche auch nur entfernte Ähnlichkeit mit realen Personen
– lebenden oder toten – und Ereignissen wäre reiner Zufall.
Auch wenn die fiktive Handlung an tatsächlich existierenden
Schauplätzen spielt, so hat sich der Autor doch die Freiheit
genommen, in wenigen Fällen von der Realität abzuweichen,
wenn es die Geschichte erfordert.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei meinem Freund Stephan für das Lektorat und bei meiner lieben Silke für ihre endlose Geduld und ihr Verständnis, wenn ich nach dem Schreiben völlig entrückt aus meinem Yersinia-Universum zurückgekehrt bin. Auch an Thomas, vielen Dank für deine Mühe!
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Epilog
Prolog
Mit einem sirrenden Geräusch durchschnitt der Schlagstock die Luft und traf auf den ausgezehrten Körper. Das wievielte Mal ihn der Stock erwischte, wusste Wladimir nicht, er hatte längst aufgehört zu zählen. Nur war dieses Mal etwas anders: diesmal krachte es, als zerträte jemand einen dürren Ast. Ein paar Rippen zerbrachen. „Du verdammtes Stück Dreck, hör endlich auf zu lachen!“, brachte der Wärter keuchend hervor. „Was ist mit dir nicht in Ordnung, spürst du denn gar nichts?!“ Der Aufseher holte erneut aus, durch die blutverschmierten Augen erkannte Wladimir den Schweißfleck unter der Achsel des Mannes. Sein Speichel flog ihm entgegen. „Glaubst du vielleicht, weil du aussiehst wie der letzte Zar, bist du etwas Besonderes?!“ Der Stock prallte ein letztes Mal auf den Gefangenen. Nach Luft japsend ließ der Gefängniswärter den Knüppel sinken. Dann wischte er sich mit dem Ärmel des Uniformhemdes den Schweiß aus dem Gesicht. Ihn forderte die Prozedur deutlich mehr als das blutendende Bündel Mensch auf dem dreckigen Boden der Zelle vor ihm. „Du wirst Scheiße fressen, wie alle anderen!“, wütete der Mann. Völlig erschöpft holte er mit dem Bein Schwung und trat zu. Wladimir sah noch den Fuß auf sich zurasen, dann traf die Stiefelspitze die linke Schläfe; es blitzte vor seinen Augen auf, bevor ihn gnädige Dunkelheit entführte.
Nach Sonnenuntergang wagte sich eine Kakerlake aus ihrem Versteck. Der am Boden zusammengekrümmte Körper erschien ihr nicht gefährlich, bewegte dieser sich doch seit Stunden nicht. Sie kroch über das deformierte Gesicht des Gefangenen, das leichte Zucken der Augenlider beeindruckte die Schabe nicht. Wladimir spürte das Kitzeln, das die Beine des Insekts erzeugten, schaffte es aber erst Minuten später, die Augen zu öffnen. Er vergewisserte sich, dass er, abgesehen von dem sechsfüßigen Mitbewohner, wieder allein in der Zelle war. Dann streckte er die mit Blut verkrustete Hand aus und fasste unter die nach Moder riechende Matratze. Der angespitzte Löffel, mit dem er vor wenigen Stunden zwei Männern die Kehlen aufgeschlitzt hatte, lag noch sicher im Versteck. Wladimirs geschwollenes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, das einem Grinsen nur entfernt ähnlich sah. Die Schließer würden nie herausfinden, dass er es war, der den beiden Verrätern einen kalten Abgang verschafft hatte.
Wladimir betastete die gebrochenen Rippen und schob eine davon wieder an ihren angestammten Platz zurück. Ein animalischer Schmerzenslaut drang aus der Tiefe seines Körpers. Zitternd blieb er liegen, ohne sich zu regen.
Für einen Moment starrte er an die Decke und musterte das weitverzweigte Muster gerissenen Betons. Er kannte jeden einzelnen Riss, hatte ihnen im Laufe der Jahre Straßennamen gegeben. Der Straßen seiner Heimatstadt, Sankt Petersburg, der Zarenstadt. Auf einmal kamen ihm die Worte in den Sinn, die der lächerliche Wärter zu ihm gesagt hatte.
… weil du aussiehst wie der letzte Zar …
Es klang in ihm nach, formte sich zu einer Vision der Zukunft! Wladimir wusste jetzt, wie er seine Rache bekäme. Er musste nur noch die kommenden zwei Jahre hier in der Hölle von Kresty überstehen, dann hätte seine Stunde geschlagen! Die Straßenzüge an der Decke verschwammen und verwandelten sich zu einer Buchstabenfolge:
Y–e–r–s–i–n–i–a.
Trotz der Verletzungen verhärteten sich Wladimirs Gesichtszüge. Für ihn bedeutete Yersinia der Schlüssel zum Triumph, und dieser Schlüssel lag in einer kleinen Stadt im Nordosten von Deutschland: in Stralsund!
Kapitel 1
Fünf Windstärken! Wie geil ist das denn?! John McFerrow stieß sich mit dem rechten Bein vom schlammigen Grund des Bodens ab und zog sich auf das Brett hinauf. Sofort fing sich der Wind im Segel und los ging es! Vor ihm lag der in der Sonne glitzernde Sund, über dem eine beeindruckende Schar lautstark kreischender Möwen kreiste. Wenn er den Kopf drehte, erblickte er am anderen Ufer das malerische Panorama der alten Hansestadt. John sog genussvoll die nach Tang und Meerwasser riechende Luft ein. Er kniff die Augen zusammen und schaute in die Sonne. Dann kam er endlich ins Gleiten.
John hing sicher im Trapez und ließ sich in nördliche Richtung tragen. Der Wind kam geradewegs von Stralsund herüber und er nahm den Geruch der alten Hansestadt wahr. John flog förmlich an Altefähr vorbei, kreuzte zügig die Fahrrinne und hielt auf Parow zu. An der Backbordseite glitt das Ozeaneum vorüber. Obwohl er dort als Praktikant arbeitete, zerbrach John sich immer wieder den Kopf, was die eigenwillige Architektur dieses Gebäudes darstellen sollte. Die davor festgemachte Gorch Fock schaute er sich jedes Mal an, wenn er einen Anklang von Sehnsucht nach O’ahu verspürte. Die zweiundachtzig Meter lange Bark gab ihm das Gefühl, nicht mehr so weit weg von zu Hause zu sein.
Auf einmal erwischte ihn eine hohe Welle, sie brachte ihn mit einem Schlag in die Gegenwart zurück. Das Brett hob ab und er segelte ein Stück durch die Luft. Ein Schrei der Verzückung erklang aus seiner Kehle.
Für Thomas Mitscherling gab es im Moment überhaupt keinen Grund, sich zu freuen. Er stand im verfallenen Hinterhof einer ehemaligen Fabrik und versuchte, eine rostige alte Tonne aus dem Boden zu ziehen. Thomas hatte vor lauter Gestrüpp und Unrat schon eine Ewigkeit gebraucht, das Teil zu finden, und zu seinem Verdruss steckte das Mistding auch noch wie einbetoniert fest. Dabei hatte der Auftrag doch so einfach geklungen: Er sollte nur eine Tonne abholen und zum Hafen Saßnitz bringen. Von dort führe sie dann mit der nächsten Fähre nach Sankt Petersburg. Thomas wusste weder, was in dem rostigen Ding drin war, noch interessierte es ihn. Zwar entzifferte er die kyrillischen Buchstaben, die auf der Vorderseite standen, aber die Bedeutung der Wörter, so er sie jemals in der Schule gelernt hatte, hatte er längst vergessen. Thomasʼ einziges Interesse galt wie immer nur der Bezahlung, und diese war in diesem Fall gut, um nicht zu sagen, ausgesprochen gut!
Seit er aus der Stralsunder Volkswerft entlassen worden war, hielt er sich mit den verschiedensten Jobs über Wasser. In der Schiffswerft hatte er als Schweißer gearbeitet. Er hatte gut verdient, und naiv hatte er geglaubt, dass dies, bis er in Rente ginge, so bliebe. Aber dann kam alles anders. Die Werft ging fast pleite und von den einst knapp zweitausend Arbeitern blieben am Ende nur noch dreihundert übrig. Thomas gehörte nicht dazu.
Zu seinem Glück hatte ihm sein Vater einen alten Barkas-Transporter hinterlassen. So verdingte er sich als Gärtner, Sperrmüllfahrer, Umzugshelfer, machte eben alle Arbeiten, bei denen ein Transportfahrzeug zum Einsatz kam. Mit der Zeit gewöhnte er es sich ab zu fragen, was er transportieren sollte. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, wurde seine Devise. So war es auch diesmal, der Auftraggeber wollte die Tonne nach Saßnitz haben, also würde er sie dorthin liefern. Aber dafür musste er sie zunächst aus dem Boden bekommen. Ob es die Angelegenheit vereinfachte, wenn er erst den Inhalt herausnahm? Er packte das Stemmeisen und hantierte damit am Deckel des alten, verrosteten Fasses herum. Er schwitzte vor Anstrengung wie ein Finne in der Sauna, bis der Deckel endlich nachgab. Aber kaum, dass er ihn öffnete, bereute er es auch schon. Ein seltsamer, ekelerregender Gestank schlug ihm entgegen. Hastig brachte er die Abdeckung wieder an. Dabei erhaschte er einen Blick auf ein rotbraunes, silbrig glänzendes Pulver, das den Anschein erweckte, es bewege sich etwas darin. Thomas erinnerte es an einen Horrorfilm, den er in seiner Jugend gesehen hatte. Die Zombies, die dort aus Tonnen gekrochen waren, hatten ihm schlaflose Nächte bereitet. „Da lass mal lieber die Finger von!“, ermahnte er sich selbst. „Jetzt denk erst mal nach!“ Thomas setzte sich auf die Ladefläche des Wagens und zündete eine Zigarette an. Er grunzte missmutig, es war die letzte Kippe dieser Schachtel. Wie bekomme ich dieses Scheißteil endlich hochgewuchtet?, fragte er sich. In der Hoffnung, durch das Nikotin Erleuchtung zu erlangen, saugte er gierig am Glimmstängel, inhalierte tief und blies den Rauch in Richtung der weißen Schäfchenwolken am Himmel.
Kathrin Hillmer rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Sie hatte ihrer Schwester versprochen, Lydia aus der Kita abzuholen, und nun das. Der Lehrgang an der Heilpraktikerschule fand einfach kein Ende, dabei schloss der Kindergarten in zehn Minuten!
An sich interessierte Kathrin das Thema des Tages enorm, es ging um Blutegel und ihre Anwendung bei verschiedensten Entzündungen im Körper. Nur schlief die Lehrerin beim Reden fast ein und kam einfach nicht zu einem Ende. Kathrin glaubte nicht, was sie hörte: „So, zum Abschluss, setzen Sie sich selber einen Blutegel an! Sie werden fühlen, wie sich der Biss anfühlt, und einige werden vielleicht sogar etwas von der Wirkung mitbekommen. Kommen Sie bitte nach vorn, in jedem Glas sind zwei Würmer für Sie. Und vergessen sie nicht, sich ein Stück Küchenpapier mitzunehmen, sonst gibt es hier eine Riesensauerei!“ Kathrin reichte es. Sie sprang auf, lief zu dem Tisch, auf dem die Gläser mit den kleinen, sich im Wasser schlängelnden Blutegeln standen. Sie schnappte sich eins der Behältnisse und stürzte aus dem Zimmer, wobei sie noch ein „Sorry, aber ich hab nen Notfall“ in den Raum rief.
Kathrin rannte aus dem Gebäude und warf dabei einen Blick auf die Uhr des Handys. Noch acht Minuten – mit ein wenig Glück würde sie noch pünktlich in der Kita ankommen, um zu verhindern, dass ihre Schwester einen Herzkasper bekam.
John McFerrow behielt den Kurs auf den Funkturm von Parow bei. Der Wind legte noch ein wenig zu, John sprang immer höher über die Wellen, der daraus resultierende Spaß kannte keine Grenzen mehr! Ein Kriegsschiff kam in Sicht. Es lag am Kai der Marinetechnikschule von Parow. Dass er auf eine Militärschule zu fuhr, wusste John allerdings nicht. Bis jetzt hatte er noch nie ein Schiff dort liegen sehen, wenn er im Sund surfen war. Plötzlich hörte er einen kurzen, aber dafür lauten Ton von der Fregatte zu ihm herüberwehen, gefolgt von einem langen, tiefen Tröten, dem gleich noch ein kurzes Signal nachfolgte. John hörte es, verstand aber nicht, dass es ihm galt. Da er seinen Kurs unbeirrt beibehielt, ertönte erneut das Horn des Schiffes. Dann hörte er eine Megafonstimme, der Wind um ihn herum verhinderte allerdings, dass er die Worte verstand, und so fuhr er weiterhin auf das Kriegsschiff zu, nicht ahnend, dass er mittlerweile in militärischem Sperrgebiet surfte. Plötzlich herrschte hektische Betriebsamkeit auf der Fregatte. Die Mannschaft begann, fieberhaft das Maschinengewehr auf dem Vorderdeck klarzumachen. John erschrak bei diesem Anblick. Er wollte nicht herausfinden, was die Soldaten auf dem Schiff damit vorhatten. John leitete eine schnelle Wende ein und beeilte sich, zurück in Richtung der Rügenbrücke zu kommen.
Thomas starrte minutenlang auf die leere Zigarettenschachtel. Missmutig knüllte er sie zusammen, hob den Arm, um sie wegzuschmeißen, hielt aber abrupt in der Bewegung inne. Er faltete die Schachtel wieder auseinander und starrte auf das Bild darauf. „Oh Mann, da hättest du auch gleich drauf kommen können!“, maulte er sich voll. Das Bild der Pyramide auf der Schachtel erinnerte ihn an eine Fernsehsendung der letzten Woche. Darin ging es um diese Grabstätten und darum, wie die Pharaonen sie einst errichteten. Tausende Arbeiter schufteten daran. In der Schule hatte er noch gelernt, dass diese großen Gräber in Ägypten von unzähligen Sklaven gebaut worden waren. Doch die Sendung belehrte ihn, dass diese Vermutung falsch war. In der glühenden Sonne schufteten nicht nur Sklaven. Auch Handwerker und Bauern beteiligten sich und bekamen dafür Geld. Dumm nur, dass gerade diese Arbeitskräfte fehlten, um die Wirtschaft im Zweistromland am Laufen zu halten. Dadurch ging dieses gewaltige Imperium schlussendlich vor die Hunde. „Vor die Hunde gehe ich auch, wenn ich diese blöde Fracht nicht endlich auf den Wagen bekomme!“, dachte Thomas laut zu Ende. Er sah deutlich die Bilder vor sich, wie endlose Massen von Menschen unglaublich große Steinblöcke auf Rollen zogen. Zwar besaß er keine Heerscharen, die ihm beistanden, aber einen Barkas! Er ergriff den Verladegurt, wand diesen einmal um die Tonne und befestigte ihn dann an der Abschleppöse. Er stieg in den Wagen und startete ihn. Zuversichtlich legte er den ersten Gang ein und trat aufs Gas. Thomas’ kurze Euphorie verschwand sofort wieder. Außer dass die Vorderräder durchdrehten, tat sich nichts. „Will mich hier einer verarschen, oder was?!“, grunzte er. Diesmal legte er den zweiten Gang ein. Vorsichtig ließ er die Kupplung kommen. Er schaute in den Rückspiegel, tat sich da endlich etwas? Ja, etwas geschah, aber aus dieser Perspektive und Entfernung sah er es nicht: Der Gurt begann, sich an einer Scheuerstelle aufzudröseln!
Doch zunächst riss nur Thomas der Geduldsfaden, energisch trat er aufs Gaspedal. Für einen Augenblick schien es, als ob der Gurt in das Fass hineinschneiden würde, dann aber gab es einen Ruck, das Fass sprang endlich heraus und ein lautes, schmatzendes Geräusch drang zu Thomas in die Fahrerkabine. „Herzlichen Glückwunsch, du alter Gauner“, beglückwünschte er sich selber ob seiner genialen Idee, die er den altertümlichen Pharaonen abgeguckt hatte. Dann schaute er auf die Uhr und erschrak. Oh Scheiße, wie soll ich denn jetzt diese verfluchte Fähre noch erwischen? Gehetzt sprang er hinaus, legte die Rampe an und rollte das Fass auf die Ladefläche. Hektisch befestigte er das Fass mit dem Gurt, mit dem er es eben noch herausgezogen hatte. Zu allem Überfluss klingelte jetzt auch noch das Handy, seine Frau Beate rief ihn an: „Bist du heute pünktlich? Du hast sicher schon wieder vergessen, dass Evelyn und Jürgen heute Abend kommen, oder?“ – „Nein, natürlich habe ich das nicht vergessen. Du, ich hab’s grade eilig, bis später“, würgte er sie ab und legte auf. Abgelenkt von dem Gespräch bemerkte er den Einriss am Spanngurt nicht. Beate hatte er angeflunkert – er hatte die Gäste in der Tat vergessen. Oder, um ehrlich zu sein, er hatte deren Besuch verdrängt, waren es doch die Neufelds, die ältesten und besten Freunde seiner Frau, die er auf den Tod nicht ausstehen konnte. Er fuhr fort, das Fass zu befestigen, da klingelte das Handy erneut. „Ich war noch nicht fertig!“, nörgelte Beate. Thomas klemmte sich den Apparat unter das Kinn und klappte die Laderampe hoch. „Bring noch eine, nein, besser zwei Flaschen Wein mit! Und sei rechtzeitig da!“, hörte er sie sagen. „Klaro“, antwortete er. Dabei quälten ihn im Augenblick andere Sorgen als die Versorgung der beiden überkandidelten Freunde seiner Frau. Und obwohl er diese Laderampe bereits über tausendmal zugemacht hatte, lenkte ihn das Telefonat jetzt doch so ab, dass er nicht bemerkte, wie einer der Riegel nicht ganz einrastete. Thomas stieg ein, startete den Barkas und fuhr los. Gleich beim ersten Schlagloch sprang der Verschluss auf.
Wie eine Buddhastatue saß Kevin auf einem Handtuch im Strandbad von Stralsund. Vor ihm lag ein Buch, aber er starrte nur vor sich hin, im Augenblick hatte er null Bock auf Lesen. Schuld daran trugen zwei Mädchen, die an ihm vorbeigelaufen waren und dabei laut über ihn tuschelten und lachten.
Kevin kämpfte gegen den Impuls an, einfach aufzustehen und den Frust mit einer doppelten Portion Softeis hinunterzuschlucken. Voller Verachtung starrte er auf seinen dicken Bauch, die fetten Brüste und die Elefantenschenkel und blieb sitzen. Frustriert wanderte sein Blick anschließend aufs Wasser, wo ein drahtiger Surfer auf einem Brett vorbeiglitt. „Verdammt, so will ich auch aussehen!“, flüsterte Kevin leise. In Selbstmitleid zerfließend dachte er daran, dass er nicht immer so viel Speck auf den Rippen gehabt hatte. Sein ehemaliger Fußballtrainer hatte ihm sogar außergewöhnliches Talent bescheinigt und ihm eine sportliche Karriere vorhergesagt. Doch ein Verkehrsunfall hatte alles verändert. Kevins Eltern und seine kleine Schwester waren bei der Tragödie ums Leben gekommen. Einzig ihn hatte die Feuerwehr unverletzt aus dem Wrack des Familienautos gerettet. Zwar nahmen ihn die Großeltern liebevoll auf, sie konnten aber nicht verhindern, dass er depressiv wurde. Sein einziges Heilmittel gegen sein Seelenleid: Essen. Kevin setzte bald so viel Fett an, dass er es nicht mehr schaffte, dem Ball hinterherzulaufen, kurz darauf flog er aus der Fußballmannschaft. Selbst die Kinder in seiner Schulklasse, die wussten, wieso er ständig betrübt war, hackten wegen der Körperfülle auf ihm herum.
Kevin schaute immer noch versonnen auf den Surfer, der inzwischen fast an der Rügenbrücke angekommen war. Aber wie werde ich so fit? Er gab sich selbst die Antwort. Obwohl er erst zwölf Jahre alt war, kam ihm in diesem Moment mit absoluter Gewissheit zu Bewusstsein, dass nur er selbst in der Lage war, sich aus der Lethargie zu retten. Er stand auf, zog sich an, schüttelte den Sand aus dem Handtuch und warf einen letzten Blick zu dem Surfer in der Ferne. Was er sah, ließ ihn staunen: Ein Motorboot hielt geradewegs Kurs auf den Windsurfer. Kevin riss sich von dem Anblick los und verließ das Strandbad.
Im Unterschied zu Kevin bemerkte John das Boot nicht, welches auf direktem Kurs auf ihn zu steuerte. Der Führer des Motorbootes, Ralf Semrau, gewahrte ebenfalls nicht, dass er sich auf Kollisionskurs mit dem Surfer befand. Wie sollte er auch, neben ihm saß seine neueste Eroberung, die er mit dem PS-starken Boot zu beeindrucken versuchte. Er hatte die attraktive Blondine gestern Abend im Black Pearls aufgerissen. Er bekam einen Ständer, wenn er an die kommende Nacht mit ihr dachte. „Hey Babe, willst du auch mal ans Steuer?“, fragte Ralf gönnerisch, wobei er ihr ungeniert auf die Brüste starrte.
Sie antwortete ihm nicht und schaute zum Ufer, dem lüsternen Blick ausweichend. Den Surfer, auf den sie zusteuerten, bemerkte keiner von beiden.
Leider widmete auch John seine Aufmerksamkeit etwas anderem. Fasziniert guckte er zu dem Stau, der sich auf der Rügenbrücke gebildet hatte. Er war froh, nicht da oben zu sein. Für einen Moment stellte er sich vor, er säße mit in einem der Autos und beobachtete, wie der Fahrer so langsam die Nerven verlor. Er hörte die quengelnden Kinder, eine entnervte Mutter und die Musik von Antenne MV. Jäh holte die Realität John ein. Das Motorboot stieß laut krachend mit dem Surfbrett zusammen und rutschte dann mit ungebremster Geschwindigkeit über Johns Brett. Dieser überschlug sich in der Luft und stürzte ins Wasser. Dabei hatte er noch Glück, die Sicherung des Trapezes öffnete sich und so zog es ihn nicht unter das Segel. Die Glückssträhne dauerte aber nicht an. Der Mast des Surfbretts erwischte ihn mit einem dumpfen Schlag am Kopf. Es wurde schwarz vor Johns Augen. Bewusstlos versank er in der Tiefe des Sundes.
Ralf Semrau hatte endlich das Boot aufgestoppt. Mit weit offenen Augen starrte Ralf auf das Brett, über das er soeben gerast war. Sein Machogehabe fiel vollständig von ihm ab und er begann, nervös auf der Unterlippe zu kauen. Die blonde Mitfahrerin stand auf und ergriff ohne zu Zögern die Initiative. „Was für ein Idiot!“, zischte sie laut genug, dass er es hörte. Dann sprang sie mit einem beherzten Kopfsprung ins Wasser. Mit kräftigen Bewegungen kraulte sie schnell dorthin, wo die Fluten den Surfer verschluckt hatten.
Was ihr noch immer schockstarrer ‚Aufreißer‘ nicht wusste: Linda war seit ihrer frühesten Jugend eine begeisterte Rettungsschwimmerin in der DLRG. Seit Beginn des Semesters studierte sie Psychologie in Greifswald. Weil sie meinte, dass sie solche Typen wie Ralf kennen musste, wenn sie eine gute Psychologin werden wollte, leistete sie diesem Möchtegernplayboy Gesellschaft. Unter keinen Umständen würde sie mit ihm ins Bett steigen!
Linda erreichte die Stelle, an der der Surfer ins Wasser gestürzt war. Sie holte dreimal tief Luft und tauchte ab.
Kathrin hatte es endlich geschafft! Völlig aus der Puste stellte sie ihr Fahrrad, ohne abzuschließen, vor dem Kindergarten ab und rannte hinein. Das Erste, was sie im Vorraum der Kita sah, war der vorwurfsvolle Blick der Kindergärtnerin, die mit ihrem Rucksack auf dem Rücken auf der Stelle trat. Neben ihr stand, ebenfalls fertig zum Abmarsch, ihre Nichte, die sie anstrahlte. Frau Nowak, die Erzieherin, reagierte nicht auf Kathrins Gruß, sondern antworte mit einem Blick auf ihre Armbanduhr gereizt: „Na endlich, das bezahlt mir hier nämlich keiner!“ Damit ging sie zur Tür, öffnete diese, trat hinaus und zeigte eine Geste, die bedeutete raus jetzt! „Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich …“, versuchte Kathrin, sich im Hinausgehen zu entschuldigen, aber Frau Nowak fiel ihr ins Wort. „Ich werde auch mit Lydias Mutter sprechen müssen, so geht das nämlich nicht weiter! Auf Wiedersehen!“ Damit schlug sie die Tür hinter sich zu, verschloss sie und rauschte davon.
Kathrin schaute ihr bedröppelt hinterher, bis Lydia sie am Arm zog. Diese lächelte sie mit großen Kulleraugen altklug an: „Mach dir nichts draus, der Freund von Frau Nowak hat sie betrogen und jetzt ist sie halt sauer.“ Kathrin verzog überrascht ihren Mund. „Woher weißt du das denn?“ Als wäre es das Normalste auf der Welt, antwortete Lydia: „Ich habe gehört, wie sie es der Ines erzählt hat, heute Mittag im Freien. Die anderen waren alle schon essen und ich hatte noch was in unserem Spielschiff vergessen.“ Kathrin schmunzelte, die Kleine hatte es geschafft, ihre Stimmung wieder zu heben. Sie fasste sie an der Hand und ging mit ihr zu ihrem Fahrrad, welches zum Glück immer noch da stand, wo sie es abgestellt hatte. Gerade wollte sie Lydia auf den Sattel heben, da klingelte ihr Handy. Sie setzte das Mädchen wieder auf den Boden und holte ihr Telefon aus der Umhängetasche. Dabei entdeckte Lydias neugieriger Blick das Glas mit den Blutegeln in der Tasche ihrer Tante. Gebannt schaute sich das Mädchen die sich im Wasser windenden Lebewesen an. Kathrin nahm derweil das Gespräch an. „Ja, bitte?!“ Sie hörte kurz zu und antwortete: „Okay, ja klar doch, dann treffen wir uns dort, bis gleich.“ Sie legte auf, steckte das Handy zurück und wandte sich an Lydia: „Das war deine Mama, sie möchte, dass wir uns gleich am Kütertor treffen. Da ist ein Spielplatz und ich glaube, ich habe dort vorhin einen Eisstand gesehen. Wär das nicht was?“ Bei dem Wort Eis leuchteten Lydias Augen auf. Sie nickte so wild, dass ihre Zöpfe nur so durch die Luft wirbelten. „Na dann, worauf warten wir noch? Auf gehtʼs!“ Kathrin hob Lydia auf den Sitz des Fahrrads und schob es los.
Linda kam wieder an die Wasseroberfläche, riss den Mund weit auf und schnappte gierig nach Luft. Noch hatte sie den Surfer nicht gefunden, der vor ihren Augen in der Ostsee versunken war. Auf keinen Fall wollte sie ihn verlieren! Bisher waren alle ihre Einsätze als Rettungsschwimmerin erfolgreich verlaufen. Und sie wollte, dass es so blieb! Sie atmete noch dreimal tief ein, dann tauchte sie wieder ab. Die Sicht unter Wasser war erbärmlich, der Wind wirbelte den Grund des Sundes gründlich auf. Aber zum Glück war der Sund an dieser Stelle nur fünf Meter tief. Linda kam unten an, wo sie begann, in einer kreisförmigen Bahn den Boden abzusuchen. Ihre Lunge fing bereits an zu brennen und sie wollte gerade auftauchen, da ertasteten ihre Hände den leblosen Körper des Mannes. Beherzt packte sie ihn am Kragen seines T-Shirts und tauchte mit kraftvollen Bewegungen nach oben.
Ralf Semrau erwachte endlich aus der Starre, er befestigte den Rettungsring an einem Seil und warf ihn ins Wasser. Linda tauchte knapp daneben mit dem Bewusstlosen im Arm auf. Schnell packte sie den Ring mit der freien Hand. „Los, zieh!“, schrie sie dem Bootfahrer zu. Ralf tat wie ihm geheißen und zog beide zu sich ans Boot. Dort angekommen schob Linda den Surfer an der Bordwand nach oben. „Greif zu!“ Laut stöhnend zog der Motorbootfahrer den Mann an Bord. Sich selbst zog sie mit einem kraftvollen Schwung ins Boot, um sich dort sofort um den ohnmächtigen Surfer zu kümmern. Sie beugte sich über ihn, um zu hören, ob er noch atmete, dann fühlte sie den Puls. Nichts! Sie begann mit der Herzdruckmassage. Kaum drückte sie das erste Mal auf den Brustkorb, japste der Mann nach Luft.
John griff mit der Hand an seinen Kopf. „What the fuck …“, war das Erste, was er von sich gab. Er schaute in unbekannte Gesichter. „Was war das?“, fragte er mit deutlich amerikanischem Akzent. Linda war erleichtert, wieder hatte sie einem Menschen das Leben gerettet. „Oh, Sie hatten einen Unfall mit …“, dabei schaute sie verächtlich zu dem Fahrer des Motorbootes, „… diesem Herren hier.“ John drehte sich erschrocken um: „My board, where is it?“, fragte er, unbeabsichtigt wieder in seine Muttersprache verfallend. „Your board is over there“, antwortete sie und zeigte auf die Stelle, an der Johns Surfboard trieb. John machte Anstalten, ins Wasser zu springen, um zum Surfbrett zu schwimmen. Doch mitten im Aufrichten überfiel ihn das Gefühl, in einem Karussell zu sitzen. Er krallte sich mit beiden Händen am Rand des Bootes fest. Linda schaute ihn besorgt an. „No problem, we will catch your board and bring you to the shore!“ Damit drehte sie sich zu Ralf um. „Was glotzen Sie noch in der Gegend herum? Sie haben mich doch gehört, wir holen sein Board, dann bringen wir ihn ans Ufer. Der Mann muss ins Krankenhaus!“ Ralf gehorchte erneut. Dass er noch vor wenigen Minuten davon geträumt hatte, sie flachzulegen, hatte er schon längst vergessen.
Thomas fluchte, die Blinklichter der vor ihm fahrenden Autos gingen an und aus. „Verdammte Scheiße“, presste er durch die Lippen. Er überprüfte hastig die Uhrzeit. „Wenn ich mich hier anstelle, schaffe ich es überhaupt nicht mehr! Wie komme ich nur um diesen Scheißstau herum?“ Er musste unbedingt nach Rügen gelangen! Die Antwort gab er sich selbst: „Dann durch die Innenstadt!“ Thomas setzte den Blinker und fuhr im letzten Moment vom Autobahnzubringer ab, wobei er einem anderen Wagen die Vorfahrt nahm. Diese ruckartige Bewegung gab dem Befestigungsriemen, der das Fass bis dahin noch gehalten hatte, den Rest: der letzte Faden riss. Das Fass, von seinen Fesseln befreit, fing an, auf der Laderampe hin und her zu rutschen.
Kevin war mittlerweile am Hansa-Gymnasium vorbeigelaufen. Da fiel ihm ein, dass morgen eine Arbeit in Englisch anstand. Leise brummelte er die Vokabeln, die er bereits beherrschte, vor sich hin. So in Gedanken bog er gewohnheitsmäßig in die Knieperstraße ein, um sich ein Eis in der Altstadt zu kaufen. Mit einem Mal blieb er stehen. In ihm tobte ein Kampf mit seinem inneren Schweinhund, der ihm einreden wollte, dass ein Eis nicht schadete, und er morgen mit dem Abnehmen anfangen könne. Kevins Blick ging nach unten. Der Wind hatte eine alte Zeitung an sein Bein geweht. Er wollte das Papier achtlos wegkicken, hielt dann aber einen Moment inne. Ein Artikel fiel ihm ins Auge. „Ninjas in Stralsund“, lautete die Überschrift. Neugierig hob er die Zeitung auf. Er faltete das Papier auseinander und las den Bericht. Darin warb eine Sportgruppe für ihr kürzlich eröffnetes Trainingszentrum. Er las etwas von Selbstverteidigung, Körperbeherrschung und Selbstbewusstsein und davon, dass man dies alles durch das Training des japanischen Ninjutsu erlernen konnte. „Ninjutsu“, flüsterte Kevin. Er hatte noch nie davon gehört. Er kannte natürlich Karate, Judo und Kickboxen, jene Sportarten reizten ihn allerdings nicht, betrieben diese doch die Mitschüler, die ihn am meisten piesackten. Aber ein Ninja zu werden, das klang spannend! Kevin dachte dabei an die Computerspielfiguren, die in schwarze Anzüge gekleidet ihre Gesichter hinter Masken verbargen. Bewaffnet mit Schwertern und Wurfsternen gewannen sie jeden Kampf. Warum fliegt die Zeitung gerade jetzt zu mir? Er trennte den Artikel aus dem Papier und wollte den Rest des Blattes wieder achtlos auf die Straße werfen, doch eine Frau, die mit ihrem Rollator an ihm vorüberschob, starrte ihn mahnend an. Kevin knüllte die Zeitung zusammen und trug sie brav zum nächsten Papierkorb. Dann strich er den herausgerissenen Beitrag glatt und steckte ihn in die Hosentasche. Sobald er zu Hause ankäme, würde er die Telefonnummer anrufen. Er würde ein Ninja werden, davon war er im Augenblick fest überzeugt! Darüber vergaß er völlig, dass er noch einige Sekunden zuvor überlegt hatte, sich ein Eis zu kaufen. Er machte auf der Stelle kehrt, um wieder in Richtung Kütertor zu laufen. Von dort war es nicht mehr weit bis zur Bushaltestelle.
John saß in seinem gebrauchten Fiat. Er verließ gerade die Rügenbrücke und fuhr Richtung Altstadt. Sein Board hatte ihm Linda auf dem Dach befestigt. So sehr sie ihn auch gedrängt hatte, er hatte sich auf keinen Fall ins Krankenhaus fahren lassen wollen. John hatte sie davon überzeugt, dass es ihm gut ging, und ihr versprochen, sich zu Hause auf die Couch zu legen, um sich dort von dem Schlag auf den Kopf zu erholen. Doch da hatte er gelogen: am Nachmittag war er mit Freunden verabredet und von einem kurzen Blackout wollte er sich nicht abhalten lassen. Er fuhr aus dem Kreisverkehr hinter dem Schnellrestaurant raus, da wurde ihm für einen kurzen Moment schwarz vor Augen. Der Aussetzer dauerte zwar nur eine Sekunde, aber als er wieder klar sah, bemerkte er, dass er auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Hektisch riss er das Steuer herum, keinen Augenblick zu früh: ein Sportwagen rauschte an ihm laut hupend vorbei. Shit, ich glaub, ich muss doch zum Arzt! Es gab nur ein Problem: John hatte Angst vor Ärzten! Bei der Vorstellung, vor einem Weißkittel zu stehen, sah er sofort seinen toten Freund Ossi vor sich. Dieser war beim Baden mit einem giftigen Hawaii-Feuerfisch in Berührung gekommen und von ihm gestochen worden. Der kleine Ossi war damals zu spät ins Krankenhaus gekommen, wo er trotz der Bemühungen der Ärzte an einem anaphylaktischen Schock starb. John hatte es den Medizinern nie verziehen, dass sie Ossi nicht hatten retten können.
Plötzlich stieg eine Welle von Übelkeit in John hoch. Mit Mühe hielt er den Wagen in zweiter Reihe an und öffnete die Tür, um auszusteigen. Doch kaum, dass John sich zu Seite beugte, übergab er sich auf die Fahrbahn. Sein Schädel schien ihm bei der körperlichen Anstrengung, die das Erbrechen mit sich brachte, zu bersten. Schwer atmend lehnte er sich zurück in den Sitz, fummelte ein Papiertaschentuch aus einer Packung und wischte sich damit den Mund ab. Er schloss für einen Moment die Augen. So schnell, wie der Brechreiz gekommen war, so schnell ging es ihm jetzt wieder gut. John nahm sich allerdings vor, das Treffen mit seinen Freunden abzusagen. Stattdessen wollte er Lindas Rat befolgen und sich auf die Couch legen. Ein lautes Hupen riss ihn aus den Gedanken.
John dreht sich erschrocken um: Ein langer Stau hatte sich hinter ihm gebildet. Gehetzt legte John einen Gang ein und fuhr los.
Thomas freute sich, dass er vom Autobahnzubringer abgefahren war. Wie von ihm erhofft, rollte der Verkehr durch die Stadt flüssig. Inzwischen glaubte er, es doch noch pünktlich zum Hafen zu schaffen. Er setzte den Blinker und wechselte die Spur, um in den Tribseer Damm einzubiegen. Kaum fuhr er auf dem anderen Fahrstreifen, stellte er aber enttäuscht fest, dass es dort nur im Schritttempo vorwärtsging. Ohne auf die Autos zu achten, hüpfte Thomas zurück in die Geradeausspur, was ein kakofonisches Hupkonzert zur Folge hatte. „Toll, ihr habt Hupen“, äffte er. „Regt euch doch von mir aus auf. Mich juckt das überhaupt nicht. Wegen euch komme ich doch nicht zu spät!“ Mit einem Blick zum Autoradio maulte er: „Was ist das eigentlich für eine Scheißmusik hier?“ Er wechselte zu Antenne MV, dort sendeten sie gerade den Wetterbericht. In den kommenden Tagen sollte das herzlichste Sommerwetter herrschen. „Geil, dann kann ich ja angeln gehen …“, freute er sich, „… na, falls nicht doch noch etwas reinkommt.“ Einerseits hoffte er auf einen neuen Auftrag, andererseits hätte er nichts gegen die Ruhe und Einsamkeit auf dem kleinen Motorboot. Das Schrillen des Handys riss ihn aus seinen Gedanken. Er fischte sein Handy aus der Tasche und guckte auf die Anzeige. Beate rief schon wieder an. Bevor er das Gespräch annahm, spähte er, ob er Polizei sah. Er wollte nicht zum dritten Mal in diesem Monat Strafe zahlen müssen. Er entdeckte nichts und so hob er das Gerät ans Ohr. „Ja, Schatz, was soll ich noch mitbringen?“, fragte er gespielt erfreut. „Nichts. Evelyn hat angerufen, sie kommen erst morgen. Du brauchst dich also nicht zu beeilen.“ – „Das ist ja schade“, heuchelte er. „Gut, danke! Dann weiß ich Bescheid! Du, ich muss auflegen, da vorn sind Bullen, tschüss!“ Ohne auf ihre Antwort zu warten, drückte er das Gespräch weg. Dabei war weit und breit keine Polizei zu sehen. Allerdings sah er, dass der Knieperwall vor ihm frei war. Erfreut darüber fuhr er in ihn ein.
Kathrin und Lydia saßen auf dem kleinen Spielplatz vor dem Kütertor auf einer Bank und leckten genüsslich an einem Eis. Kathrin hatte sich eine Kugel Schokoladeneis gegönnt und sich dabei geschworen, heute noch joggen zu gehen, um die zusätzlichen Kalorien wegzubekommen, die sie mit dem Eis in sich hineinfutterte. Lydia leckte ein schrecklich lilafarbenes Eis, welches ihr die Zunge verfärbte. Diese streckte sie immer wieder ihrer Tante heraus, die daraufhin großes Erschrecken spielte. Dabei kreischte sie: „Oh Hilfe, neben mir sitzt ein Alien, bitte tu mir nichts!“ Das amüsierte Lydia dermaßen, dass sie dieses Spiel immer wiederholte. Kathrin laberte den Satz bereits zum zwanzigsten Mal! Langsam verlor sie die Nerven. Wo bleibt meine Schwester denn nur? Sie müsste doch längst da sein! Nach der Übergabe des Kindes wollte Kathrin nach Hause. Sich dort umziehen, laufen gehen, um dann im Anschluss noch etwas für ihren Heilpraktikerkurs zu pauken. Sie erhob sich: „Komm, mein Schätzchen, wir müssen.“ Folgsam stand die Kleine auf, immer noch an ihrem inzwischen tropfenden Eis leckend.
Sie gingen zur Ampel. Dort sah Lydia ihre Mama durch das Kütertor kommen.
Plötzlich riss sich das Mädchen von ihrer Hand los – laut „Mama, Mama ich bin ein Alien!“ schreiend rannte sie mit herausgestreckter Zunge auf die Straße.
Immer wieder verschwamm die Umgebung vor Johns Augen. Fast übersah er das kleine Mädchen, das über die Straße rannte. John nahm nur einen verschwommenen Fleck wahr, der, so viel bekam er mit, nicht vor das Auto gehörte. Instinktiv riss er das Lenkrad herum, trat gleichzeitig auf die Bremse und verfehlte so im letzten Augenblick Lydia um wenige Millimeter. Dann rutschte der Wagen laut quietschend quer über die andere Fahrbahnseite, wobei er eine rauchende Bremsspur hinter sich ließ. John riss entsetzt die Augen auf, denn er sah jetzt plötzlich sehr scharf, wie ein Kleintransporter auf ihn zu fuhr.
Kathrin schrie geschockt auf. Nicht, weil ihr das Eis, welches sie vor Schreck losgelassen hatte, auf den Schuh fiel, nein, weil wenige Meter vor ihr ein Auto auf ihre Nichte zu preschte. Dann verschwand Lydia aus ihrem Sichtfeld. Das Auto, in dem Kathrin einen sonnengebräunten jungen Mann wahrnahm, schob sich zwischen sie und Lydia. Sie folgte dem Fahrzeug mit ihrem Blick und bemerkte, wie es quer schleudernd auf einen Transporter zu rutschte, der noch aus alten DDR-Zeiten stammte. Es ertönte ein dumpfer Rums. Sie vermutete, dass die beiden Wagen ineinandergekracht waren. Dann rollte ein großes, dunkles Fass in Richtung Knieperteich. Unendlich langsam, als müsste sie das Gewicht einer Dampflok bewegen, drehte sie sich jetzt wieder zurück, um nach Lydia zu schauen, die sie blutüberströmt auf dem Fahrbahnbelag vermutete.
Doch sie entdeckte das Mädchen in den Armen ihrer Mutter. Sie sah der Kleinen an, dass sie überhaupt nicht verstand, warum ihre Mama sie ganz fest an sich drückte. Benommen stand Kathrin da, sie sah ihre Schwester Tränen vergießen und fragte sich, was soeben hier vor ihren Augen passiert war.
Thomas hielt erschrocken den Atem an. Er glaubte, aus der Zeit zu fallen, alles lief unendlich langsam ab, jede Bewegung, jeder Gedanke. Gestochen scharf sah er ein kleines Kind, welches in die ausgebreiteten Arme einer entsetzt dreinblickenden Frau lief. Weiter machte er auf der anderen Straßenseite eine hübsche, junge Frau aus, die stocksteif da stand, wobei ihr in diesem Moment ein Eis aus der Hand fiel. Er registrierte einen kleinen dicken Jungen, dem der Mund sperrangelweit offen stand. Und er erkannte die weit aufgerissenen Augen des Mannes, der in einem Kleinwagen mit Surfbrett auf dem Dach auf ihn zu schleuderte. Als wäre er es nicht selbst, beobachtete Thomas, wie er mit voller Kraft auf die Bremse des Transporters trat und wie sich der Barkas daraufhin quer stellte. Er hörte deutlich das laute Poltern hinter sich, als das Fass die Laderampe durchbrach. Mit nüchternen Gedanken wunderte er sich, warum die Sicherung es nicht zurückhielt. Immer noch wie in einem Film sah er das Fass die Böschung hinabrollen. Dann kam sein Wagen endlich zum Stehen und der normale Zeitablauf setzte wieder ein.
Genauso erging es Kevin, der mit offenem Mund nur wenige Meter hinter dem Barkas stand. Alles ging so schnell. Eben noch tagträumte er, wie er, inzwischen ein kühner Ninja, nachts von Hausdach zu Hausdach sprang. Da rissen ihn das Quietschen von Bremsen, lautes Schreien und ein gewaltiger Schlag aus seiner Fantasie. Nur wenige Meter vor ihm fiel ein rostiges Fass von der Laderampe eines Autos, um weiter unten am See zum Stillstand zu kommen. Dann hörte Kevin nur noch das Weinen einer Frau und die Stimme eines Mädchens, welches anscheinend die Frau zu trösten versuchte: „Mama, ist doch nicht schlimm, ich bin kein Alien, schau, ist nur von meinem Eis.“ Als Nächstes ging die Tür des Barkas vor ihm auf und ein Mann, etwas älter als sein Vater dieser Tage wäre, stieg aus.
Thomas ging auf das Auto zu, das quer vor ihm stand. Er musste sich dabei an der vorderen Stoßstange des Wagens vorbeiquetschen, sein Unterschenkel passte gerade so noch hindurch. Thomas klopfte an die Scheibe des Kleinwagens.
John erkannte den Mann, der an die Tür pochte, nur unscharf. Sein Kopf fühlte sich völlig blutleer an. Die Gedanken darin bewegten sich mit der Geschwindigkeit einer sterbenden Schnecke. Was war passiert? War das alles echt gewesen oder halluzinierte er durch den Schlag des Mastbaums auf den Kopf? „Sind Sie in Ordnung?“, drang es von außerhalb des Wagens an ihn heran. John schnallte sich ab, dabei spürte er unvermittelt ein intensives Stechen in der rechten Schulter. Er presste die Zähne zusammen, um den Schmerz zu beherrschen. John öffnete langsam die Tür und stieg aus. „Yes, alles in Ordnung, und bei Ihnen?“, fragte er zurück. Thomas antwortete: „Mir geht’s gut. Wie es scheint, dem Kind genauso. Gut, dass Sie so schnell regagiert haben!“ – „Sie aber auch!“ Die Männer drehten sich zur Seite, sie hörten die Stimme einer Frau. „Sie sind beide okay, ich meine unverletzt?“, fragte Kathrin. Sie war aus ihrer Schockstarre erwacht und lief jetzt in einer Art Notfallmodus. Dieser setzte bei ihr immer ein, wenn es um sie herum drunter und drüber ging. Je stressiger es für die anderen wurde, desto gelassener wurde sie in solchen Augenblicken. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass es ihrer Lydia gut ging, eilte sie sofort zu den Männern, um zu sehen, ob bei ihnen alles in Ordnung war. Sie sah den sonnengebräunten Mann aus dem Kleinwagen steigen und augenblicklich fing ihre Nase an zu jucken – ein sicheres Zeichen, dass sie ihn attraktiv fand. Der offenkundige amerikanische Akzent, mit dem er antwortete: „Ja danke, mir geht es gut!“, ließ sie nach einem Taschentuch greifen, um das Jucken unbemerkt unter Kontrolle zu bringen. Doch bevor sie sich weiter ihren aufwallenden Gefühlen hingeben konnte, lenkte lautes Hupen sie ab. Mittlerweile stand gut ein Dutzend Fahrzeuge auf der Straße, deren Fahrer gerne an der vermeintlichen Unfallstelle vorbei wollten. „Wir sollten wohl besser unsere Autos auf den Fußweg fahren“, meinte Thomas pragmatisch. Auch er stand noch unter dem Eindruck der letzten Sekunden, es war noch nicht in sein Bewusstsein gedrungen, dass bei Weitem nicht alles in Ordnung war. Die Ladung, die er dringend liefern musste, war nicht mehr auf der Ladefläche, sondern lag unten in einem Gebüsch.
Wenige Minuten später hatten sie ihre Fahrzeuge auf dem Gehweg geparkt. Sie stellten sich jetzt einander vor und einigten sich darauf, keine Polizei zu rufen, es war ja niemand zu Schaden gekommen. Als John und Kathrin Thomas’ missmutigen Blick auf das Fass mitbekamen, beschlossen sie, ihm bei der Bergung zu helfen. „Das Ding ist sauschwer!“, meinte Thomas zu den beiden, „ich hab eine Ewigkeit gebraucht, um es aufzuladen.“ Dabei schaute er besorgt auf die Uhr. Nur noch ein Wunder brachte das Fass pünktlich zum Hafen.
Auf einmal fiel jegliche Anspannung von ihm ab. Warum sollte er sich jetzt noch stressen? Es war doch sowieso zu spät!
John versuchte, eine Lösung für das Fassproblem zu finden, aber mittlerweile quoll sein Kopf von Schmerzen über. Einen klaren Gedanken zu fassen, fiel ihm unendlich schwer. Genauso schwer, wie den rechten Arm zu heben; es fühlte sich an, als rammte ihm jemand ein Messer in seine Schulter.
Auch Kathrin überlegte, wie man das Problem lösen könnte. Da hörte sie einen Jungen hinter sich: „Entschuldigung, das haben Sie vorhin verloren.“ Kevin hielt den Spanngurt in den Händen. Thomas bedankte sich. „Das muss wohl von der Laderampe gefallen sein. Damit ging es vorhin, und damit wird es auch jetzt gehen.“ Kevin kam den dreien entgegen und übergab den Gurt. „Kann ich irgendwie helfen?“, fragte er. Doch Thomas schüttelte den Kopf. „Danke, mein Junge, aber das ist eine Sache für Erwachsene.“ Kevin nickte enttäuscht. „Na dann, wiedersehen.“ Er drehte sich um und ging. Thomas kletterte hinab zur Tonne und schlang das Seil herum. John nahm von ihm das andere Ende entgegen, die schmerzende Schulter hinderte ihn aber, es festzuzurren. Kathrin musterte ihn besorgt. „Sind Sie sicher, dass alles okay ist bei Ihnen?“ John schaffte schmerzverzerrtes Lächeln. „Hatte heute einen toughen Tag.“ – „Lassen Sie mal, ich mach das!“ Kathrin stellte ihre Tasche auf den Boden, um das Seil anzubinden. Unbemerkt von ihr und den anderen fiel dabei ihre Handtasche um. Das Einweckglas mit den lebenden Blutegeln, welche sie aus dem Unterricht mitgenommen hatte, rollte hinaus und kullerte den Hang hinunter, wo es neben einem kleinen, mit kyrillischen Buchstaben bedruckten Kästchen liegen blieb. Thomas fluchte plötzlich: „Verdammte Scheiße, das Ding ist aufgegangen.“ Der Deckel des Fasses hatte sich bei dem Aufprall gelöst und ein Teil des seltsamen Pulvers war herausgerieselt. „Was ist das?“, wollte John naserümpfend wissen. „Keine Ahnung!“, antwortete er wahrheitsgemäß. Unter lauten Hau-Ruck-Rufen schafften sie es zu dritt, das Fass aus dem Gebüsch zu ziehen. Es ging viel einfacher, als Thomas befürchtet hatte, obwohl der junge Amerikaner die ganze Zeit nur mit einem Arm zupackte. Er schöpfte Hoffnung, dass das Fass bald wieder auf der Ladefläche stand. Bevor sie sich aber daran machten, es den restlichen Hang hinaufzubugsieren, schaufelte Thomas das stinkende Pulver mit bloßen Händen zurück in das Fass. „Sollten Sie nicht lieber Schutzhandschuhe anziehen? Ich meine, wenn sie nicht wissen, was das für ein Zeug ist. So wie das riecht. Nicht, dass es ätzend oder giftig ist?!“, äußerte sich jetzt eine besorgt klingende Kathrin. „Passt schon, ich hab schon schlimmere Sachen angefasst.“ Dabei dachte Thomas an einen Auftrag, bei dem er ein gutes Dutzend toter Schweine zur Tierkadaverbeseitigung hatte bringen müssen. Die Kadaver hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Woche in der Sonne gelegen, sodass er sich fast die Seele aus dem Leib reiherte. Der Gestank des Todes gepaart mit dem Anblick der von Maden zerfressenen, aufgedunsenen Körper war einfach nur widerlich. Zudem hatte es mehrere Wochen gedauert, bis endlich der bestialische Gestank von der Ladefläche verschwunden war.
Thomas wurde aus der Erinnerung gerissen, er hörte ein Geräusch, das er nur zu gut kannte: den Laut eines sich übergebenden Menschen. In diesem Fall war es John, er hatte sich weggedreht und stand mit vorgebeugtem Oberkörper da. Kathrin eilte zu ihm. Sie tätschelte seinen Rücken mit ihrer Hand. „Was ist los, haben Sie sich doch verletzt?“, wollte sie besorgt wissen. John wischte sich peinlich berührt den Mund ab. „No, no. Ich meine nein, ich hatte vorhin nur einen Crash beim Surfen. Es wird schon wieder.“ Kathrin glaubte ihm kein Wort, denn John kniff schwankend die Augen zusammen. Er sah ihren skeptischen Blick und richtete sich deswegen zu seiner ganzen stattlichen Größe auf, als wäre er wirklich in Ordnung. Dies verhinderte aber nicht, dass er wankte, als er zu Thomas ging, um mit ihm das Fass weiter hinaufzuziehen. Kathrin schüttelte den Kopf über dieses Machogehabe, bevor sie ebenfalls das Seil mit anpackte.
Zehn Minuten später hatten sie es geschafft: Das Fass stand ordentlich verzurrt auf der Ladefläche, die Ladeklappe war fest verschlossen. Thomas hatte, so gut es ging, das Pulver aus dem Fass eingesammelt. Er war der Überzeugung, dass die kleine Menge, die noch fehlte, garantiert niemanden auffallen würde. „Danke für die Hilfe“, wandte sich Thomas an John und Kathrin. „Aber ich muss.“ Er nickte beiden zum Abschied zu, stieg in den Barkas und drehte den Zündschlüssel. Der Motor stotterte und sprang nicht wie erwartet an. Frustriert kletterte er wieder aus und öffnete die Motorhaube. Sein Blick fiel auf die beiden, die ihm geholfen hatten.
Stumm schauten sich John und Kathrin an. Nach einer langen Pause brach Kathrin, sich die Nasenspitze reibend, schweren Herzens das Schweigen: „Na dann.“ Sie gestand sich ein, dass sie gerne noch mehr Zeit mit John zugebracht hätte, und hoffte, dass es ihm genauso ging. Doch John streckte ihr nur die Hand entgegen, „Na dann …“ Sie ergriff sie und musste noch im selben Moment mit der anderen Hand zupacken. John taumelte und drohte zusammenzubrechen. „Oh, my, oh, ich, hä“, stammelte er. „Alles klar! Kommen Sie, ich bring Sie ins Krankenhaus! Ich arbeite in der Helios Klinik, da wird man sich um Sie kümmern!“ Resolut packte sie John unter den Armen und schob ihn zu seinem Wagen, dort verfrachtete sie ihn auf den Beifahrersitz. Dann fiel ihr ein, dass sie ihre Tasche vergessen hatte. Sie lief noch einmal zurück und hob sie auf, ohne in der Eile das Fehlen des Glases zu bemerken. Sie setzte sich ans Steuer und fuhr los.
Thomas fummelte am Motor herum und schaute sich das Schauspiel an. „Da hat es ja ganz schön gefunkt“, grunzte er. Und endlich funkte es auch bei dem Barkas. Der Motor lief wieder. Hastig schloss er die Motorhaube, stieg ein und fuhr, so schnell es der Wagen erlaubte, davon.
Stille legte sich über den kleinen Teich gegenüber dem Kütertor. Nur eine Ente paddelte vorbei und warf einen neugierigen Blick zu dem Glas mit den Blutegeln und dem kleinen, in Wachspapier gewickelten Kästchen.
Kapitel 2
Am Ufer des Nebenarms der Newa glotzte das Hotel Sankt Petersburg auf das Gewimmel am Panzerkreuzer Aurora herab. Im neunten Stockwerk des Gebäudes war ein Vorhang beiseitegezogen. Am Fenster stand General a. D. Wladimir Kostrakowitsch. Voller Verbitterung und Selbstmitleid starrte er auf das altehrwürdige Schiff. Mit größter Freude wäre er bei der Oktoberrevolution dabei gewesen! Auch hätte er liebend gern Berlin erstürmt und mit der Roten Armee das Deutsche Reich in die Knie gezwungen. Der Name Wladimir Kostrakowitsch würde nie auf einem der gewaltigen Gedenksteine prangen, die es überall in Russland gab. Er massierte sich mit der rechten Hand die linke Seite des Brustkorbs mit der schlecht verheilten Rippe und erinnerte sich an den 27. Dezember 1979. Er stürmte noch einmal als Kommandeur der russischen Spezialeinheit Speznas den Tajbeg-Palast in Kabul und tötete Präsident Amin mit einer Handgranate. Dass das Staatsoberhaupt bereits durch ein vergiftetes Frühstück kampfunfähig war, hatte zum Plan gehört.