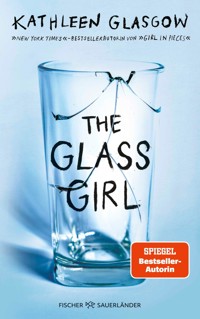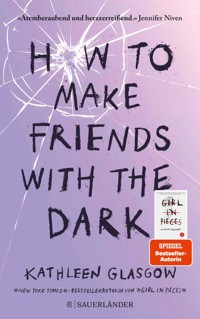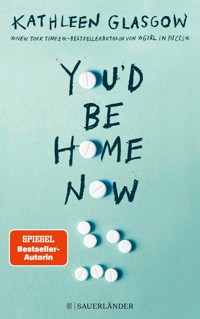
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Joe war mal cool. Jetzt ist er nur noch irgendsoein drogenabhängiger Loser.« Emmy steht in einer der Kabinen der Mädchentoilette und weint. Sie weiß, dass ihr großer Bruder Joey viel mehr ist als das. Joey ist derjenige, der ihr das Fahrradfahren beigebracht hat, weil ihre Eltern ständig arbeiten mussten. Joey saß stundenlang mit ihr in der Bettlakenhöhle, und hörte ihr beim Vorlesen zu, selbst als er schon viel zu alt dafür war. Joe zeigte ihr, wie man Rührei macht und ließ sie zugucken, während er malte. Bis zu dem Tag, an dem Emmy an seine Zimmertür klopft und Joey mit kalter Stimme sagt: »Geh weg.« Ein Roman darüber, dass kein Mensch nur gut ist oder nur schlecht ... sondern mindestens beides. Von der »New York Times«- und »SPIEGEL«-Bestsellerautorin sowie der TikTok-Sensation »Girl in Pieces« − das neue bewegende Jugendbuch von Kathleen Glasgow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kathleen Glasgow
You'd be Home Now
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel ›You’d be home now‹ bei Delacorte Press, an imprint of Random House Children's Books, a division of Penguin Random House LLC, New York © 2021 by Kathleen Glasgow
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2024 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden unter Verwendung einer Idee von Hayley Warnham
Coverabbildung: shutterstock
ISBN 978-3-7336-0620-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Wir fliegen …]
EINS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
ZWEI
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Nachwort der Autorin
Wohin du dich wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst
Dank
Für alle Emmys und Joeys:
Die Liebe bleibt
Wir fliegen durch die blauschwarze Nacht, Regen peitscht auf das Auto. Die Bäume werden zu Händen, zu Fingern, zu Zähnen, die nach uns greifen. Ich weiß nicht, ob wir schreien, denn mein Herz schlägt in meinen Ohren und übertönt mich. Das Auto ist schwerelos und schwer zugleich, und dann knallt es auf den Boden, rollt und rollt, Luther Leonard ist halb vor, halb hinter der zersplitterten Windschutzscheibe, seine Füße mit den Turnschuhen baumeln seltsam verdreht herab.
Ich rufe den Namen meines Bruders, aber es kommt keine Antwort.
Meine Hände tasten nach dem Gurtschloss, aber sie zittern so sehr, dass ich sie nicht kontrollieren kann. Ich spüre etwas, aber ich kann nicht sagen, was. Mit meinem Körper stimmt etwas nicht. Etwas ist fehl am Platz.
Im verbogenen Rückspiegel ist mein Bruder Joey ein regloses Ding auf dem Rücksitz, quer über Candy MontClair, mit Blut in den Haaren.
Ich sage ihren Namen.
Die Laute, die sie von sich gibt, sind keine Worte. Sie sind heiser und feucht, voll und dünn zugleich.
Ich muss aus diesem Auto. Ich muss Hilfe holen. Ich muss diesen Ort voll zersplittertem Glas und zerdrücktem Metall und Luther Leonards baumelnden Füßen verlassen, aber ich kann mich nicht rühren. Ich kann nicht raus.
Durch das zerbrochene Fenster dringt ein Heulen aus dem Wolf Creek Wald. Irgendetwas heult, vielleicht bin ich es, aber nein, ich bin es nicht. Es sind Sirenen, und dann füllen grelle Strahlen unser zerstörtes Auto mit Licht.
EINS
Sag mir, was hast du vor
Mit deinem einen wilden, kostbaren Leben?
Mary Oliver
1
Meine Schwester Maddie weint, ihr hübsches Gesicht ist feucht und verängstigt. Mein linkes Bein ist schwerer als das rechte, und ich weiß nicht, warum, und möchte sie fragen, aber ich finde keine Worte, weil in mir ein Ozean ist, warm und süß, und ich auf den Wellen treibe, genau wie Joey und ich vor Jahren in San Diego, als alles perfekt war oder zumindest nah dran. Es war eine schöne Zeit, als ich zwölf war und Joey dreizehn und wir uns von den Wellen tragen ließen, während Maddie sich in ihrem lila Bikini und mit ihrem Sonnenhut am Strand rekelte. Weit weg von Mill Haven, in einer anderen Welt, in der niemand wusste, wer wir waren.
Ich versuche, Maddie zu fragen, wo Joey ist, aber sie versteht mich nicht. Sie denkt, ich möchte etwas anderes, denn sie beugt sich vor und fragt: »Brauchst du noch was? Soll ich den Knopf drücken?«
Ihr Finger drückt auf einen Knopf neben dem Bett, und die größte Welle, die ich je erlebt habe, wogt über mich hinweg, wie bei dem Fallschirmspiel, das wir immer im Kindergarten in der Turnhalle gespielt haben, bei dem sich der Stoff sanft über unsere lachenden Gesichter legte und die Welt dahinter verschwand.
Die Stimme meiner Mutter zittert. »Das ist doch nicht normal. So was passiert Leuten wie uns einfach nicht.«
Mein Vater klingt müde. Er ist schon seit Jahren müde. Joey macht alle müde.
Er sagt: »Normal gibt es nicht, Abigail. Nichts war je normal. Warum begreifst du das nicht? Er hat ein Problem.«
Mein Finger tastet nach dem Knopf, damit die Welle zurückkommt. Meine Eltern erschöpfen mich, ihr ewiger Streit wegen Joey.
Die Hand meiner Mutter streicht über meinen Kopf. Ich reagiere wie ein Kätzchen und schmiege mich an sie. Ich kann mich nicht erinnern, wann sie mich das letzte Mal berührt, mein Haar gestreichelt hat. Alles dreht sich immer nur um Joey.
»In seinem Blut war Heroin, Abigail. Wie kann es sein, dass wir das nicht mitgekriegt haben?«
Das Wort schwebt vor mir in der Luft, unheimlich, erschreckend.
Auf der Party war sein Kapuzenpulli voll von Erbrochenem. Als wir ihn im Schlafzimmer fanden. Er war benebelt und schlaff und seltsam und wirr, und ich dachte …
Ich dachte, er wäre nur betrunken. Oder bekifft.
»Ich bringe das wieder in Ordnung«, sagt sie zu meinem Vater. »Er macht eine Entziehungskur, wird wieder gesund und kommt nach Hause.«
Entziehungskur sagt sie ganz schnell, als wäre es ihr unangenehm, das Wort in den Mund zu nehmen.
»So eine Kur ist kein Zauberstab, mit dem du alles wegzaubern kannst, Abigail. Er hätte sterben können. Emory hätte sterben können. Ein Mädchen ist gestorben.«
Der Ozean in mir, der so warm und wellig war, gefriert.
»Was hast du gesagt?«, flüstere ich. Meine Stimme fühlt sich schwer an. Verstehen sie mich? Ich spreche lauter. »Was hast du gesagt?«
»Emory«, sagt mein Vater. »Oh, Emory.«
Die Augen meiner Mutter sind schimmernde blaue Pfützen. Sie streicht mir mit ihren Fingern durchs Haar.
»Du lebst«, sagt sie zu mir. »Ich bin so dankbar, dass du am Leben bist.«
Ihr Gesicht verschwimmt in den Wellen, die mich davontragen. Ich zappele darin und versuche zu verstehen.
»Aber sie hatte doch nur Kopfschmerzen«, sage ich. »Candy hatte nur Kopfschmerzen. Sie kann nicht tot sein.«
Mein Vater runzelt die Stirn. »Ich verstehe dich nicht, Emmy.«
Sie hatte Kopfschmerzen. Deshalb war sie im Auto. Sie hatte Kopfschmerzen und wollte nach Hause, und es darf doch nicht sein, dass jemand Kopfschmerzen hat und in ein Auto steigt und stirbt, während alle anderen weiterleben. Das darf einfach nicht sein.
»Joey«, sage ich, und Tränen laufen über mein Gesicht, warm und salzig. »Ich will Joey. Bitte holt Joey.«
2
Als ich die Augen öffne, ist er da.
Ich habe meinen Bruder nur ein einziges Mal weinen sehen, an dem Nachmittag, an dem er und Luther Leonard beschlossen, vom Dach unseres Hauses in den Pool zu springen. Luther hat es geschafft, Joey nicht, und das Geräusch seines Weinens, als er sich auf dem Steinboden der Terrasse krümmte, hallte noch tagelang in meinem Kopf nach.
Jetzt ist sein Weinen leiser.
»Es tut mir so leid«, sagt er. Seine Stimme ist heiser, und er sieht krank, blass und zittrig aus. Über seinem linken Auge sind Fäden zu sehen. Sein rechter Arm steckt in einer Schlinge.
»Ich dachte, du wärst betrunken«, sage ich. »Ich dachte, du wärst nur betrunken.«
Joeys dunkle Augen suchen mein Gesicht ab.
»Ich hab’s verkackt. Ich hab es so verkackt, Emmy.«
Die Mädchen himmeln diese dunklen Augen an. Früher zumindest. Bevor er zum Problemfall wurde.
Joey Ward war mal cool, sagte letztes Jahr ein Mädchen in der Toilette der Heywood High. Sie wusste nicht, dass ich in einer der Kabinen war. Manchmal blieb ich ein bisschen länger als nötig dort, um meine Ruhe zu haben. Es ist anstrengend. Die ganze Zeit so zu tun, als ob.
Die Zeiten sind vorbei, erwiderte ihre Freundin. Jetzt ist er nur noch ein Junkie.
Ich weinte lautlos in der Kabine, weil ich wusste, dass Joey viel mehr war als das. Joey war es, der mir das Fahrradfahren beibrachte, weil unsere Eltern immer nur arbeiteten. Joey war es, der sich stundenlang in einer Bettlakenburg im Arbeitszimmer unseres Vaters von mir vorlesen ließ, obwohl er mich eigentlich längst hätte abwimmeln können, um mit seinen Freunden abzuhängen wie die meisten älteren Geschwister. Er brachte mir bei, wie man Rührei macht, und ließ mich in seinem Dachzimmer bleiben, wenn er malte.
Bis er es nicht mehr tat. Bis ich eines Tages an seine Tür klopfte und er mich wegschickte.
Er steht auf und wischt sich mit der unverletzten Hand über das Gesicht. Seine wunderschönen dunklen Haare hängen ihm über die Augen.
»Ich muss los«, sagt er. »Mom wartet.«
Die Entziehungskur. Moms Worte schweben zu mir zurück. War das gestern? Oder heute Morgen? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Alles verschwimmt.
»Joey, warum hast du … das gemacht?«
Ich wünschte, ich könnte aus diesem Bett aufstehen. Ich wünschte, mein Bein würde nicht an einem verdammten Flaschenzug in der Luft hängen und mein Körper wäre nicht so schwer von dem Meer aus Schmerzmitteln in mir.
An der Tür dreht sich Joey um, aber er sieht mich nicht an. Er schaut zu Boden.
»Ich hab dich lieb, Emmy. Aber du hast keine Ahnung, wie es ist, ich zu sein.«
Dann ist er weg.
3
Ich bin in dem Zimmer im Erdgeschoss, neben der Küche, das meine Mutter für Nana eingerichtet hat, in der Hoffnung, dass sie zu uns zieht, aber Nana ist stur und will bis zu ihrem Tod in ihrem eigenen Haus bleiben.
Die Wände sind blassgrau gestrichen. Die Bettwäsche ist weiß und frisch und makellos, und ich stelle mir vor, wie der Schweiß von meiner Stirn die Kissenbezüge befleckt. Meine Mutter mag es gern reinlich.
Zu meinen Füßen schmiegt sich meine Hündin Fuzzy an mich und winselt. Ich kraule sie mit meinem Zeh. Ihr Fell ist rau, niemand hat sie gebürstet. Westies müssen gebürstet werden.
Mein verletztes Bein steckt in einer blauen Schiene und wird von weißen Kissen gestützt. Mein Knie pocht, weiß glühende Funken, die mir das Atmen schwer machen. Mich ins Schwitzen bringen.
Ich höre Stimmen aus der Küche, meine Schwester Maddie und meine Mutter, sie streiten.
»Mom, sie hat Schmerzen«, sagt Maddie. »Lass sie doch eine Tablette nehmen.«
»Sie kann Ibuprofen haben. Sie hat im Krankenhaus so viele Schmerzmittel bekommen. Ich will nicht, dass sie …«
Moms Stimme verstummt.
»Mom«, sagt Maddie eindringlich. »Sie hat sich die Kniescheibe gebrochen. Sie ist nicht Joey.«
»Nein«, antwortet meine Mutter mit plötzlich harter Stimme, die mich schaudern lässt. »Und ich will, dass das auch so bleibt.«
4
Maddie liegt neben mir in dem grauen Zimmer, ihre Augenlider werden schwer, während sie von einer Sendung zur nächsten zappt: Keeping Up with the Kardashians, Mein Traumhaus, Friends. Als ihr die Fernbedienung schließlich aus den Fingern gleitet, schalte ich den Fernseher ab und liege einfach nur da, Fuzzys weichen, schlafenden Körper neben mir.
Maddie hat mir eine Tablette zugesteckt, nachdem Mom ins Bett gegangen ist, hat mir Cracker und Saft gegeben, und jetzt schwitze ich nicht mehr.
Ich lausche der Stille im Haus.
Manche Dinge haben sich nicht verändert, seit ich wieder zu Hause bin. Dad kommt immer noch spät aus dem Krankenhaus, schaut zu uns rein, um sich nach meinem Knie zu erkundigen, dann isst er, was Goldie für ihn in den Kühlschrank gestellt hat, und verzieht sich mit einem Drink ins Wohnzimmer, um seine Serien zu schauen. Er nickt im Sessel ein, die Brille rutscht ihm von der Nase, während meine Mutter oben schläft. So geht das schon seit Jahren, meine Mutter oben, mein Vater unten. Ich dachte, das würde sich ändern, nach allem, was passiert ist. Ich dachte, sie würden sich irgendwie wieder näherkommen nach dem Unfall.
Ich dachte auch, sie würden bei mir zu Hause bleiben, zumindest in den ersten Tagen. Aber sie sind gleich wieder zur Arbeit gegangen. Vielleicht weil Maddie jetzt hier ist und sich um mich kümmern kann. Und Goldie, an den Tagen, an denen sie zu uns kommt.
Manchmal habe ich das Gefühl, in diesem Haus nicht zu existieren, weil ich nicht schön und laut bin, so wie Maddie, oder ein Problem, so wie Joey. Ich bin einfach nur ich. Die Gute.
Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Geräuschkulisse in unserem Haus.
Es ist still.
Mit Joey war es nie still, erst recht nicht seit letztem Jahr, als es schlimm wurde. So viel Streit und Geschrei mit Mom wegen seiner Noten. Seiner Einstellung. Türenknallen. Wenn Dad versuchte, mit ihm zu reden, vergrub Joey sich tief in seinem Kapuzenpulli. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen. Weckte ihn morgens vor der Schule, und wenn ich ihm dazu kaltes Wasser ins Gesicht kippen musste. Machte seine Hausaufgaben, gerade so, dass seine Noten besser wurden, damit es so aussah, als würde er sich bemühen, aber nicht so, dass jemand Verdacht schöpfte. Ich wollte einfach nur, dass der Lärm aufhört.
Neben mir dreht sich Maddie auf die andere Seite und stößt mit ihrem Bein gegen meins. Kleine Flammen zucken durch mein Knie, aber nicht zu sehr, wegen der Tablette. Ich unterdrücke ein Keuchen. Vielleicht brauche ich noch eine? Aber ich will sie nicht wecken. Ich will keinen Streit mehr wegen der Tabletten. Keinen Lärm.
Denn diese Stille – ich liebe Joey, er ist mein Bruder, wie könnte ich ihn nicht lieben? –, aber diese Stille ist so schön friedlich.
Endlich ist es friedlich, jetzt, da mein wilder, geplagter Bruder weg ist.
Und ich fühle mich schuldig, weil ich diesen Frieden so mag.
5
»Es sieht übel aus da oben«, sagt Maddie. »Dabei habe ich das meiste schon aufgeräumt.« Sie lässt eine Kiste auf den Wohnzimmerboden fallen und wirft sich neben mich aufs Sofa. Ihre Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden, und ihr Nacken glänzt vor Schweiß. Die Treppe zum Dachboden ist steil.
Selbst verschwitzt und ungeschminkt ist meine Schwester wunderschön. Ich sollte nicht neidisch sein, aber ich bin es.
»Mom hat Joeys Zimmer komplett auseinandergenommen. Habe ich dir das nicht erzählt? Vielleicht hast du es auch vergessen. Du warst im Krankenhaus so neben der Spur. Ein paar Tage nach dem Unfall sind wir hergekommen, um zu duschen und uns umzuziehen, und sind nach oben gegangen. Du weißt schon, um zu sehen, ob er was versteckt hat, und dann ist sie irgendwie … durchgedreht.«
Sie beugt sich vor und wühlt in der Kiste. »Ich glaube, sie hat nicht viel gefunden. Eine Bong und ein bisschen Gras vielleicht. Aber schau mal, was ich gefunden habe.«
Sie reicht mir einen Stapel Papiere. Joeys Bilder. Drachen mit goldenen Flügeln, aus deren Mäulern Flammen züngeln. Kreaturen mit scharfen Krallen und roten Augen. Eine ganze Welt, die er auf dem Dachboden erschaffen hat, seit unsere Eltern ihn mit dreizehn dort hochziehen ließen. Er konnte stundenlang an seinem Tisch sitzen und sich in seine Bilder vertiefen. Aus seinem alten Zimmer machte Mom ihren Fitnessraum.
»Ich glaube, er hat schon lange nicht mehr gezeichnet«, sage ich. »Vielleicht fängt er ja jetzt wieder an. Wenn er zurückkommt. Wenn es ihm besser geht.«
Maddie sieht mich nachdenklich an. »Emmy, ich bin mir nicht sicher, ob es ein ›besser‹ geben wird. Er hat Heroin genommen. Das ist krass. So was kann man nicht einfach … wegwischen. Ich hatte ja keine Ahnung. Du?«
Ich lege die Papiere zu einem ordentlichen Stapel auf meinem Schoß und weiche ihrem Blick aus. »Ich dachte … Ich weiß auch nicht. Es war schwer. Ich habe einfach versucht, mich um ihn zu kümmern. Ich dachte, er wäre nur … bekifft oder so. Du weißt nicht, wie es war, letztes Jahr. Du warst ja weg.«
Ich fange an zu weinen, Tränen landen auf meinem T-Shirt. Ich habe seit Tagen nicht mehr geduscht und trage dieselben Klamotten, in denen ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, die Krücken haben mir die Unterarme aufgeschürft, und ich fühle mich schrecklich und stinkig neben meiner schönen Schwester mit ihrem perfekt zerzausten Pferdeschwanz.
Und ich fühle mich schlecht wegen Joey, als wäre es auch meine Schuld, weil ich seine Geheimnisse so lange gedeckt habe.
Und dann ist da noch Candy.
Es ist zu viel, alles sprudelt auf einmal in mir hoch.
»Oh, Emmy«, sagt Maddie und schlingt die Arme um mich. »Ist ja gut. Nicht weinen. Es ist nicht deine Schuld. Ich schwöre, es ist nicht deine Schuld.«
Aber irgendwo, tief im Inneren, glaube ich, dass es doch meine Schuld ist.
Denn wenn ich nicht versucht hätte, Joeys Geheimnisse zu vertuschen, wäre Candy MontClair vielleicht noch am Leben.
6
Als ich in die Küche gehumpelt komme, legt meine Mutter die Zeitung zusammen, die sie gerade gelesen hat, und stellt ihre Kaffeetasse darauf. »Ja, wen haben wir denn da«, sagt sie betont fröhlich und wendet sich dem Herd zu. Sie häuft Rührei auf den Teller vor mir. »Heute ist ein großer Tag. Du musst etwas essen. Du hast in letzter Zeit nicht viel gegessen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen.«
Sie schnuppert übertrieben – »Hast du geduscht?« –, streicht sich die Haare zurück und dreht sie zu einem eleganten, lässigen Dutt. Sie trägt eine hübsche cremefarbene Bluse, eine dunkelgraue Jacke und ihre glänzenden schwarzen Schuhe zu einer weit ausgestellten Hose. Ihre Arbeitskleidung.
»Du gehst zur Arbeit?«, frage ich, und meine Stimmung sinkt. Ich dachte, sie würde vielleicht mitkommen wollen, wenn sie mir endlich die Schiene abnehmen, die ich seit fünf Wochen trage. Ich weiß selbst nicht, warum ich mir Hoffnungen gemacht habe.
Sie runzelt die Stirn. »Ja, natürlich. Heute kann ich nicht fehlen. Wir haben eine eidesstattliche Aussage. Maddie ist da. Sie kann dich hinbringen.«
Ich esse ein paar Bissen Rührei und schiebe den Rest auf dem Teller herum, während sie Portemonnaie, Schlüssel und Handtasche zusammensucht. Meine Mutter ist Anwältin, mein Dad Arzt in der Notaufnahme, was bedeutet, dass beide so gut wie immer arbeiten. Trotzdem dachte ich, wenigstens einer von ihnen würde dabei sein wollen, wenn ich meine Schiene abkriege.
»Nicht schmollen, Emory. Blue Spruce wird von der Versicherung nicht übernommen, Daddy und ich können nicht freinehmen.« Blue Spruce ist die Klinik in Colorado, in die sie Joey geschickt haben.
Ich schaue auf meinen Teller. Einmal, in der dritten Klasse, als meine Mutter Joey und mich vor der Schule absetzte, flüsterte eine der Mütter auf dem Bürgersteig: »Die Familie ist sündhaft reich, es überrascht mich, dass sie keinen Chauffeur für ihre kleinen Schätze haben.«
Als ihr klarwurde, dass ich ihre Worte gehört hatte, lächelte sie mich breit und künstlich an und winkte meiner Mutter nach. Ich war erst acht, aber ich verstand sehr gut, was sie meinte.
Mit dem Geld der Familie meiner Mutter könnten sie Joeys Entzugsklinik zigmal bezahlen, und es ginge uns immer noch bestens. Sie muss nicht arbeiten, sie will.
Maddie kommt mit Fuzzy auf dem Arm in die Küche. »Wo ist mein Frühstück?«, fragt sie verschlafen.
»Du bist auf dem College«, erwidert meine Mutter. »Du kannst dir dein Frühstück selbst machen. Und beeil dich. Emmys Termin ist um zehn.«
Ich schiebe meinen Teller in Maddies Richtung. »Du kannst den Rest von meinem haben.«
»Oh, das hätte ich fast vergessen«, sagt meine Mutter. »Hier.«
Sie drückt mir ein rosa Handy in die Hand.
»Das andere«, sagt sie leise, und ihre Augenbrauen ziehen sich ganz leicht zusammen, »war … zertrümmert.«
Ich beiße mir auf die Lippe. Zertrümmert. Bei dem Unfall. Ich hielt es umklammert, während Luther Leonard lachte und immer schneller fuhr.
»Die Nummer ist die alte«, sagt sie und nippt an ihrem Kaffee. »Sie haben alles überspielt.« Sie stellt ihre Tasse ab und dreht sich um, nimmt die Pfanne vom Herd und schrubbt sie in der Spüle aus.
»Ha«, sagt Maddie, setzt Fuzzy ab und steckt sich mit den Fingern ein Stück Rührei in den Mund. »Das sagen sie, aber ich glaube das nicht. Irgendwas fehlt immer.«
Sie greift nach der Zeitung, die meine Mutter gelesen hat. »Ist die von heute?«
Meine Mutter wirbelt herum. »Nein!« Sie versucht, Maddie die Zeitung aus der Hand zu reißen.
»Mom!« Maddie macht einen Schritt zur Seite und schlägt die Zeitung auf. Ihr Gesicht wird blass, und sie faltet sie schnell wieder zusammen und klemmt sie sich unter den Arm.
»Was?«, frage ich. »Was ist?«
Meine Mutter und Maddie sehen sich an. Ich nehme Maddie die Zeitung weg.
Auf der Titelseite des Mill Haven Ledger ist ein Foto von Candy MontClair. Selbst in Schwarz-Weiß kann man die Sommersprossen in ihrem Gesicht erkennen. Ihr hellrotes Haar fällt ihr in Locken über die Schultern. Sie hat das Kinn in die Hand gestützt. Das Foto vom Schulfotografen aus der elften Klasse.
Gemeinde trauert um junges Mädchen
»Leg das weg«, sagt meine Mutter sanft. »Du musst das nicht lesen, Emory.«
Der Sommer gehört den Teenagern in Mill Haven. Partys am See und Lagerfeuer, freitagabends die Hauptstraße rauf und runter fahren. Candy MontClair wollte an einem Theatercamp im Bundesstaat New York teilnehmen, wie jeden Sommer, seit sie zwölf war. Doch tragischerweise …
Ich fühle mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Die Sätze verschwimmen vor meinen Augen. Wie konnte so etwas in Mill Haven passieren? Wir lassen unsere jungen Leute im Stich … Drogen- und Alkoholkonsum weitverbreitet … Wer ist schuld?
»Emmy«, sagt Maddie und zieht mir die Zeitung aus den Fingern. »Emmy, atmen.«
Tragischerweise.
Wie ihr Atem auf dem Rücksitz klang, eingeklemmt unter Joey. Als würde sie ertrinken.
Sterben.
Ich schließe die Augen, das Geräusch ihres röchelnden Atems hallt durch meinen Kopf.
»Mom«, sagt Maddie scharf. »Wie wär’s, wenn du ihr jetzt eine von diesen Pillen gibst? Ich glaube nicht, dass sie es sonst zu ihrem verdammten Termin schafft.«
»Niemand ist schuld«, sagt meine Schwester im Auto. »Sie haben bei Luther einen Drogentest gemacht. Er hatte weder Drogen noch Alkohol im Blut. Es hat in Strömen geregnet. Er hat einfach die Kontrolle über das Auto verloren.«
Candy hat geweint, Joey war völlig hinüber, und ich habe Luther angeschrien, während der Regen auf die Windschutzscheibe prasselte, weil er von der Wolf Creek Road nach links abbiegen wollte, nicht nach rechts, wo es nach Hause ging. Luther lachte. Nur ein kleiner Stopp. Fünf Minuten. Ihr Mädels seid solche Angsthasen. Ich tue euch einen Gefallen.
Ich will nur, dass Maddie den Mund hält. Ich will nur, dass diese Tablette anfängt zu wirken. Ich habe seit meiner ersten Woche zu Hause keine mehr genommen.
»So etwas passiert«, sagt Maddie. »Menschen sterben, ohne Grund. Ich weiß, es klingt gefühllos, aber es war einfach nur ein Unfall. Oh Gott, was ist denn unter der Frost Bridge los? Wie viele Leute sind da bitte?«
Ich schaue aus dem Fenster. Die Frost Bridge führt aus der Stadt, gleich daneben steht das nervige Werbeschild für Mill Haven: DU FÄHRST SCHON WIEDER? WÜRDEST DU HIER WOHNEN, WÄRST DU SCHON ZU HAUSE! Unten am felsigen Flussufer sind Zelte und Planen, alte Decken und Schlafsäcke. Menschen stehen in Grüppchen herum. Sitzen, rauchen.
»Die Stadt«, sage ich. »Die Stadt hat sie vertrieben. Du weißt schon, mit den unbequemen Bänken und so. Den Bußgeldern. Ich glaube, deshalb kommen sie jetzt hierher. Damit ihnen nichts passiert.«
Bitte wirk endlich, Tablette. Bitte wirk.
Hat Joey sich so gefühlt? Wollte er sich unbedingt besser fühlen, sich betäuben, sich verlieren?
Maddie sagt: »Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser geschätzter Stadtrat, in dem unsere geschätzte Mutter Mitglied ist, das gut findet.«
Endlich spüre ich die Wärme, die sich in mir ausbreitet und alles lockert. Milder als der Ozean, der im Krankenhaus durch meine Adern floss, aber immer noch beruhigend.
Ich schaue aus dem Fenster, Mill Haven zieht in einem feuchten, verschwommenen Dunst an mir vorbei. Rote, weiße und blaue Fahnen hängen über der Main Street. In der Ferne am Stadtrand ragt die Mühle auf. Das Vermächtnis unserer Familie, das, was vor langer, langer Zeit diese Stadt aufgebaut hat.
In wenigen Tagen ist der vierte Juli, Unabhängigkeitstag. Wenn Joey hier wäre, würden wir im Kingston Park abhängen und kichernd zuschauen, wie Simon Stanley die Mill Haven Gleefuls zu einer temperamentvollen Darbietung von »R.O.C.K. in the USA« dirigiert, und dann würden wir uns ansehen, wie das Feuerwerk am Himmel explodiert. Kalte Zitronenlimo durch Pfefferminzstäbchen schlürfen. Uns über die Parade lustig machen.
Nein, das stimmt nicht. Ich schüttle den Kopf. Die Tablette hat mein Hirn vernebelt. Joey ist schon seit Jahren nicht mehr mit mir zum Feuerwerk gegangen. Stattdessen war er mit seinen Freunden unterwegs. Er kam spät und beduselt nach Hause und schlich sich heimlich rein, wenn unsere Eltern längst im Bett waren. Und ich schaute allein im Garten zu, wie das Feuerwerk den Himmel aufriss. Ich habe immer auf ihn gewartet, egal, wie müde ich war.
Maddie redet immer noch, ihre Worte lösen sich auf, sobald sie ihren Mund verlassen.
Vielleicht ist es das, was Joey an Drogen so mag. Dass sie die Dinge neu ordnen, Erinnerungen verschieben, auslöschen, womit er sich nicht beschäftigen will. Unangenehmes verblassen lassen.
»Emmy!«
Maddies scharfe Stimme zersplittert meine Gedanken.
»Was ist los mit dir? Ist es das Vicodin? Du musst was essen, bevor du es nimmst. Mein Gott!«
In Dr. Coopers Praxis ist es kalt. Obwohl mein Inneres von der Tablette warm ist, zittere ich.
»Hier drinnen ist es wie in einem Eisschrank«, murmelt Maddie und schlingt die Arme um den Oberkörper.
Die Tür geht auf. »Ah, die berühmten Ward-Mädchen beglücken mich mit ihrer Anwesenheit!« Dr. Cooper schließt die Tür zum Untersuchungsraum und grinst uns an, wobei er seine teuer gebleichten Zähne zeigt.
Maddie wirft mir einen Seitenblick zu, und ich bemühe mich, nicht zu grinsen. Ich weiß, dass sie an Moms Spitznamen für ihn denkt. Doc Vampire. »Die Zähne sieht man schon von weitem«, hat sie mal gesagt.
Er wäscht sich gründlich die Hände. »Madeline, wie läuft das Studium? Dartmouth, richtig?«
»Brown«, antwortet Maddie.
Er trocknet sich die Hände ab und sieht sie an. »Und was ist dein Hauptfach? Du bist eine Ward, die Welt liegt dir zu Füßen.«
»Ich geh zum Zirkus«, sagt Maddie.
Dr. Cooper lacht. »Ach ja?«
»Ja, wirklich. Nächste Woche fahre ich zurück und mache einen Zirkuskurs. Ich habe schon immer davon geträumt, aus einer Kanone geschossen zu werden.«
»Originell wie immer, unsere Madeline«, murmelt er und wendet sich dann mir zu. »Und nun, äh … zu dir.«
Sein Lächeln wankt, während er nach Worten ringt.
Denn wir wissen beide, dass ich weder originell noch außergewöhnlich noch sonst was bin. Dr. Cooper hat mir keinen Smalltalk zu bieten.
Ich kriege nur und nun, äh … zu dir.
»Emory«, sagt er. »Dann sehen wir uns mal das Knie an.«
Er greift mit einer Hand unter meine Achsel und hebt mich auf den Tisch. Das Seidenpapier reißt unter mir, als ich zurückrutsche.
Er klopft sachte auf die blaue Schiene.
»Bereit?«, fragt er. Sein Atem riecht nach Minze, und aus seinen Ohren sprießen kleine Härchen. Ich finde, dass jemand, der seine Zähne so gut pflegt, auch seine Ohrenhaare entfernen sollte, aber was weiß ich schon?
Ich schaue an die Decke. »Ja«, sage ich.
Er beginnt mit langsamen Bewegungen, die Schnallen der Schiene zu öffnen. »Sag mir jederzeit, wenn etwas weh tut, Emory.«
»Ich spüre gar nichts. Ich habe eine Tablette genommen, bevor ich hergekommen bin.«
Er schiebt eine Hand unter die Schiene und zieht sie unter meinem Bein weg.
Mein Bein fühlt sich komisch an ohne die Schiene. So leicht wie seit Wochen nicht mehr.
»Puh.« Maddie stupst meinen Oberschenkel an. »Gar keine Muskeln mehr da. Na, hast ja noch Zeit, bis das Tanzteam im Herbst wieder trainiert.«
Dr. Cooper legt seine Finger um mein Knie. »Oh, sie wird noch eine ganze Weile nicht tanzen.«
»Moment«, sage ich, bemüht, nicht zu aufgewühlt zu klingen. »Ich kann nicht wieder ins Tanzteam?«
»Um Himmels willen, nein!«, sagt Dr. Cooper. »Du hast noch eine ganze Menge Physiotherapie vor dir, bevor du auch nur daran denken kannst.«
»Mom wird ausrasten. Sie liebt das Tanzteam«, sagt Maddie. »Vielleicht kannst du ja einfach das Kostüm anziehen, Emmy, und am Rand sitzen.«
»Ist mir egal«, sage ich. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nur im Team bin, weil Mom irgendwo angerufen hat. »Ich wollte sowieso nie ins Tanzteam. Das war nur Moms Versuch, Maddie 2.0 aus mir zu machen.«
Ich weiß nicht, ob ich das auch gesagt hätte, wenn kein Vicodin durch meinen Körper gesaust wäre.
»Emmy«, sagt Maddie, aber sanft, weil sie weiß, dass es stimmt.
»Ich bin nur Ersatztänzerin, Maddie. Ich bin richtig schlecht. Ich sitze sowieso die meiste Zeit draußen, und wenn ich mal mittanzen darf, dann ganz hinten.«
Ich werde enttäuscht tun müssen, wenn ich es Mom sage, aber in Wahrheit bin ich erleichtert. Kein Ziehen und Zerren mehr an den juckenden königsblauen Röckchen und kein klebriges Glitzerzeug auf den Augenlidern. Kein falsches Lächeln mehr im Gesicht.
Dr. Cooper sieht mich an.
»Was ist?«, frage ich. »Sind wir fertig?«
»Das Knie ist noch ein bisschen geschwollen«, sagt er, »aber es sieht alles gut aus. Es heilt sehr gut. Du musst nur noch anfangen, es zu beugen. Ganz langsam, erst mal nur ein bisschen.«
Plötzlich bekomme ich Panik. Ich schaue auf mein blasses, dünnes Bein, die Haut ist faltig von der Bandage. Ich denke an das Auto, an den Unfall, daran, wie ich auf dem Beifahrersitz saß und das Gefühl hatte, etwas in meinem Körper würde fehlen, etwas wäre nicht in Ordnung. Meine Kniescheibe ist gegen das Armaturenbrett geknallt, als wir durch die Luft geflogen sind, und ein zweites Mal, als wir auf den Boden gekracht sind. Ich meine, mich an eine Art Knacken zu erinnern. Das Geräusch von etwas, das bricht.
Ich will dieses Geräusch nicht mehr hören.
Mir wird schlecht.
»Nein«, sage ich. »Ich will nicht.«
»Das ist verständlich«, sagt Dr. Cooper. »Du hast Angst, dass es bricht? Sehr verständlich. Aber ich versichere dir, das wird es nicht.«
»Du schaffst das, Emmy«, sagt Maddie leise. Sie legt ihre Hand auf meine Schulter. »Du schaffst das.«
»Ich kann nicht«, sage ich. »Ich habe zu viel Angst. Ich …«
Dr. Cooper schiebt eine Hand unter meine Kniekehle. »Dir ist etwas sehr Schlimmes passiert, Emory, mehr, als du im Moment ausdrücken kannst. Aber um es hinter dir zu lassen, ist der erste Schritt, dass du dein Knie beugst. Damit du wieder gesund wirst.«
Ich schließe die Augen.
Ich weiß, es ist albern. Joey ist irgendwo in der Wildnis von Colorado und wandert und redet und tut Gott weiß was, um als bessere Version seiner selbst zurückzukommen, Joey 2.0, und Candy wird nie mehr zurückkommen, und ich habe Angst, mein verdammtes Knie zu beugen. Dabei ist das die einfachste Sache der Welt.
»Nur ein bisschen. Vielleicht wird es etwas unangenehm sein.«
Dr. Coopers Finger drücken von unten gegen mein Knie und heben es sanft an. Seine Hände fühlen sich unwirklich kalt an.
»Emmy«, flüstert Maddie.
Mein Bein steht für alles, was in diesem Auto passiert ist, und ich werde es immer mit mir herumtragen, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Ich sollte froh sein, dass ich am Leben bin. Ich habe keine Überdosis genommen, wie Joey. Ich bin nicht durch die Windschutzscheibe geflogen, wie Luther.
Oder gestorben, wie Candy.
Ich ziehe das Knie hoch. Es brennt wie Feuer, und ich stöhne.
»Du hast es geschafft!« Maddie klatscht in die Hände.
»Wie würdest du das Schmerzlevel bewerten?«, fragt Dr. Cooper. »Auf einer Skala von eins bis zehn?«
»Ich weiß nicht«, sage ich keuchend. Die Tablette lässt nach. »Fünf? Ich weiß nicht.«
»Na gut. Ich schreibe dir noch ein Rezept über Vico…«
Maddie schüttelt den Kopf und unterbricht ihn. »Danke, Dr. Cooper, aber das würde unserer Mom nicht gefallen.«
»Wie bitte?«
Maddie seufzt. »Sie wissen schon, unser Bruder. Er ist in der Entzugsklinik. Sie bewacht schon die Tabletten aus dem Krankenhaus mit Argusaugen.«
Ich kann sehen, wie in Dr. Coopers Gesicht die Verwirrung dem Verstehen weicht. Mill Haven ist klein. Natürlich hat er davon gehört.
»Ach ja, richtig. Na, ich bin froh, dass er die Hilfe bekommt, die er braucht, aber Emory hat nun mal Schmerzen. Ihre Medikamenteneinnahme kann natürlich überwacht werden, aber sie sollte nicht auf Schmerzmittel verzichten, nur weil …«
»Sie kennen unsere Mutter nicht«, sagt Maddie. »Oder doch?«
Sie starren einander an.
»Nun.« Dr. Cooper räuspert sich. »Lass es uns noch einmal versuchen, Emory. Noch ein paarmal, bevor du gehst. Deine Mutter hat ab nächster Woche Physiotherapie für zu Hause beantragt, und ich werde dir ein paar Tipps für dein Knie und Kräftigungsübungen geben. Und wenn du deine Meinung änderst, schicke ich dir das Rezept nach Hause.«
Ich beobachte von einem Liegestuhl im Garten, wie Maddie auf dem Sprungbrett einen Salto macht, sie federt hoch in die Luft, rollt sich zu einem Ball zusammen und taucht ohne einen Spritzer ins Wasser. Es ist heiß, und ich fächle mit meinem T-Shirt, um etwas Luft an den Körper zu bekommen.
Während Maddie wie ein Aal durch den Pool gleitet, betrachte ich die Backsteinmauer, die unseren Garten vom Garten der Galts trennt. Ich lasse den Blick über den Efeu, der sich an der Mauer entlangschlängelt, bis zum Eckfenster wandern, das meinem Zimmerfenster gegenüberliegt. In meinem Zimmer bin ich seit Wochen nicht mehr gewesen. Es sind sechzehn Stufen vom ersten in den zweiten Stock.
Die Jalousie ist immer noch heruntergelassen. Er ist noch nicht aus dem Zeltlager zurück.
Ich dachte, er würde mich im Krankenhaus besuchen. Unsere Regel brechen. Nur dieses eine Mal. Aber das hat er nicht getan.
Ich sehe auf mein neues rosa Handy. Schaue nach neuen Nachrichten, und dann, bevor ich mich zurückhalten kann, wechsle ich zu seinem Insta-Feed. Ich kann nicht anders. Ich will sein Gesicht sehen. Er ist wie eine Droge für mich.
Da ist er, lächelnd, mit Sonnenbrille und Basecap, die Verkörperung von strahlender, perfekter Gesundheit.
Mir geht’s blendend, lautet der letzte Post.
Und dann, darunter, ein Nachrichtentornado aller möglichen Mädchen. Dreifach-Herzchen, Smileys, Feuer. Du bist so heiß, Gage. Gage, du bist der Beste. Ich vermisse dich. Du bist zum Dahinschmelzen. Schreib miiiir!
Mein Körper füllt sich mit Hitze.
Was all diese Mädchen wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass ich diesen perfekten Mund geküsst habe? Oft. Nicht weit von diesem Liegestuhl entfernt. Gleich da drüben in unserem Poolhaus.
Du bist perfekt, kommentiert CuteCathy.
Umwerfend, schreibt PristTine.
Ich betrachte Gages volle Lippen.
Es ist doch schön so, hat er beim letzten Mal gesagt, als seine Finger über meinen Hals strichen. Nur du und ich, hier. Privat. Nur für uns.
Ein Schmerz durchzuckt mich.
»Du bist ja knallrot. Was guckst du da?«
Maddies Stimme lässt mich aufschrecken. Sie steht über mir, drückt das Wasser aus ihrem dichten Haar, die Tropfen landen auf meinen nackten Beinen.
»Nichts.« Ich drücke das Handy gegen meinen Oberschenkel.
»Ah, Geheimnisse.« Sie zwinkert mir zu. »Schon kapiert. Na, du hast ein bisschen Spaß verdient. Aber ich werde es schon noch aus dir herausholen. Ich habe meine Methoden.« Sie fängt an, mich zu kitzeln, und das rosa Handy rutscht von meinem Oberschenkel auf die feuchte Veranda. Sie schnappt es sich und fängt an zu tippen.
»Maddie!« Ich versuche, ihr das Handy wegzunehmen, bin aber nicht schnell genug.
»Oh«, sagt sie leise. Ihr Lächeln erlischt. »Oh.«
»Da läuft nichts«, sage ich schnell. »Ich weiß, es ist blöd …« Maddie schaut mich an, aber sie sieht nicht verärgert aus, wie ich erwartet habe. Sie sieht traurig aus. Warum sieht sie wegen Gage Galts Insta-Feed traurig aus?
Ich nehme ihr das Handy weg.
Mir rutscht das Herz in die Hose.
Sie hat gar nicht Gage angeschaut. Sie hat meine Nachrichten gelesen.
Tasha. Ich blinzle und scrolle nach unten.
Die ersten Nachrichten kamen einen Tag nach dem Unfall.
OMG, alles okay bei dir? Bitte ruf mich an.
Was ist passiert???
Ich glaub das nicht
Ruf mich an
Und dann, ein paar Tage später:
Hey, Emory, ruf mich an, wenn du kannst
Es ist viel los, Gerüchte und so
Warum wart ihr bei Luther Leonard im Auto?
Ich kann nicht glauben, dass Candy tot ist
Scheiße, ich bin so traurig. Ich war bei dir zu Hause, aber niemand ist da.
Ich hole tief Luft. Da sind noch weitere Nachrichten von Mädchen aus dem Tanzteam. Mary, Madison, Jesse. Candy war in der neunten Klasse auch im Tanzteam. Sie war nett, quirlig und freundlich und konnte über sich selbst lachen, wenn sie einen Schritt verpatzte. Dann wechselte sie in die Theater-AG.
Alle liebten Candy MontClair.
Es tut mir echt leid, hat Tasha vor einer Woche geschrieben.
Ich fahre morgen ins Tanzcamp, tut mir leid, dass wir uns nicht mehr sehen
Aber es wird viel geredet
Es tut mir echt leid, Emory. Ich finde das furchtbar, aber ich glaube, im Herbst, wenn die Schule wieder anfängt, solltest du dich zurückhalten, okay?
Die Mädels, na ja, sie sind einfach, also, wir sind alle echt traurig
Und es gibt so viel zu verarbeiten
Wusstest du, dass dieser Luther Drogen im Auto hatte???
Das ist so furchtbar und schlimm, wir haben alle darüber geredet. Also, alle fühlen sich einfach unwohl
Ich denke, es ist besser, wenn du dich ein bisschen zurückhältst, bis sich alle wieder wohler fühlen
Mein Herz klopft. Ich kann meine Schwester nicht ansehen.
»Sie haben dich fallenlassen«, sagt Maddie leise. »Ich habe mir Sorgen gemacht, dass das passieren könnte. Ich habe mich schon gewundert, warum dich niemand besucht hat, seit du wieder zu Hause bist.«
Ich hab das mit deinem Knie gehört, das ist echt übel
Du kannst wahrscheinlich sowieso nicht mehr ins Team
Aber, mal ehrlich, es hat dir doch nie richtig gefallen
Es tut mir wirklich leid
»Emmy«, sagt Maddie und legt die Hand auf meine Schulter.
Ich drücke das Handy mit dem Display nach unten auf meinen Bauch. Schüttele den Kopf. »Ist doch egal«, sage ich. »Echt. Wir waren nicht befreundet, nicht wirklich. Ich war nur im Team.«
Es stimmt. Ich war mit keiner von ihnen eng befreundet, aber ich war im Team, was bedeutete, dass wir zusammen in der Cafeteria zu Mittag aßen und zusammen abhingen, wenn ich mir gerade mal keine Sorgen um Joey machte. Im Team zu sein, bedeutet in der Schule eine Art Schutzschild. Menschen, mit denen man zusammen sein kann, damit man nicht allein ist. Eine Art soziales Dach, denn ich bin nicht wie Maddie, aufgeschlossen, schön, gesprächig, beliebt. All die Dinge, die ich gemäß der Familie, aus der ich komme, dem Haus, in dem ich wohne, eigentlich sein sollte. Laut meiner Mutter.
Jetzt habe ich nicht mal mehr das.
Und der Mensch, mit dem ich am liebsten darüber reden würde, der jede Einzelheit aufzählen würde, was mit jedem einzelnen dieser Mädchen nicht stimmt, auch wenn er selbst nicht dran glaubt, ist Joey. Scheiß auf sie, würde er sagen. Diese hochnäsigen Hexen. Wer braucht die schon? Ohne sie bist du besser dran.
Aber er ist nicht da. Und ich kann ihn nicht mal anrufen, weil Blue Spruce keine Telefonate zulässt. In dem Handbuch für Angehörige, das sie uns geschickt haben, steht was vom Aufbau innerer Stärke vor dem Wiedereintritt in die Welt.
»Lass uns reingehen«, sagt Maddie sanft. »Geh duschen und iss was. Wir können darüber reden. Ich kann dir helfen.«
Ich schüttele ihre Hand ab und stehe wackelig auf. Mein Knie tut wieder weh, schlimmer, als ich beim Arzt zugegeben habe, ich werde Maddie um eine Tablette bitten müssen, meine Mutter wird sich fragen, warum ich sie brauche, mein Bruder ist abhängig, und jetzt habe ich nicht mal mehr die paar Freunde, die ich zu haben glaubte, und möchte einfach nur verschwinden.
»He, sei vorsichtig, Em, was machst du denn?«
Einfach … verschwinden.
Ich humple von Maddie und ihrem besorgten Gesicht weg, ignoriere den Schmerz, der in meinem Knie vibriert, und stelle mich an den Rand unseres lächerlich großen, viel zu blauen, ach so schönen Pools in unserem ach so schönen, sorgfältig angelegten Garten.
Dann lasse ich mich hineinfallen.
Mein Hemd und meine Shorts fließen über mich hinweg, und ich schwimme unter Wasser, nur mit meinen Armen und dem gesunden Bein, hülle mich in Stille, weg von dem Unfall, dem toten Mädchen und meinem Bruder, und ich beschließe in diesem Moment, während meine Lunge brennt, dass ich den Rest des Sommers unter Wasser verbringen werde, schwerelos und unversehrt und still und sicher.
7
Ein Stern ist ein prächtiger Kamerad.
Diese Worte stammen aus einem Stück, das wir letztes Jahr im Literaturkurs gelesen haben. Sie steigen in mir hoch, während ich auf dem Rücken im Pool dümple, die Arme ausgebreitet, das Wasser plätschert an meine Wangen, der Himmel ist ein dunkler, gesprenkelter Teppich über mir. Die Geschichte einer kleinen Stadt, kleiner Leben.
Den ganzen Sommer habe ich mir diesen Himmel angesehen.
Ich kenne keine Sternbilder, ich weiß nicht, was da oben passiert, ich weiß nicht, was es bedeutet, ich kenne nichts als die Ruhe, die mir das Schweben in der Nacht schenkt. Die Art, wie sich mein Körper sanft und behütet im Wasser bewegt, das unheimliche Glucksen, das ab und zu in meine Ohren dringt. Die eigentümliche Stille von Mill Haven am späten Abend, wenn all unsere Geheimnisse eingeschlafen sind. Das Wasser vertreibt meinen Schmerz.
Seit zweieinhalb Monaten treibe ich nun schon im Wasser. Mache mich unsichtbar.
Wir sollen doch Trost in den Sternen finden, oder? Das sagen uns Dichter und Maler, Filme und Bücher. Das große Unbekannte. Das Geheimnis des Lebens, das uns aus weit entfernten Galaxien fasziniert. Schau nach oben und genieße Wunder. Erkenne deine eigene Winzigkeit in der unendlichen Weite und so.
So funktioniert auch die Unsichtbarkeit. Löst die glänzende Oberfläche ab und lässt nur Blut und Knochen zurück. Gerade genug, um sich fortzubewegen.
Ich paddle vorsichtig mit den Beinen. Plötzlich zwickt mein rechtes Knie, so schmerzhaft, dass ich nach Luft schnappe und einen Schwall Wasser einatme.
Und dann verschwinden die Sterne.
Erst frage ich mich, ob ich ertrinke, weil alles dunkel wird.
Aber es ist nur meine Mutter, die sich über mich beugt und meinen Himmel und die blasser werdenden Sterne verdeckt, während sie mich mit dem Skimmer zu sich zieht. Sie ärgert sich über mich, aber das ist ja nichts Neues.
»Emory«, sagt sie. »Raus hier. Ich muss in einer Stunde zum Flughafen.«
Mein Körper stößt gegen den Beckenrand. Sie lässt den Skimmer auf den Steinboden fallen, wo er klatschend aufschlägt.
»Ich kann diesen Unsinn«, sagt sie und deutet vage auf den Pool und den heller werdenden Himmel, »heute nicht gebrauchen, verstehst du?«
Sie ist bereits perfekt geschminkt, ihre Haare werden von einer adretten türkisfarbenen Spange im Nacken gehalten, und sie trägt ihre Reisekleidung: burgunderfarbene Leggings, schwarze Ballerinas, ein teures, aber lässig wirkendes cremefarbenes Baumwollshirt und eine lange cremefarbene Strickjacke mit offenen Nähten.
»Ich möchte, dass du aus dem Wasser kommst, duschst und dich für deinen Termin mit Sue fertig machst. Okay? Kannst du das tun? Kannst du diese eine Sache für mich tun?«
Wasser läuft mir über das Gesicht, als ich die Beine sinken lasse und auf den Boden stelle.
Ihr Blick begegnet meinem. Ich nicke. Sie geht zurück ins Haus und schiebt die Terrassentür hinter sich zu. Aus allen Fenstern leuchten Lichter, als hätte unser Haus tausend Augen.
Natürlich kann ich diese eine Sache für sie tun. Ich habe diese eine Sache noch nie nicht getan.
Heute ist der Tag, an dem meine Mutter ins Flugzeug steigt, um Joey aus der Wildnis Colorados abzuholen, wo er zweieinhalb Monate gewandert ist und therapiert wurde und wo man ihm die Drogen und die schlechten Gedanken aus dem Kopf geredet hat. Sie wird ihn zurückholen, herausputzen und ihn für sein letztes Jahr an die Heywood High schicken, als wäre nie etwas passiert. So läuft das bei uns.
Als wäre Joeys alter Toyota Corolla mit dem abgeplatzten Lack, den durchgesessenen Sitzen und abgefahrenen Reifen nicht eines Nachts im letzten Juni von der Wolf Creek Road geflogen, während Candy MontClair schrie und Luther Leonard wie ein Verrückter lachte, bevor sein Kopf gegen die Windschutzscheibe krachte und Joeys Körper auf dem Rücksitz gegen Candy geschleudert wurde und sie zerquetschte, weil er wie ein nasser Sack war, weil er so high war, dass er nicht mehr bei Bewusstsein war, sondern in ganz anderen Sphären. Er war wie einer dieser verblassenden Sterne, die gerade über mir schweben, als ich aus dem Pool steige und zum Haus humple: so schön anzusehen, so voller Geheimnisse, aber viel zu weit weg, um sie zu erreichen.
In meinem Bad massiere ich mein Knie, während ich darauf warte, dass das Wasser warm wird. Fahre mit einem Finger sanft über die Narbe.
Im Krankenhaus hatten sie eine Tafel mit zehn runden Gesichtern an der Wand, der Ausdruck wurde mit jedem Gesicht schlimmer, das letzte Gesicht war ganz zerknittert und weinte. Jedes Gesicht hatte eine Zahl. Das letzte, weinende Gesicht hatte eine Zehn und sollte heißen, dass der Schmerz »so schlimm, wie es nur geht« war. Der größte Schmerz, den man sich vorstellen kann. Ich wollte immer auf diese Zahl zeigen, weil es sich wirklich so anfühlte, mein Knie und alles andere. Aber meine Eltern waren die meiste Zeit den Gang runter bei meinem Bruder und sollten sich nicht auch noch um mich sorgen. Außerdem wollte ich nicht, dass Maddie noch mehr weinen musste. An den meisten Tagen nahm ich die Vier, das Gesicht, das nur einen grimmigen Strich als Mund hatte, nichts Halbes und nichts Ganzes. »Tut spürbar weh.«
Ich beuge mich vor, halte mich mit beiden Händen am Badewannenrand fest, stelle zuerst den gesunden Fuß hinein und schiebe dann vorsichtig und unter Schmerzen mein verletztes Bein über den Rand. Es gibt vier Badewannen in unserem Haus, drei davon mit Klauenfüßen, restaurierte Originale. So ist das, wenn man mit einer bestimmten Art von Mutter in einem Haus von 1884 aufwächst: Die Küchengeräte sind auf dem neuesten Stand der Technik, aber der Rest des Hauses bleibt »der Geschichte treu«. Meine Mutter liebt die Vergangenheit – außer wenn die Vergangenheit unbequem ist.
Ich versuche, das Pochen in meinem Knie zu messen. Ist das eine Vier? Eine Sechs? Tut es spürbar weh? Tut es sehr weh? Ich denke an das Rezept, das Dr. Cooper mir gegeben hat, als Maddie noch zu Hause war, und von dem ich meiner Mutter nichts gesagt habe. Nachdem Maddie abgereist ist, hat sie meine Schmerzmittel versteckt.
So ist das, wenn man einen drogensüchtigen Bruder hat: Die eigene Mutter wird so paranoid, man könnte genauso werden, dass sie die Schmerzmittel rationiert. Sie bewahrt sie in einem verschlossenen Schrank in der Garage auf, zusammen mit allen anderen Medikamenten im Haus: Aspirin, Ibuprofen, Tylenol, Midol, was auch immer sie nimmt, um nachts in ihren Zombieschlaf zu fallen.
Als ich sie gefragt habe, was sie mit der Tupperdose voll Schmerzmittel vorhabe, hat sie gesagt: »Ich möchte vermeiden, dass dein Bruder in Versuchung kommt, wenn er wieder zu Hause ist.«
Und als ich sie gefragt habe, warum sie all ihren Schmuck in den Safe in Dads Arbeitszimmer legte, sagte sie: »Vorsichtsmaßnahme.«
»Joey hat dich nie bestohlen«, sagte ich. »Das würde er niemals tun.«
Meine Mutter sah mich auf eine Weise an, die mich verunsicherte.
Würde er? Würde Joey stehlen?
»Hat er?«, fragte ich schließlich, verzweifelt über ihr Schweigen.
»Nein, nicht dass ich wüsste.« Sie blies sich eine Haarsträhne von der Wange. »Ich möchte einfach nur das Beste für uns alle, Emory.«
Sie hat eine pummelige Frau mit einem Namensschild – Sue S., Pflegeengel – eingestellt, die zu uns nach Hause kommt und mir hilft, mein Bein zu trainieren, aber diese Frau setzt sich einfach vor den Fernseher, wenn ich aufgebe, flach auf dem Rücken auf der blauen Matte im Wohnzimmer liege und mir die Tränen übers Gesicht laufen, während ich leise weine, vor Schmerz, aber auch wegen vieler anderer Dinge.
Sue S. verdient neun Dollar die Stunde, wie gut soll sie sich da um mich kümmern, ein reiches Mädchen in einem großen viktorianischen Haus auf einem Hügel in Mill Haven?
Man könnte denken, dass sich das Unsichtbarsein leicht und luftig und einfach anfühlt, ohne Druck, aber das stimmt nicht.
Es ist unglaublich schwer.
Als ich mich abgetrocknet und angezogen habe und in die Küche komme, stellt meine Mutter einen Teller mit Eiern, Erdbeeren und Toast auf die Kücheninsel.
Dann schiebt sie ein Blatt Papier hinterher. Die Liste.
Ich überfliege sie und registriere das Übliche: Fuzzy füttern, Sue ihren Scheck geben, dafür sorgen, dass Goldie etwas kocht, das Dad essen kann, wenn er nach Hause kommt, und dann noch etwas.
»Mom«, sage ich und wünschte, meine Stimme würde nicht zittern. »Ich weiß nicht … Ich glaube, das schaffe ich nicht. Kannst du nicht mit Joey einkaufen gehen, wenn ihr zurück seid?«
Die Stimme meiner Mutter ist sanft wie Seide. »Blödsinn, Emory. Du brauchst doch auch neue Sachen. Es wird dir guttun, mal rauszukommen. Geh ein bisschen im Einkaufszentrum bummeln. Sieh mal, ich habe seine Größen aufgeschrieben, da steht genau, was du besorgen sollst. Du kannst ein Taxi nehmen.«
Das Einkaufszentrum in der Stadt. Da will ich nicht hin. Ich will niemanden aus der Schule sehen. Unwohl. Gerüchte. Das hat Tasha geschrieben.
Leute, die Candy MontClair vermissen.
»Mom«, sage ich noch mal. »Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht … Da sind bestimmt Leute aus der Schule.«
Sie sieht mich mit einem Ausdruck an, den Maddie, Joey und ich den Blick nennen: Ihr Gesicht verwandelt sich dabei irgendwie in eine leere, undurchdringliche Fläche, so als würde sie auf eine Reaktion warten, damit sie den richtigen Ausdruck auflegen kann: Missbilligung oder Resignation mit Zeitverzögerung. Es ist Warnung und Herausforderung zugleich.
Im Küchenfenster hinter ihr geht die Sonne auf, orange und golden, und umgibt meine Mutter mit einer schimmernden Krone.
»Reiß dich zusammen, meine Liebe.« Meine Mutter lächelt. »Die Leute haben mein Leben lang über mich geredet. Das macht dich nur stärker. Uns alle.«
Sie steckt ihr Handy in die Handtasche.
»Ich verlasse mich auf dich«, sagt sie und sieht auf die Uhr.
»Ich verstehe nicht, warum wir Joey nicht alle zusammen abholen können.«
»Das könnte ein bisschen überwältigend sein, ich möchte ihn nicht überfordern. Er wird Zeit brauchen, um sich wieder einzugewöhnen. Ich hole ihn ab, wir essen gemeinsam zu Abend, übernachten im Hotel und fliegen morgen zurück.«
Ich habe keine Ahnung, was so überwältigend daran sein soll, seine Familie zu sehen, wenn man aus der Entzugsklinik entlassen wird. Heißt das nicht einfach, dass sie einen lieb haben?
Sie streichelt Fuzzy über den Kopf und geht durch die Tür zur Garage. Wenige Minuten später springt ihr Auto an, das Garagentor rollt auf und wieder zu, und weg ist sie.
Ich starre den Teller mit den knallgelben Eiern an, den leuchtenden Erdbeeren und dem gebutterten Toast. Ich stehe so still wie möglich, lausche in mich hinein, ob mein Körper Hunger meldet.
Er meldet keinen, also werfe ich das Essen in den Müll und humple wieder nach oben, um mir einen frischen Badeanzug anzuziehen. Die Sonne ist aufgegangen, die Nachbarschaft ist ruhig, ich kann noch mindestens zwei Stunden treiben, bevor Sue kommt.
8
»Dein Bruder kommt morgen nach Hause?«, fragt Sue. Sie hat sich auf dem honigfarbenen Ledersofa ausgestreckt, ihre nackten Füße liegen auf dem Lieblingskissen meiner Mutter.
Es hat eine Farbe namens Bungalow Rose, einer Kreuzung aus Knallpink und den Erdbeeren von meinem Frühstück, die jetzt blutig und zerdrückt im Müll liegen.
»Ja«, schnaufe ich auf der Matte, während ich langsam, in unendlich kleinen Schritten, mein Knie beuge. Manchmal hilft Sue mir, legt ihre warme Hand auf mein Knie, die andere in die Kniekehle. Aber wir scheinen uns stillschweigend darauf geeinigt zu haben, dass sie hauptsächlich fernsieht, während ich auf der Matte liege und halbherzig meine Übungen mache.
Sue ist jetzt vielleicht meine einzige Freundin, und sie weiß es nicht mal.
»Ich wette, du bist traurig, dass du das große alte Haus dann nicht mehr für dich allein hast, was? Große Brüder machen nur Lärm, stimmt’s?« Sue schaltet von Forensic Files auf SpongeBob um. Thaddäus Tentakels unglückliches Gesicht füllt den riesigen Flachbildschirm über dem Kamin.
Mein Blick schweift zur Decke, während ich das Bein senke. Vorsichtig.
Es gibt viele Zimmer in diesem Haus, aber Joey hat sich den Dachboden gewünscht, als er dreizehn wurde. Den höchsten Punkt. Schräge Decken, ein perfektes Dreieck, sein Zeichentisch steht genau vor dem Fenster zwischen den Schrägen. Von diesem Fenster kann man alles im Tal von Mill Haven sehen, sogar die Mühle, die meine Familie vor langer Zeit gebaut und die dieser Stadt viele Jahre Wohlstand gebracht hat. Sie steht schon seit Jahren still, schon lange bevor Maddie, Joey und ich geboren wurden. Sie liegt am Rand von Mill Haven, am Ende der Wolf Creek am Fuße der Berge, umgeben von Stacheldraht und Verbotsschildern. Die kleinen Gebäude, in denen die Arbeiter früher lebten, stehen wie vergessene Monopoly-Häuser um die Mühle herum.
Joey hängte seine Bilder überall auf. Die Blätter flatterten im Wind, wenn er das Fenster öffnete, um frische Luft hereinzulassen. Wenn ich mit Fuzzy spazieren ging und Joey zu Hause war, konnte ich von der Aster Avenue zu ihm hochschauen und ihn dort zeichnen sehen, den Kopf über seinen Tisch gebeugt, die Schultern zu den Ohren hochgezogen. Manchmal blickte er nach unten, wenn er mich auf der Straße bemerkte.
Pot-Rauch stieg aus seinem Mund, wenn er mich anlächelte und einen Finger an die Lippen legte.
Schhhh.
Es war nur Gras. Viele Kids rauchen Gras. Das hat sogar mein Dad mal gesagt: »Ein bisschen Rebellion, ein bisschen Ausprobieren. Das ist typisch für einen Teenager. Nicht weiter ungewöhnlich.«
»Eigentlich«, sage ich zu Sue, »war er immer ziemlich ruhig.« Außer wenn er es nicht war.
Aber das ist vorbei. Jetzt wird alles anders, oder? Das ist der Plan. Im Blue-Spruce-Handbuch heißt es: Die Familie sollte dafür sorgen, ein stabiles, beständiges Umfeld zu schaffen.
Aber Sue hört mir nicht zu. Sie verfolgt, wie sich SpongeBob mit Thaddäus streitet. »Ich wünschte, ich würde in einer Ananas auf dem Meeresgrund leben«, kichert sie. »Unter Wasser ist alles besser. Wie du mit diesem Pool.«
Bevor Sue geht, gebe ich ihr zwanzig Dollar, damit sie für mich die Dachbodentreppe hochsteigt und Joeys Kleidung und seine Malsachen holt. Maddie hat aufgeräumt, als sie hier war, aber sie hat nicht alles heruntergebracht. Ich hoffe, dass er, wenn er seine Stifte und Skizzenbücher sieht, vielleicht, nur vielleicht, wieder Lust zum Zeichnen bekommt. Dass es ihm helfen könnte.
Sue zuckt mit den Schultern. »Du musst wirklich zu Cooper gehen wegen deinem Bein. Ich glaube nicht, dass du Fortschritte machst, wenn du nicht mal eine Treppe steigen kannst.«
»Ich bin nur müde.«
Sie läuft zweimal hoch und kommt mit Klappboxen mit seinen Sachen wieder herunter. Sie stellt die Kisten neben das Bett in Maddies Zimmer, das jetzt Joeys Zimmer sein wird.
»Das ist ein wirklich schöner Raum da oben. So viel Licht«, sagt sie.
Wahrscheinlich hätte ich selbst die Treppe gehen können, schön langsam, denn ich kann mittlerweile wieder in den ersten Stock hinaufgehen und in meinem Zimmer schlafen, aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich nicht. Das Dachgeschoss war Joeys Unterschlupf. Ich will da nicht hin.
Sue bleibt vor Maddies Schreibtisch stehen und betrachtet den Stapel mit Joeys Zeichnungen, die Maddie vom Dachboden geholt hat. »Schöne Bilder. Ich habe als Kind immer gerne gezeichnet.« Sie sieht die Papiere durch, berührt den Rand einer von Joeys Drachenillustrationen. »Das ist mir irgendwie verloren gegangen, weißt du?« Sie sieht aus, als wollte sie noch etwas sagen, doch dann schüttelt sie den Kopf. »Hast du meinen Scheck? Ich habe noch einen Termin drüben an der Jefferson Road.«
Ich reiche ihr den Scheck. Ich höre, wie sie die Treppe hinunterpoltert und durch die Vordertür hinausgeht, vorbei an Goldie, die im Arbeitszimmer herumwerkelt.
Ich räume gerade Maddies Sachen aus ihrer Kommode in eine riesige Plastikbox, als sie mir schreibt.
Alles klar bei dir?
Logisch, tippe ich zurück.