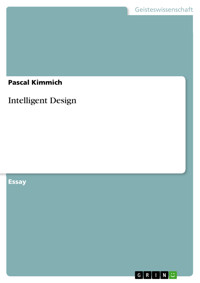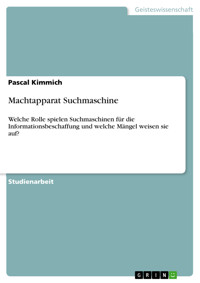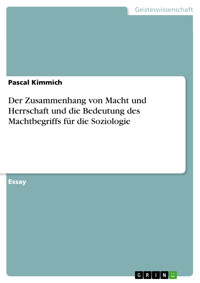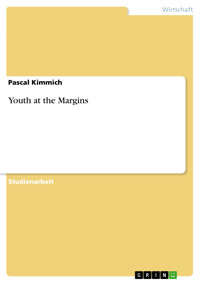
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Arbeitsmarktökonomik, , Sprache: Deutsch, Abstract: Arbeitslosigkeit ist eines der größten Probleme der heutigen Zeit. Besonders problematisch ist die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen. Die Jugendlichen sind die Zukunft der Gesellschaft. Daher ist es aus diversen Gründen wichtig, dass ihre Kreativität und ihre Potenziale nicht verschenkt werden. In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Jugendarbeitslosigkeit in den Staaten der Europäischen Union. Ich werde darstellen, welche Folgen Arbeitslosigkeit für Jugendliche hat und wie die Jugendarbeitslosenquote sich seit der Gründung der EU bis heute verändert hat. Der besondere Fokus liegt hier bei der Entwicklung seit dem Ausbruch der „Eurokrise“. Außerdem werde ich beschreiben, welche Maßnahmen von Seiten der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union ergriffen wurden, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. Damit soll die Frage beantwortet werden, wie wichtig das Thema Jugendarbeitslosigkeit für die gesamte EU ist und warum in Zukunft alles dafür getan werden sollte, um die Erwerbslosigkeit von Jugendlichen endgültig zu beseitigen. Die statistischen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa beziehen sich auf Berechnungen von „Eurostat“. Eine wichtige Quelle für diese Arbeit ist das Buch „Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union - Integration oder Marginalisierung“ von Barabara Tham. Thams Ausführungen über die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU seit ihrer Gründung und ihre Ansichten zur Relevanz von Jugendarbeitslosigkeit für die Gesellschaft sind ein wichtiger Baustein der folgenden Arbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1 Arbeitslosigkeit von Jugendlichen
2 Jugendarbeitslosigkeit in Europa
3 Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU
4 Gründe für Jugendarbeitslosigkeit
5 Folgen von Jugendarbeitslosigkeit
5.1 Psychische Folgen
5.2 Jugendarbeitslosigkeit und Kriminalität
5.3 Jugendarbeitslosigkeit als Gefahr für die Gesellschaft
5.4 Wirtschaftliche Folgen
6 Probleme der EU beim Umgang mit Jugendarbeitslosigkeit
7 Die Bedeutung der Jugend für die EU
Literaturverzeichnis
1 Arbeitslosigkeit von Jugendlichen
Arbeitslosigkeit ist eines der größten Probleme der heutigen Zeit. Besonders problematisch ist die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen. Die Jugendlichen sind die Zukunft der Gesellschaft. Daher ist es aus diversen Gründen wichtig, dass ihre Kreativität und ihre Potenziale nicht verschenkt werden. In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Jugendarbeitslosigkeit in den Staaten der Europäischen Union. Ich werde darstellen, welche Folgen Arbeitslosigkeit für Jugendliche hat und wie die Jugendarbeitslosenquote sich seit der Gründung der EU bis heute verändert hat. Der besondere Fokus liegt hier bei der Entwicklung seit dem Ausbruch der „Eurokrise“. Außerdem werde ich beschreiben, welche Maßnahmen von Seiten der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union ergriffen wurden, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. Damit soll die Frage beantwortet werden, wie wichtig das Thema Jugendarbeitslosigkeit für die gesamte EU ist und warum in Zukunft alles dafür getan werden sollte, um die Erwerbslosigkeit von Jugendlichen endgültig zu beseitigen.
Die statistischen Daten zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa beziehen sich auf Berechnungen von „Eurostat“. Eine wichtige Quelle für diese Arbeit ist das Buch „Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union - Integration oder Marginalisierung“ von Barabara Tham. Thams Ausführungen über die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU seit ihrer Gründung und ihre Ansichten zur Relevanz von Jugendarbeitslosigkeit für die Gesellschaft sind ein wichtiger Baustein der folgenden Arbeit.
Brigitte Schels lieferte mit ihren Ausführungen zur psychischen Wirkung der Arbeitslosigkeit auf Jugendliche wichtiges Material. Die Bedeutung von Bildung für Jugendliche lieferte der Beitrag „Frankreich“ von Patrick Werquin im Buch „Jugendarbeitslosigkeit - Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme in Europa“. Einen Überblick über die aktuelle Entwicklung im Zuge der Eurokrise lieferte GAB Karl Brenke in seinem Artikel „Arbeitslosigkeit in Europa: Jugendliche sind viel stärker betroffen als Erwachsene. Fakten zum Zusammenhang von Jugendarbeitslosigkeit und Gewalt beziehen sich auf Axel Desseckers Beitrag „Arbeitsmärkte, Jugendarbeitslosigkeit und
2 Jugendarbeitslosigkeit in Europa
Bei der Quote der Jugendarbeitslosen werden alle Arbeitslosen zwischen 15 und 24 Jahren registriert (vgl. Eurostat 2011). Da in dieser Phase des Lebens viele Menschen noch Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, liegt die Jugendarbeitslosenquote im Normalfall immer über der Gesamtarbeitslosenquote (vgl. Eurostat 2012a). Dennoch werden in die Statistik nur diejenigen aufgenommen, die in den vier Wochen vor der Umfrage zumindest zeitweise aktiv auf Arbeitssuche waren (vgl. Eurostat 2012b). Somit offenbaren die Daten Probleme der Jugendlichen bei der Jobsuche, die von der Politik ernst genommen werden müssen. Gerade für junge Menschen, die als wichtige Partizipierende der zukünftigen Gesellschaft angesehen werden, ist die Arbeitslosigkeit problematisch. Die Jugendarbeitslosenquoten können dabei helfen, zentrale Probleme im Umgang der Politik mit den Jugendlichen zu offenbaren und sind zudem ein wichtiger Indikator für die Auswirkungen von gesamtwirtschaftlichen Krisen, wie beispielsweise der Eurokrise auf den Arbeitsmarkt der Zukunft.
3 Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU
Eine wirtschaftliche Rezession führte in den 1990er Jahren zu einem rapiden Rückgang der Beschäftigungszahlen. Von 1991 bis 1994 verloren fünf Millionen Bürger der Europäischen Union ihre Arbeit. Das bedeutete im Jahr 1994 eine Steigerung der Arbeitslosigkeit auf elf Prozent (vgl. Europäische Kommission 1997). Diese Zahl sank dank einer verbesserten Konjunktur bis ins Jahr 1997 auf 10,7 Prozent. Die Quote der jugendlichen Arbeitslosen lag zu diesem Zeitpunkt im EU-Durchschnitt bei 20,9 Prozent. Während Österreich mit 5,9 Prozent, Dänemark mit 8,4 Prozent und die Niederlande mit 8,7 Prozent im Jahr 1997 vergleichsweise wenige Jugendliche ohne Arbeit zu beklagen hatten, bereiteten die Zahlen der Spanier und der Italiener Sorgen. In Spanien waren mit 38,4 Prozent deutlich mehr als ein Drittel der Jugendlichen auf Arbeitssuche, dicht gefolgt von 32,9 Prozent in Italien (vgl. Eurostat 1997:6). Besonders brisant sind auch die Daten über die Dauer der Arbeitslosigkeit. 1997 suchten nur 39,2 Prozent der jugendlichen Erwerbslosen weniger als sechs Monate nach einem Job. 19,9 Prozent fanden sogar über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren keine Arbeitsstelle (vgl. Eurostat 1998, S. 234f). Bis zum Jahr 2000 sank die Jugendarbeitslosenquote in den Staaten der Europäischen Union auf 17,3 Prozent. In den darauffolgenden Jahren stieg sie jedoch kontinuierlich an, bis sie im Jahr 2005 bei 18,7 Prozent lag. Damit stieg die Jugendarbeitslosigkeit in diesem Zeitraum rapider an als die Arbeitslosigkeit der Personen von 25 bis 74 Jahre, die von 2000 (7,4 Prozent) bis 2005 (7,7 Prozent) um nur 0,3 Prozentpunkte wuchs. Bis zum Jahr 2008 vollzog sich eine sehr positive Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union: Die Quote fiel bis auf 15,7 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote der 25-74-jährigen EU-Bürger sank deutlich - auf sechs Prozent (vgl. Eurostat 2012c). Dieser Trend kam jedoch im Jahr 2009 zu einem jähen Ende, als die Auswirkungen der im Jahr 2008 ausgebrochenen globalen Finanzkrise und der daraus resultierenden Eurokrise den Arbeitsmarkt erreichten (vgl. Brenke 2012:2). Die Arbeitslosenquote der 15-24-jährigen explodierte förmlich und stand im Jahr 2009 bei 20,1 Prozent. Bis zum Februar 2013 stieg sie weiter auf 23,5 Prozent. Das entspricht 5,694 Millionen Jugendlichen ohne Arbeitsplatz. Deutlich zeigt sich, dass sich die Eurokrise nicht nur auf die 17 Eurostaaten auswirkt, sondern in gleichem Maß auch auf die anderen zehn Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Jugendarbeitslosenzahlen der Eurostaaten lagen mit 23,9 Prozent nur geringfügig höher als die der gesamten EU. Im Ländervergleich stehen Deutschland (7,7 Prozent), Österreich (8,9 Prozent) und die Niederlande (10,4 Prozent) am besten da, während in Griechenland (58,4 Prozent) und Spanien (55,7 Prozent) mehr als die Hälfte der Jugendlichen zum Zeitpunkt der Erhebung ohne Job waren (vgl. Eurostat 2013:4).
Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ging in etwa gleichem Maße voran, wie der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Erwachsenen. Lediglich die Auf- und Abschwünge äußerten sich bei den Jugendlichen stärker. Dennoch sieht der Soziologe Karl Brenke die Jugendlichen in der EU stärker benachteiligt, als die anderen Altersklassen. Er beschreibt, dass Jugendliche generell schlechtere Chancen haben einen Job zu finden, als Erwachsene. Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung haben innerhalb der EU deutliche Nachteile gegenüber den Erwachsenen: sogar, wenn man einen Jugendlichen mit abgeschlossener Berufsausbildung mit einem unqualifizierten Erwachsenen vergleicht. Offensichtlich ist den Arbeitgebern Lebens- und Berufserfahrung sehr wichtig. Er beschreibt aber auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Union.
4 Gründe für Jugendarbeitslosigkeit
Jugendarbeitslosigkeit hat viele unterschiedliche Gründe. Darüber, dass schulische und berufliche Bildung eine zentrale Rolle für den Erfolg oder Misserfolg der Jugendlichen bei der Suche nach Arbeit spielt, besteht in der wissenschaftlichen Diskussion jedoch kein Zweifel. „Arbeitssuchende müssen über ein gutes Bildungs- und Ausbildungsniveau verfügen, um auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu haben“ (Tham 1999:37). Besonders gefragt sind Akademiker. So lässt sich für die meisten Staaten der EU sagen, dass die Wahrscheinlichkeit der Arbeitslosigkeit sinkt, je besser der Jugendliche gebildet ist (vgl. Tham 1999:38f).
Karl Brenke bezweifelt aber, dass die hohe Jugendarbeitslosigkeit nur in unzureichender Qualifikation der Jugendlichen begründet ist, da sich dies nur in wenigen Ländern nachweisen lasse. Er sieht die Probleme eher in der fehlenden Berufserfahrung begründet. Das zeige sich vor allem daran, dass „in jenen Ländern, in denen relativ viel betrieblich ausgebildet wird, bei den Personen mit einer Ausbildung der Unterschied zwischen den Erwerbslosenquoten der Jugendlichen und der Erwachsener vergleichsweise gering ist“ (Brenke 2012:10). Eine praxisnahe Ausbildung kann also in diesen Staaten das Arbeitslosigkeitsrisiko für Jugendliche senken (vgl. Brenke 2012:10). Das Argument der fehlenden Erfahrung schildert auch Patrick Werquin (vgl. Werquin 2000:33). Sowohl Brenke als auch Werquin betonen das Fehlen einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Grund für spätere Arbeitslosigkeit (vgl. Werquin 2000:34 und Brenke 2012:10).
5 Folgen von Jugendarbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit in jungen Jahren ist ein weit verbreitetes Phänomen. Die aktuellen Zahlen über Jugendliche Arbeitslose in der Europäischen Union sind besorgniserregend. Welche negativen Folgen Jugendarbeitslosigkeit für die Jugendlichen selbst, für die Wirtschaft und nicht zuletzt für die Gesellschaft hat, soll im folgenden Kapitel erörtert werden
5.1 Psychische Folgen
Dass Arbeitslosigkeit, gerade über einen längeren Zeitraum hinweg, kein Vergnügen darstellt, ist spätestens durch die Marienthal-Studie eindrucksvoll belegt worden (vgl. Jahoda; Lazarsfeld; Zeisel 1982). Für Jugendliche ist Arbeitslosigkeit aus einigen Gründen noch schädlicher für das psychische Wohlbefinden, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Bei arbeitslosen Jugendlichen lassen sich vermehrt Nervosität und Depressionen nachweisen (vgl. Hammarström; Janlert 1997). Der Psychologe Thomas Kieselbach erläutert dazu: „Wer arbeitslos ist, fühlt sich oft stigmatisiert, nutzlos. Viele ziehen sich zurück, weil sie sich schämen. Sie verlieren ihr Selbstwertgefühl. Das alles ist der Nährboden für Depressionen“ (Süddeutsche Zeitung 2010). Alleine die Tatsache eine Arbeit zu haben, steigert im Gegensatz dazu das psychische Wohlbefinden der Heranwachsenden (Patterson 1997). Doch nicht nur die Arbeit an sich ist wichtig für Jugendliche. Arbeit ist in kapitalistischen Gesellschaften nicht nur Selbstverwirklichung, sondern in erster Linie auch ein Mittel zur Geldbeschaffung. Erwerbsarbeit wirft Verdienst ab, der einen angestrebten Lebensstil ermöglicht. Besonders wichtig für Jugendliche sind dabei soziale Beziehungen und Freizeit. Ohne Geld wird das soziale Leben schnell eingeschränkt. Aus diesem Grund sind finanzielle Restriktionen die stärkste Belastung für die jungen Arbeitslosen (Hammer 2000). Diese Einschränkungen sind für Jugendliche besonders dramatisch, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, Kapital anzuhäufen. Sie verfügen demnach über weniger Reserven, die Sicherheit erzeugen könnten, als die erwachsenen Arbeitslosen. Zudem haben sie eingeschränkte Möglichkeiten, Arbeitslosengeld zu beziehen, weil sie dazu eine bestimmte Zeit berufstätig gewesen sein müssen (vgl. Underlids 1997). In einigen Fällen können die finanziellen Probleme von den Eltern aufgefangen werden. Das muss aber nicht unbedingt positive psychische Folgen haben. Selbstverdientes Geld hat für viele Jugendliche einen ganz anderen Stellenwert, als das zur Verfügung gestellte Geld der Eltern. So kann es in Folge der Hilfszahlungen von Seiten der Familie nicht nur zu finanzieller Stabilität, sondern auch zu Streitigkeiten innerhalb der Familie kommen (vgl. Hammer 2000). Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, ist der Bildungsgrad bei der Jobsuche relevant. Beim Umgang mit der eigenen Arbeitslosigkeit kommt es sehr auf die subjektiv empfundenen Chancen an, möglichst bald wieder Teil der arbeitenden Bevölkerung zu sein. Höher gebildete Jugendliche neigen eher dazu, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Zukunft positiv einzuschätzen und die Arbeitslosigkeit als vorübergehend zu bewerten (vgl. Schaufeli 1997). Schon eine abgeschlossene Berufsausbildung ist für Jugendliche ein Grund für ein erhöhtes Wohlbefinden (vgl. Schels 2007:26). Die negativen Folgen der Arbeitslosigkeit betreffen nicht nur die Betroffenen selbst. „Auch für nahe Angehörige kann Arbeitslosigkeit eine gravierende Beeinträchtigung von Wohlstand, Selbstachtung, sozialem Ansehen und Lebenschancen bedeuten. Selbst bei Beschäftigten werden Arbeitsvermögen, Leistung, Solidarität und Krankenstand beeinflußt“ (Oschmiansky 2010).
5.2 Jugendarbeitslosigkeit und Kriminalität
In den Medien und der Wissenschaft wird oftmals kontrovers diskutiert, ob Jugendliche eher straffällig werden, wenn sie arbeitslos sind. Ein Zusammenhang konnte allerdings bisher nicht nachgewiesen werden. Manche Autoren sind davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt. Andere wiederum bezweifeln, dass eine solche Korrelation besteht (vgl. Dessecker 2007:21). Arbeitslosigkeit führt jedoch dazu, dass das Einkommen begrenzt wird. In einer solchen Situation ist es durchaus denkbar, „dass die Spannung zwischen kulturell akzeptierten Zielen und den wirtschaftlichen Möglichkeiten wächst“ (vgl. Dessecker 2007:29). Der Psychologe Thomas Kieselbach schließt nicht aus, dass ein Teil der arbeitslosen Jugendlichen mit Gewalt auf ihre Lebenssituation reagiert. Dies habe vor allem damit zu tun, dass Arbeitslosigkeit auch Kontrollverlust bedeutet. Gewalt beinhaltet dagegen die Ausübung von Kontrolle und kann je nach Charakter durchaus eine Reaktion auf den Kontrollverlust durch die Arbeitslosigkeit darstellen. Das sei jedoch nicht die Regel. Arbeitslose ziehen sich nach Angabe von Kieselbach eher in die Isolation zurück und werden depressiv (vgl. Süddeutsche Zeitung 2010).
5.3 Jugendarbeitslosigkeit als Gefahr für die Gesellschaft
Auch für die Gesellschaft kann die Jugendarbeitslosigkeit fatale Folgen haben. Die Jugendlichen sind die Zukunft der Europäischen Union. Die 94 Millionen jungen Menschen sind ein wichtiger Faktor für das Fortbestehen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten (vgl. Spiegel Online 2012).
„Eine hohe Arbeitslosigkeit führt oft dazu, dass der sozialen Zusammenhalt zerfällt“ (vgl. Süddeutsche Zeitung 2010). Auch andere Wissenschaftler sind der Meinung, dass die gesellschaftlichen Folgen von Jugendarbeitslosigkeit ernst zu nehmen sind. Ekkehard Ernst, Mitautor einer Studie der UN über Jugendarbeitslosigkeit, warnt vor einer „verlorenen“ Generation. Anzeichen dafür gab es in der Geschichte der Europäischen Union schon. Im Jahr 2005 fanden in mehreren Pariser Vorstädten und an weiteren Orten in Frankreich schwere Krawalle von Jugendlichen statt. Die jungen Franzosen zündeten Autos an, griffen Polizisten mit Molotow-Cocktails an, warfen Steine und errichteten Straßensperren. Die französische Regierung rief den Notstand aus (vgl. Stern 2005). Als ein entscheidender Grund für die Ausschreitungen wird die Jugendarbeitslosigkeit genannt. Die Zahlen der arbeitslosen Jugendlichen sind heute noch genauso alarmierend wie im Jahr 2005. Mit 27 Prozent Arbeitslosigkeit hat Frankreich auch im Jahr 2013 noch eine der höchsten Quoten innerhalb der EU. Das führt zu Pessimismus unter den Heranwachsenden. Noch erschreckender sind die Zahlen in den sogenannten „Banlieues“, den Pariser Vororten, in denen die Jugendkrawalle im Jahr 2005 ihren Lauf nahmen. Hier liegt die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen bei 42 Prozent. Die randalierenden Jugendlichen nannten sich selbst „Génération Précaire“, die „prekäre Generation“ (vgl. Tagesschau 2013). Das Gefühl der sozialen Ausgrenzung und die Wahrnehmung der eigenen Zukunft als hoffnungslos: das sind zu einem großen Teil Folgen von Arbeitslosigkeit, wie sie Jugendliche in manchen Gebieten der Europäischen Union erleben.
Diese Gefahr sieht auch die EU selbst. So äußerte sich der Wirtschafts- und Sozialausschuss schon im Jahr 1996 zum Thema Arbeitslosigkeit. Diese „bedroht auch den Zusammenhalt des europäischen Sozialmodells und birgt die Gefahr einer Destabilisierung der demokratischen Strukturen in sich“ (Wirtschafts- und Sozialausschuss 1996:83). Ulrich Beck schrieb im Jahr 1996, dass Demokratie, Marktwirtschaft und Sozialstaat sich gegenseitig bedingen. Verliert einer der Faktoren an Bedeutung, wird das auch die anderen beiden Faktoren in Frage stellen (vgl. Beck 1996:142). Barbara Tham sieht für die Zukunft eine Polarisierung der Jugendlichen in Europa voraus. Ihrer Meinung nach teilt sich die Jugend dann in Gewinner und Verlierer auf und die Gefahr, ins soziale Abseits zu geraten steige weiter. Für Jugendliche, die aufgrund ihres Alters noch nicht so sehr in die Gesellschaft integriert sind, sei das besonders problematisch (vgl. Tham 1999:55).
Das Gefühl der sozialen Ausgrenzung ist in den nordeuropäischen Ländern höher als in den Ländern Südeuropas. Hier ist vor allem die kulturelle Exklusion entscheidend für die Bewertung gesellschaftlicher Folgen. Während das Gefühl der kulturellen Ausgrenzung in den meisten Ländern der Europäischen Union eng mit dem ökonomischen Lebensstandard zusammenhängt, beklagen deutsche und belgische Jugendliche eine allgemeine kulturelle Ausgrenzung und fühlen sich oftmals stigmatisiert oder als Außenseiter behandelt (vgl. Kieselbach; Beelmann 2003). Jugendarbeitslosigkeit stellt also einen wichtigen Faktor für den Zerfall von sozialem Zusammenhalt dar. Dieser Zusammenhalt ist von existenzieller Bedeutung für den auch in Zukunft friedlichen Fortbestand der Europäischen Union.
5.4 Wirtschaftliche Folgen
6 Probleme der EU beim Umgang mit Jugendarbeitslosigkeit
Die Europäische Union hat das Thema Jugendarbeitslosigkeit früh auf ihre Agenda gesetzt. Schon seit Anfang der 1990er Jahre gibt es zahllose Projekte, die Jugendlichen eine Arbeit verschaffen sollen. Das ist jedoch alles andere als einfach. Barbara Tham kritisiert, dass es keine breit angelegte Kampagne gibt, die in der Lage ist, möglichst viele Menschen zu erreichen (Tham 1999:196). Für sie steht die Klärung noch aus, welchen Themenfeldern sich die Europäische Union im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit widmen sollte. Die EU besteht aus vielen einzelnen Staaten, die alle möglichst wenig ihrer Souveränität an die EU abgeben wollen. Von Seiten der Mitgliedsstaaten wird deshalb oft kritisiert, dass die EU ihre Kompetenzen überschreite. Hier verlangt es nach einer klaren Festlegung der Aufgabenbereiche von regionalpolitischen, länderpolitischen und europapolitischen Aufgabenbereichen, um eine zielgerichtete Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit zu garantieren (vgl. ebd:196f). Für Tham agiert die Europäische Union zu sehr auf wirtschaftlicher Ebene. Die Jugendlichen müssen ernst genommen werden und auf ihre Erwartungen und Forderungen muss besser eingegangen werden (vgl. ebd: 199). „Die gesellschaftlichen Kosten von Jugendarbeitslosigkeit müssen stärkere Berücksichtigung in den Konzepten der EU finden, um damit den Erwartungen und Anforderungen ihrer Bevölkerung zu entsprechen“ (ebd: 203). Das zeigt sich sehr deutlich an einem Beispiel aus der Anfangszeit der Europäischen Union. Im Jahr 1993 wurde der europäische Binnenmarkt vollendet. Damit wurde unter anderem das Ziel verfolgt, die Grenzen des Arbeitsmarktes weitestgehend aufzuheben. Gerade für junge Arbeitssuchende sollte das eine deutliche Verbesserung darstellen. Durch die Aufhebung der Grenzen, so der Gedanke, sollte es für einen Jugendlichen möglich sein, beispielsweise in Deutschland seine Schulausbildung zu absolvieren, danach sein Studium in Frankreich zu beenden und dann in Italien einen Job zu finden (List 1998). Dieses Konzept stellte sich jedoch schnell als Utopie heraus. Nur ein verschwindend geringer Teil der EU-Bürger arbeitete 1997 in einem anderen EU-Mitgliedsstaat (vgl. Tham 1999:22ff).
Der Glaube, den arbeitslosen Jugendlichen nur die Möglichkeit geben zu müssen, Arbeitsplätze in anderen Ländern anzunehmen, stellte sich als falsch heraus. Die Sorgen und Ängste der Jugendlichen müssen wahrgenommen und in kreative politische Maßnahmen umgesetzt werden.
Hinzu kommt, dass die Europäische Union auf viele Gründe für die Jugendarbeitslosigkeit keinen direkten Einfluss hat. In Frankreich beispielsweise liegt das Hauptproblem der enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit in der Bildungspolitik des Landes begründet. Schülerinnen und Schüler sind praktisch gezwungen, ein Abitur zu machen und danach zu studieren. Dieses Schulsystem ist so sehr in den Köpfen der Franzosen verankert, dass es für französische Schüler unangenehm ist, einen Ausbildungsberuf zu ergreifen. Diese Entscheidung wird oft mit dem Versagen in der Schule gleichgesetzt (Tagesschau 2013).
7 Die Bedeutung der Jugend für die EU
Die präsentierten Zahlen sind beängstigend. Die rapide gestiegenen Jugendarbeitslosenquoten zeigen deutlich, dass die Arbeitslosigkeit von unter 25-jährigen eines der wichtigsten Themen der EU darstellt. Junge Menschen, die die Zukunft Europas maßgeblich prägen sollen, sind auf dem Weg dazu, eine „verlorene Generation“ zu werden. Wie in dieser Arbeit gezeigt, sind gerade Jugendliche von der Währungskrise im Euroraum betroffen. Vor allem südeuropäische Heranwachsende sind momentan mit Jugendarbeitslosenquoten konfrontiert, die ihnen alles andere als eine positive Sicht auf ihre berufliche Zukunft voraussagen. Jugendliche sind nicht so fest verankert in der Gesellschaft, wie Erwachsene. Sie haben nicht die finanzielle Sicherheit, um eine längere Arbeitslosigkeit zu überstehen.
Literaturverzeichnis
Beck, Ulrich (1996):Kapitalismus ohne Arbeit; In: Der Spiegel 20/1996.