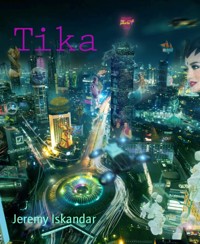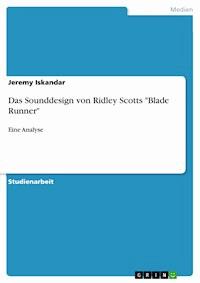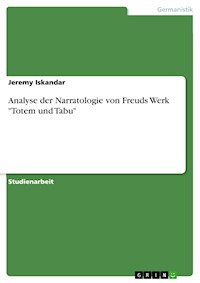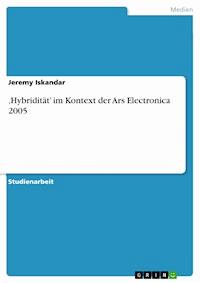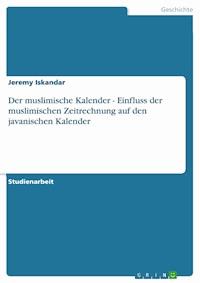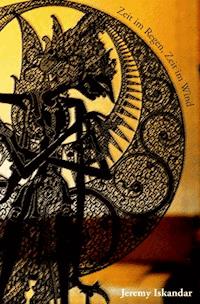
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sophia ist eine junge Frau, Absolventin der Kulturwissenschaften, wissbegierig und klug, wenn auch eher eine Einzelgängerin. Sie könnte ein unbeschwertes Leben führen, wären da nicht diese seltsamen und exotischen Träume, die mit immer größerer Macht in ihr Leben dringen. Als sie kurz vor ihrem Abschluss das Tagebuch ihrer Großmutter vererbt bekommt, bricht sie alle Brücken zu ihrem bisherigen Leben ab und stürzt sich in ein Abenteuer, das schon bald viel größere Dimensionen annimmt, als sie es jemals für möglich gehalten hätte. Wer war diese Frau, deren niedergeschriebenen Erinnerungen sie nun in das ferne Südostasien folgt? Deren Worte und Beschreibungen ihr vorkommen, als stammen sie aus einer fernen Welt und die doch so vertraut auf sie wirken. Und beinhaltet das Tagebuch tatsächlich die Antworten auf ihre Fragen? Bald schon erkennt Sophia, dass es bei dieser Reise nicht nur um sie selbst geht, sondern auch um fremde Kulturen und Vorstellungen, die Schrecken des Krieges, die Suche nach dem Selbst in der Zeit und vielleicht sogar um so etwas wie die ewige Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeremy Iskandar
Zeit im Regen, Zeit im Wind
Jeremy Iskandar
Impressum
Texte: ©Copyright by Jeremy Iskandar Umschlag:© Copyright bySascha Jerusalem
Verlag:Jeremy Iskandar
c/o Autorenservices.de
König-Konrad-Str. 22
36039 Fulda
1
Das Meer glich von der Rooftop-Bar aus gesehen einem schwarzen Spiegel, auf den ein Künstler verschwommene Farbkleckse gezaubert hatte. Zur anderen Seite hin erhoben sich die Wolkenkratzer, stierten kühl und erhaben zum nächtlichen Himmel hinauf. Es war ein atemberaubender Anblick, doch Sophia bekam davon kaum etwas mit. Ihr Blick glitt in die Leere, verhaftete irgendwo in dem dicken Knäuel an unverstandenen Gedanken, das sich in ihrem Kopf angesammelt hatte. Sie hatte von Schlangen geträumt, mehr als einmal. Und von seltsamen Symbolen, die man ihr auf die Zunge geritzt hatte. An diesem Punkt wachte sie stets auf, aber der Traum wiederholte sich, ließ sie nicht mehr in Ruhe. Und das war nur eine von mehreren Begebenheiten, die sich in der letzten Zeit in ihrem Leben zugetragen hatten.
„Brauchen Sie Feuer?“, hörte die junge Frau plötzlich eine Stimme neben sich. Männlich, Englisch, aber mit einem deutlichen Akzent gefärbt. Sophia wandte träge ihre Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt zurück. Neben ihr an der Bar, an der sie sich ein ruhiges Plätzchen ausgesucht hatte, stand ein stattlicher Asiate, den sie wegen der Verbeugung ihr gegenüber für einen Japaner hielt. In seiner halb ausgetreckten Hand befand sich bereits ein Feuerzeug. Dann erst fiel Sophia die Zigarette ein, die sie sich vor einer Weile zwischen die Lippen gesteckt und dann, ihren wirren Gedanken nachhängend, vergessen hatte. Sie neigte leicht den Kopf, nickte. Wortlos, sein Gesichtsausdruck für sie nicht zu deuten, gab der Mann ihr Feuer.
Sie war alleine hier, und auch der Japaner schien ohne Begleitung. Als sie an ihm vorbeiblickte, konnte sie niemanden erkennen, der zu ihm zu gehören schien.
„Darf ich fragen, was Sie lesen?“
Sophia hatte das Buch noch vor sich auf dem Holztresen der kleinen Bar aufgeschlagen. Sie hatte lesen wollen, aber dann waren ihr beim Hinausblicken auf die Skyline Singapurs wieder die Träume eingefallen, die sie in letzter Zeit einfach nicht losließen.
Innerlich musste sie seufzen. Heute würde sie weder mit dem einen noch dem anderen weiterkommen, also konnte sie wohl auch auf die Frage des Fremden eingehen. Sie überlegte, sich ihm erst einmal vorzustellen, aber da auch der Mann noch keine Anstalten gemacht hatte, seinen Namen zu nennen, behielt sie ihren gleichfalls für sich.
„Das wird Sie sicherlich zu Tode langweilen“, gab sie zurück, noch nicht ganz sicher, ob sie überhaupt an einem längeren Gespräch interessiert war. Vielleicht sollte ich einfach aufs Zimmer gehen und schlafen. Morgen sieht bestimmt wieder alles ganz anders aus. Aber bei dem Gedanken an das Hotelbett, so gemütlich es auch war, musste sie direkt wieder daran denken, ob die Träume in dieser Nacht zu ihr zurückkommen würden oder nicht.
„Ich lasse es auf einen Versuch ankommen“, war seine Antwort.
„Also gut… es ist ein Buch über Kulturtheorie, genauer gesagt über etwas, das man das ‚kulturelle Gedächtnis‘ nennt. Es war mein Schwerpunkt an der Uni“, erklärte Sophia und hatte tatsächlich das Gefühl, dass der Japaner ernsthaft darüber nachdachte, auch wenn sie sich nach wie vor außer Stande sah, die Maske des Mannes zu durchdringen und damit aus seiner Reaktion zu deuten, was er davon hielt.
„Was genau ist dieses kulturelle Gedächtnis denn?“, fragte er weiter. Er hatte sich noch immer nicht vorgestellt. Auch gesetzt hatte er sich nicht. Ein wenig starr stand er in gebührendem Abstand neben ihrem Barhocker am Tresen, blickte ihr dabei nicht direkt in die Augen, aber zumindest soweit in ihre Richtung, dass eine gewisse Nähe entstand. Nicht, dass das irgendwie von Bedeutung gewesen wäre, denn Sophia war bereits längst in ihre Gedankenwelt abgetaucht. Über manche Dinge, und die Erinnerungskultur gehörte ganz sicher dazu, konnte sie sich stundenlang auslassen, während sie alles um sich herum vergaß. Sie liebte nichts mehr, als darüber nachzudenken und sich mit anderen darüber auszutauschen. Mehr als einmal hatte man ihr vorgeworfen, sie würde in der Vergangenheit leben und nicht im Hier und Jetzt, aber für sie war das belanglos. Die Gegenwart war nur ein Konstrukt, das sich aus den fragmentierten Erinnerungen zusammensetzte, die sich in ihrem Kopf befanden.
Sophia nahm einen Schluck von ihrem Cocktail und formte in ihrem Kopf die Gedanken, welche bald darauf zu Worten wurden, ihr Inneres verließen und damit eine Realität konstruierten, die nicht nur sie, sondern auch ihren Gegenüber miteinschloss.
„Jeder Mensch verfügt mit seinem Gehirn über einen biologischen Gedächtnisspeicher. Darin werden unsere Erinnerungen abgespeichert, die maßgeblich zu unserer Identitätsbildung beitragen, uns zu dem machen, was wir sind. Sie sind allerdings nicht statisch, vielmehr bewegen sie sich wie die Wogen des Meeres, türmen sich zu Wellen auf, die uns hin und wieder mit aller Macht treffen, dann aber auch wieder absolut ruhig und unbemerkt von uns sein können.
Das kulturelle Gedächtnis ist ebenfalls ein Gedächtnisspeicher für Erinnerungen, aber viel größer. Es ist der Speicher einer ganzen Gesellschaft. Durch Dinge, wie Wiederholung, Tradition, Symbolsysteme, entsteht dort eine Form kultureller Identität. Es manifestiert sich in Texten, Bildern, Dingen. Es überdauert die Lebensspanne eines Menschen. Aber es ist genauso wenig statisch wie unser biologisches Gedächtnis. Auch, wenn es viel formaler ist, viel geformter. Texte, Bilder, Dinge, sie mögen sich zwar nicht ändern, wenn die Zeit vergeht, aber sie werden von jeder neuen Generation neu bewertet, anders interpretiert. In diesem Sinne wogt das Meer der Erinnerung auch im kulturellen Gedächtnis mal mehr und mal weniger.“
Sophia ließ ihre braune Haarlocke von ihrem Zeigefinger gleiten. Immer, wenn sie über solche Dinge sprach, trat die Angewohnheit auf, dass sie anfing, mit ihrem Haar zu spielen. Sie mochte das eigentlich nicht. Es wirkte zu verspielt in ihren Augen. Dabei drückte es nur die kindliche Freude über eine Sache aus, die sie für bedeutsam und ernst, und damit alles andere als verspielt, hielt. Es gab für sie kein bedeutenderes Thema als das der Erinnerung und wie sie den Menschen bestimmte und formte.
Ihr Gesprächspartner nickte, aber ob diese Geste nun Zustimmung oder reine Empfangsbestätigung war, ließ sich für Sophia nicht erkennen.
„Ich habe manchmal das Gefühl“, begann er, „dass das kulturelle Gedächtnis meiner Heimat gewisse Lücken aufweist. Oder, um es anders zu sagen, sind meine Leute wohl Meister der Verdrängung.“
Sophia schnippte mit dem Zeigefinger, obwohl sie es sogleich bereute. Auch diese Angewohnheit hatte sich bisher hartnäckig einer Abschaltung wiedersetzt.
„Genauso ist es… also, ich meine, die Verdrängung ist ein wichtiger Aspekt, wenn man sich mit dem Thema der Erinnerung auseinandersetzt. Das Bild, das sie sich von sich selbst machen, ist ein wesentlicher Teil ihrer Wirklichkeit, um mit den Worten von Lèvi-Strauss zu sprechen.“
Sie lächelte. Seit dem Ende ihres Studiums hatte sie sich nicht mehr so über ein Gespräch gefreut. In den letzten Monaten hatte sie kaum noch mit anderen Menschen gesprochen. Mehr und mehr hatte sie das Gefühl gehabt, überhaupt nicht mehr richtig anwesend zu sein, in ihr Inneres gesogen zu werden, eingenommen von den Gedanken, die sich darin befanden. Die Träume waren sicher ein Teil davon, aber das war noch nicht alles. Da gab es noch etwas anderes. Sie war sich selbst ein wenig fremd geworden. Wenn sie morgens in den Spiegel schaute, dann hatte sie mitunter das Gefühl, es sei nicht sie, die dort in den Spiegel blicke, sondern jemand, der sich außerhalb ihrer selbst befand und dennoch mit ihr verbunden war.
Sophia hatte schon während ihres Studiums der Kulturwissenschaften in London Phasen durchlebt, die dem gleichkamen, war aber immer zu sehr von ihren Studien eingenommen gewesen, um sich näher damit zu befassen. Dann, mit dem Abschluss in der Tasche, hatte sie sich plötzlich wie ein Stück Treibgut gefühlt, das ins Meer ihrer Erinnerungen hinausgeworfen worden war. Sie trieb einfach dahin, unfähig, ihren Kurs zu bestimmen. Sie musste weg, weit weg. Nur das hatte sie gewusst. Mit dem Tod ihrer Mutter war ihr das Tagebuch ihrer Großmutter vererbt worden. Es war das Einzige, das ihre Mutter ihr vermacht hatte. Ihre Beziehung war nie besonders gut gewesen. Spätestens seit ihrer Jugend war Sophia davon überzeugt gewesen, dass ihre Mutter sie hasste, dass ihre bloße Existenz in ihrer Mutter Leid verursachte. Doch weshalb, das hatte sie niemals erfahren. Niemals hatte sie begriffen, wie das möglich war, warum ihre eigene Mutter Distanz zu ihr wahrte, eine Aura der Kühle und Unnahbarkeit gegenüber ihrer eigenen Tochter errichtet hatte. Im Studium hatte sie dann schließlich kaum noch Kontakt zu ihrer Mutter gehabt, hatte alleine gelebt und sich, wo immer es möglich war, von ihr ferngehalten. Als sie plötzlich im letzten Jahr verstorben war, gerade zu jener Zeit, als Sophia ihrem Abschluss nahegewesen war, war auch die geringe Hoffnung, dass es jemals zu einem klärenden Gespräch zwischen Mutter und Tochter kommen könnte, dahingeschieden. Zur Beerdigung ihrer Mutter war sie nicht gegangen.
Und nun saß sie hier. Alleine, und in einem fremden Land, das Tagebuch ihrer Großmutter in ihrem Gepäck.
„Glauben Sie an die absolute Erinnerung?“, fragte er sie plötzlich, nachdem sie eine Zeitlang ihren eigenen Gedanken hinterhergehangen hatte.
Mittlerweile hatte er auch ein Glas vor sich stehen. Im dämmrigen Licht der Bar schimmerte der eingeschenkte Whisky wie flüssiges Gold. Sophia drückte ihre Zigarette aus und nippte an ihrem Cocktail.
„Die absolute Erinnerung?“ Sie schüttelte den Kopf.
„Nein, daran glaube ich nicht. Selbst, wenn es sie gäbe, wie sollten wir jemals Zugang zu ihr erlangen? Alles, was wir erleben, erreicht uns nur durch unsere Sinne. Wir können die Welt gar nicht anders wahrnehmen, als durch unsere eigens für uns gefärbte Brille.“
„Aber die Erinnerungen sind in uns selbst. Sie kommen nicht von außen“, warf der Mann ein. Er besaß tatsächlich einen scharfen Verstand, musste Sophia zugestehen, was das Gespräch für sie umso interessanter machte.
„Da ist was dran“, pflichtete sie ihm bei.
„Aber wir interpretieren unsere Erinnerungen immer wieder neu. Wie erinnern niemals absolut ein und dasselbe.“
Der Mann hob sein Whiskyglas, trank daraus. Er trank in kleinen, gemäßigten Schlucken.
„Und wie sieht es mit einem eidetischen Gedächtnis aus?“, fragte er weiter.
„Das ist umstritten, aber meiner Ansicht nach ist das auch nicht der Punkt. Die Möglichkeit, sich etwas exakt so zu merken, wie es ist, obwohl ich auch darin schon eine Art von Widerspruch sehe, schaltet nicht den Fakt aus, dass wir selbst uns verändern. Wir verändern uns durch die Erfahrungen, die wir machen. Sobald Zeit vergeht, findet auch eine Neubewertung unserer Erinnerungen statt.“
Sie nahm einen weiteren Schluck ihres Cocktails, behielt ihre Finger an der kühlen Oberfläche des Glases, um nicht wieder in Versuchung zu kommen, mit einer ihrer Haarsträhnen herumzuspielen.
„Und deshalb meine ich, dass die Frage nicht lauten muss, ob es so etwas wie eine absolute Erinnerung gibt, sondern, ob wir überhaupt jemals Zugang zu ihr erlangen könnten. Wir befinden uns hier vor demselben Dilemma, ob es uns möglich ist, die objektive Wirklichkeit, sofern sie denn existiert, wahrzunehmen. Die Dinge also so zu erkennen, wie sie wahrhaftig sind. Wie aber, wenn alles durch den Filter unserer Sinne verläuft?“
„Und die Zeit?“, fragte er.
„Die Zeit?“
„Wenn man den Faktor Zeit ausschalten würde? Zumindest die lineare Vorstellung von Zeit, die in unserer Zeit vorherrscht.“
Sophia legte ihr Kinn in die aufgestützte, offene Handfläche. Ein interessanter Gedankengang.
Sie lächelte verschmitzt, fast kindlich. „Ja… Ja, warum nicht? Das könnte vielleicht funktionieren“, gab sie nach einem kurzen Moment des Nachdenkens zurück.
Sie griff nach der Schachtel Zigaretten, die sie neben ihr Buch gelegt hatte.
„Brauchen Sie wieder Feuer?“
„Diesmal habe ich selbst eins zur Hand“, lächelte sie, hielt das Feuerzeug hoch.
„Es sei denn, Sie haben dieses Gentleman-Gen und sind unfähig, es abzustellen“, scherzte sie, aber der Japaner ging nicht darauf ein.
Ein wenig steif, der Gute, dachte sie, während sie sich ihre Zigarette anzündete. Andererseits wusste sie auch noch immer nicht, worauf das Ganze hier eigentlich hinauslaufen sollte. Für eine interessante, wenn auch etwas langatmige Anmache, hielt sie es mittlerweile nicht mehr. Der Mann machte keine Anstalten, das Gespräch vom Thema der Erinnerung zu etwas Ungezwungenem zu bewegen. Auch seine Körpersprache, die in Sophias Augen einfach nichts auszudrücken schien, oder die Art und Weise, wie er sie anblickte, weder direkt ihren Blickkontakt suchend noch irgendwie verstohlen ihre weiblichen Attribute erforschend, ließen darauf schließen, dass er an mehr interessiert war, als an einem reinen Gedankenaustausch. Warum auch nicht. Sie war ohnehin zu müde dafür, obwohl sie nichts gegen einen spannenden Flirt einzuwenden hatte.
„Sie sind hier auch fremd, oder?“, versuchte sie dann aber doch, das Gespräch etwas mehr auf die Person dieses mysteriösen Fremden zu lenken.
Er hielt das Whiskyglas in seiner Hand, ließ seinen Inhalt kreisen. „Ja, ich bin nur auf der Durchreise.“
„Sind Sie Gast im Hotel oder besuchen Sie nur die Bar?“
„Ich bin Gast hier. Sie auch, nehme ich an.“
Sie nickte. „Ja, aber bald reise ich ab.“
„Ich auch.“
Ok, das führt zu nichts, dachte Sophia und musste innerlich sogar etwas über sich lachen. Plötzlich überkam sie wieder das Gefühl der Müdigkeit, das durch das plötzliche Erscheinen des Fremden für eine Weile von ihr gewichen war. Wie eine schwere Decke glitt es über sie, hüllte sie ein. Sie hatte schon länger nicht mehr friedlich geschlafen. Hin und wieder, und in letzter Zeit immer häufiger, meldete sich deshalb ihr Körper mit erhobenem Zeigefinger zu Wort. Zeit, das hier zu beenden. Sie zog ein letztes Mal an ihrer Zigarette und drückte sie dann aus.
„Wenn Sie mich bitte entschuldigen, aber ich werde jetzt auf mein Zimmer gehen. Ich bin müde. In letzter Zeit schlafe ich nicht so gut.“
Der namenlose Japaner nickte, machte ihr Platz. „Ich hoffe, Sie können in dieser Nacht besser schlafen.“
Ja, das hoffe ich auch, dachte sie, sagte es aber nicht. Sie lächelte nichtssagend, nickte dem Mann noch einmal zu, packte ihre Sachen in ihre Tasche und verließ die Bar.
I
Willem van der Wiesen war ein gutherziger und aufrechter Mann, der über einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügte und den ich niemals in Rage erlebte. Er erhob niemals die Stimme, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er jemals die Fassung verloren hätte, die er stets in meiner und der Gegenwart anderer zu wahren wusste. In dieser Hinsicht kam er dem javanischen Ideal, das mir durch das Leben am Hofe vermittelt worden war, angenehm nahe.
Als ich ihn kennenlernte stand die Regenzeit bereits kurz vor ihrem Einzug. Eine graue Wolkenwand bedeckte den Horizont, türmte sich am Himmelsgewölbe auf und ließ den Regen erahnen, der bald die Erde tränken würde. Es war das Jahr 1938, und das Hereinbrechen des Monsuns hatte mich wie so oft in eine nachdenkliche, melancholische Stimmung versetzt. Gefühle zu zeigen, Emotionen zuzulassen, widerspricht dem javanischen Ideal, doch kann ich nicht leugnen, dass dieser Wesenszug mich wohl auf ewig begleiten wird.
Geboren wurde ich in Yogyakarta, der alten Sultansstadt im Herzen der Insel Java, im Jahre 1916. Als Sohn eines Hofmusikers wuchs ich am Kraton, dem kulturellen und politischen Mittelpunkt der Insel, auf und fügte mich in die jahrhundertealten Strukturen und ihr komplexes Netz aus Traditionen. Doch Java gehörte nicht mehr allein den Einheimischen, sondern war Teil einer gewaltigen Handelsmacht, die sich die Europäer in Südostasien errichtet hatten. Nusantara, der alte, erhabene Archipel, hatte sein Antlitz mit der Ankunft der Europäer für immer verändert. Doch heißt es nicht in der Lehre des großen Kosmos, das alles stets von neuem beginnt, der Kreis sich schließt und damit die Zyklen gebiert, die alles umschließen?
Als ich Willem zum ersten Mal traf, wehte ein kräftiger Wind, welcher der Regenwand vorausging, über die wie Terrassen angelegten Reisplantagen, die sich entlang der Hänge erhoben. Willems Familie, eine gut situierte Kaufmannsfamilie, der mehrere Plantagen in der Nähe des Dorfes Bogor gehörten, bewohnte ein ansehnliches Haus am Ende der Straße, die letztendlich in das Bergland mündete. Dämmerung kroch über die Bergspitzen, legte sich über das Tal wie ein feines Tuch, das alles unter sich begräbt. Die menschenleeren, windgepeitschten Reisfelder erweckten Trauer in mir und stimmten mich nachdenklich. Gleichzeitig erfüllten sie mich aber auch mit Neugier auf die Dinge, die da kommen würden.
Ein Dienstbote führte mich in das Haus, dessen Vorderseite von einer großen Veranda gesäumt wurde. Mein Blick glitt über die Gemälde an den hölzernen Wänden; Grachten und Segelboote, Fahrräder und Menschen, die sich im Licht eines lauen Sommertages badeten. Es waren Motive aus den Niederlanden, Willems Heimat. Als ich eintrat war Willem über einer Partitur vertieft. Er saß an einem Klavier, einem Instrument, das ich nur aus Beschreibungen und von Fotografien her kannte, die man mir gezeigt hatte. Für einen Moment lang herrschte Stille, dann stand er auf und bedeutete mir näherzutreten. Der Blick seiner hellblauen Augen traf in das Dunkel der meinen. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Willems Familie nutzte ihren Wohlstand, um das zu erforschen, was sie die ‚javanische Kultur‘ nannten. Auch in Europa, so hieß es, würde man sich in zunehmendem Maße für die Erlesenheit der javanischen Kunst und ihrer alten Traditionen und Bräuche interessieren, Forschungen betreiben und Aufzeichnungen anfertigen. Aus diesem Grunde war ich von Willems Vater, einem einflussreichen Mann, der im javanischen Adel viele Kontakte pflegte, in das Anwesen bestellt worden, um Willem bei seinen Forschungen zu unterstützen. Willem wollte die javanische Musiktradition kennenlernen und verstehen, in ihre Geheimnisse vorstoßen und ihr Innerstes ergründen.
Obwohl einige priyayi, wie der Adel Javas genannt wurde, der Neugier der Europäer ablehnend gegenüberstanden, wurde der Umstand, dass man sich für die Hofkünste in zunehmendem Maße interessierte, mit Wohlwollen aufgenommen. Als Absolvent eines Zweiges des ‚Het Instituut voor de Javaansch Taal the Soerakarta‘, einem Sprachinstitut, das vornehmlich dem Zweck diente, niederländische Beamte in der javanischen Sprache auszubilden, erschien ich dem Adel als geeignet, dem Willen der einflussreichen Kaufmannsfamilie nachzukommen. Ich sprach ein fließendes Niederländisch, außerdem Deutsch und Englisch, und hatte durch den Kontakt zu meinen europäischen Lehrern die Denkweise und Kultur der Niederlande kennengelernt. Aber am ausschlaggebendsten war vielleicht mein Interesse für die wissenschaftliche Tradition Europas, die analytische Vorgehensweise, mit der die Fremden, die in unser Land gekommen waren, die Welt zu erklären versuchten. Dieses Denken war gegenüber dem der Javaner absolut andersartig, faszinierte mich aber im selben Maße wie die europäischen Einwanderer selbst.
Als Willem mich anblickte, erweckten seine ebenmäßigen Züge und die spitzzulaufende Nase Erinnerungen in mir. Im wayang kulit, dem traditionellen Schattenspiel, das seit Jahrhunderten mit flachen, ledernen Puppen vom dalang, dem Puppenspieler, geführt wurde, besaßen all jene Figuren ebenmäßige, glatte Gesichtszüge und spitze Nasen, deren Wesen von edler und reiner Gesinnung erfüllt war. In Willems Augen blitzte die Neugier auf, und für einen Moment spürte ich die Unsicherheit in mir keimen, die Angst davor, die Fragen dieses wissbegierigen Mannes nicht beantworten zu können und dadurch mein Gesicht zu verlieren. Doch im nächsten Moment empfing mich dieses warme Lächeln, das Verständnis und Güte offenbarte. Es war eine Frage, mit der Willem mich begrüßte.
„Die große Erhabenheit der abendländischen Kunstmusik ist es, dass sie notiert ist. Werk und Aufführung existieren dadurch in zwei voneinander getrennten Sphären. Das Werk ist die Notation, ist durch sie bewahrt und damit in gewissem Sinne ewig. Warum habe ich nie Notationen des Gamelan gesehen, die aus der Zeit vor der Ankunft europäischer Forscher datieren?“
Kaum waren Willems Worte verklungen, deutete er mit einer Handbewegung auf den Sessel ihm gegenüber. Schweigend blickte ich den Sessel an und setzte mich, strich mit meinen Fingern über den glatten Stoff meines Sarong, der mit roten und goldenen Batik-Mustern versehen war. Da Willem nicht den Eindruck machte, er verlange eine sofortige Antwort, ließ ich mir etwas Zeit, über den seltsamen Gesprächseinstieg, den mein Gegenüber gewählt hatte, nachzudenken. Meine Herkunft als Hofmusiker am Kraton hatte mir einen tiefen Einblick in die Tradition des Gamelan verschafft. Aber mehr noch, hatte ich durch die wissenschaftliche Denkweise, die meine Lehrer mir nähergebracht hatten, einen neuartigen Blickwinkel auf das Gamelan, Javas erhabene Musiktradition, erlangt. Doch auch mir stellten sich Fragen, mehr noch, je länger ich darüber nachdachte, weshalb meine Vorfahren eben diese Art der Musik hervorgebracht hatten und keine andere. War unsere Kultur nur dazu fähig, eine Musik hervorzubringen, die ihrer angemessen war? Während meine Gedanken wanderten, dachte ich an die vielen Gongspiele und Klangschalen, die es in einem Gamelan gab, an die ritualisierten Bewegungen der Hofmusiker, die niemals für sich selbst, sondern für die strikt festgelegten Anlässe am Kraton ihre Instrumente bespielten und damit das alte Java lebendig machten.
Ich senkte leicht den Kopf und blickte Willem nicht direkt an, als ich ihm antwortete. Anders als das aufgebrachte Feuer der Neugier, das in Willems Stimme mitschwang, blieb die meine wie immer ruhig und gezügelt.
„Jedes Gamelan-Stück dient einem festgelegten Zweck. Es existiert in diesem Sinne nur während seiner Aufführung.“
Willem lächelte. Die Kürze meiner Antwort stimmte ihn nicht missmutig, sondern schien seine Freude an der heranwachsenden Diskussion entfacht zu haben.
„Wie bleiben die Stücke im Repertoire der Hofmusiker?“
„Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Mein Vater, selbst Hofmusiker, hat mich bereits als Kind in das Gamelan eingewiesen. Ich habe seine Essenz verinnerlicht.“
Willem lehnte sich zurück. Ein Diener kam herein und servierte Tee auf einem Tablett. Ich dankte nickend und nahm mir eine der kunstvollen Porzellantassen, nach dem mich Willem mit einem Wink dazu aufgefordert hatte. Willem nahm die andere Tasse, rührte den Tee aber nicht an, ganz in unsere Diskussion vertieft.
„Ich hatte die Möglichkeit, den Festkalender des Kraton von Soerakarta zu sehen. Was du sagst, ergibt Sinn. Das Gamelan scheint mir enorm fest in den höfischen Aufführungsrahmen eingebettet zu sein“, führte Willem weiter aus und wechselte mit seiner Anrede auf eine persönliche Ebene. Obwohl ich mir der Einfachheit der niederländischen Sprache in dieser Hinsicht bewusst war, war ich froh, dass Willem den ersten Schritt gemacht hatte. Das Javanische verfügte, anders als die europäischen Sprachen, die ich bisher kennengelernt hatte, über zahllose Höflichkeitsebenen, die ein Gespür für die gesellschaftliche und soziale Stellung des Gesprächspartners erforderlich machten. Besonders in Bezug auf Ausländer war es nicht immer ganz einfach, die richtige Anrede und Höflichkeitsebene zu finden. Ich war deshalb innerlich froh darüber, dass wir uns nicht des Javanischen bedienten und dass Willem allem Anschein nach keinen besonderen Wert auf die sprachliche Etikette legte.
„Das Gamelan wird niemals um seiner selbst willen gespielt. Es erfüllt den Zweck, die höfischen Traditionen zu erhalten und das Weltbild des Kraton zu stützen.“
Willem schien diese Aussage zu faszinieren. Seine Hand glitt über seinen gestutzten Bart, während er – in Gedanken versunken – nach seiner Teetasse griff, zu trinken ansetzte, sie dann aber wieder auf das Tablett stellte, als ihm ein neuer Gedanke gekommen war. Die Emotionalität, die Begeisterung, die Willem und andere Europäer in ihre Gespräche einfließen ließen, erstaunte mich ein jedes Mal von neuem.
„Demnach ist es eine logische Schlussfolgerung, dass sich im Gamelan keine Solomusiker herausgebildet haben, keine bevorzugten Instrumente“, eröffnete Willem einen neuen Diskussionsstrang, den ich, noch immer ruhig und entspannt dasitzend, annahm und weiterflocht. Ich konnte nicht leugnen, dass Willem das Gamelan bereits ausführlich betrachtet hatte, und tief in meinem Inneren erwuchs in mir die Hoffnung, Willem könnte gleichfalls mir helfen, meine eigenen Fragen zu beantworten, die allgegenwärtige Form zu ergründen, deren Umrisse ich gerade erst zu erahnen begonnen hatte.
„Du hast Recht. Jeder einzelne Musiker trägt seinen Teil zur Gesamtheit hinzu. Das Gamelan verfügt zwar über eine Hierarchie, doch würde das Versagen selbst des einfachsten Teiles dazu führen, dass die Funktion des Gamelan scheitern würde. Jeder Musiker besitzt deshalb eine große Verantwortung für sein Handeln, nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auf die Gruppe im Ganzen. Genauso, wie es der Javaner für seine Familie tut. Eine zu rasche Bewegung, eine Störung des Gefüges, führt zum Verlust der Harmonie, zum Gesichtsverlust. Harmonie ist nichts, das man erst erreichen muss, sie ist bereits allgegenwärtig, muss aber erhalten werden.“
Willem lächelte breit, nahm seine Tasse und begann zu trinken.
Die Regenzeit begleitete unsere Gespräche. Um meine Anreisezeit zu verkürzen, hatte Willems Familie mir ein Zimmer in Bogor zur Verfügung gestellt. Das Haus gehörte der Handelsgesellschaft und verfügte über mehrere Gästezimmer für neu angereiste Angestellte und deren Familien aus Europa. Hier traf ich zum ersten Mal auf eine größere Gruppe Europäer, zukünftige Gutsverwalter, Plantagenaufseher, die mit ihren Familien vor kurzem auf Java angekommen waren, um hier ihre Dienstzeit von einigen Jahren zu absolvieren.
Die Geräusche spielender und lachender Kinder wärmten mir das Herz, während mein Blick durch das Fenster auf die Regenschleier fiel. Sturzbäche ergossen sich aus den Wolken und rissen, sobald sie auf der Erde angekommen waren, all jenes mit sich, das ihnen nicht widerstehen konnte. Doch nicht nur materielles Gut, so schien es mir, wurde davon hinfort gespült, auch meine Gedanken sanken auf diesem Strom dahin und trieben fort, unerreichbar für mich. Flüchtig ist das, was wir in unseren Händen halten.
Regelmäßig sorgte Willems Diener, Pak Raman, für meine sichere Reise zum Familienanwesen. Pak Raman war bereits ein älterer Mann, doch seine Erscheinung zeugte immer noch von Stärke und Ausdauer. Es war das erste Mal, dass ich längere Gespräche mit einem Diener führte. Für Raman war es ein Glück, im Haushalt der Wiesen dienen zu dürfen, denn dort wiederfuhr ihm eine gute Behandlung. Anders als in seinem Leben zuvor, musste er sich nicht mehr darum sorgen, ob er auch am kommenden Tag genug zu essen haben würde.
Raman stammte aus Bandung. Die Stadt der Blumen, wie sie genannt wurde, lag ungefähr 100 Kilometer von Bogor entfernt, weiter im Westen der Insel. Die Europäer hatten Bandung zum Zentrum ihrer Plantagenwirtschaft ausgebaut, und wegen ihrer Art-Déco-Architektur, den bunten Flaniermeilen und dem stark europäisch geprägten Ambiente wurde sie auch ‚Paris des Ostens‘ geheißen. Von Paris hatte ich bisher nur Bilder gesehen, die ein betagter Lehrer der Sprachschule mir in seinem Fotoalbum gezeigt hatte. Natürlich hatte Raman, wie die meisten seiner Landsleute, nicht vom glitzernden Prunk Bandungs profitiert, sondern fristete sein Dasein, gemeinsam mit seiner Familie, in einem der Dörfer, die nun von den Plantagen umschlossen waren. Das Leben auf den Feldern war hart. Die schwüle Hitze drückte auf die Lungen, die Sonne brannte tagtäglich stundenlang auf die halbnackten Körper der Plantagenarbeiter, deren Knochen durch das ständige Bücken und die krumme Haltung schnell verschlissen.
„Mein Bein ist nicht mehr gut. Ich spüre es, vor allem in der Regenzeit. Immer, wenn es regnet, kommt das Pochen zurück, und eine Taubheit breitet sich in meinem Bein aus, tuan. Der dukun aus meinem kampung hat mir eine Salbe gegeben, tuan. Es hilft gegen die Taubheit, aber auf den Plantagen arbeiten kann ich nicht mehr. Ich wollte meiner Familie nicht zur Last fallen, sie kann sich selbst kaum ernähren. Ständig fehlt es an etwas. Deshalb bin ich an die Küste gekommen. In Batavia, dachte ich mir, werde ich schon irgendetwas finden. Zum Glück kann ich Autofahren. Ich habe es damals gelernt, als die Straßen gerade neu ausgebaut wurden. Sie suchten Fahrer für ihre Lastkraftwagen und Transporter und bildeten einige Männer aus den umliegenden Dörfern darin aus. Ich war unter ihnen und lernte es schnell. Als ich das erste Mal einen der großen Wagen sah, fing mein Herz an zu pochen. Niemals zuvor hatte ich einen motorisierten Wagen gesehen. Er schien mir wie ein Ungetüm. Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie ein toter Gegenstand, ein kleiner Motor, einen so großen Wagen ziehen kann. Tuan van der Wiesen hat mich eingestellt, weil ich fahren konnte. So wurde ich Hausdiener und Fahrer. Ich versuche, immer etwas von meinem Lohn zu sparen und schicke ihn dann mit der Post nach Bandung, wo meine Familie ihn abholen kann. So trage ich meinen Teil dazu bei, tuan“, erzählte mir Raman bei unserer ersten Fahrt.