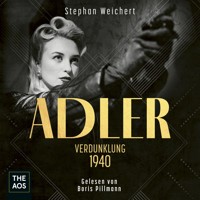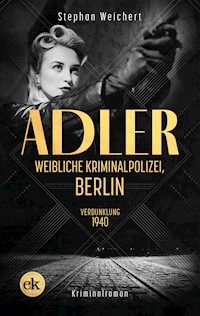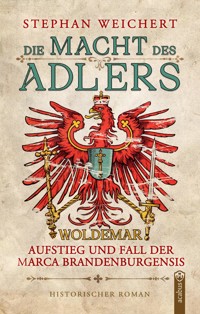Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Serie: Adler, Weibliche Kriminalpolizei
- Sprache: Deutsch
Berlin 1947 - Der Krieg ist ausgekämpft, die Männer sind gefallen oder kehren aus der Gefangenschaft zurück. Es sind die Frauen, die sich den neuen Herausforderungen stellen. In der Nähe des Schwarzmarktes, in der Ruine des Anhalter Bahnhofs, wird eine erdrosselte und mit Säure übergossene Trümmerfrau entdeckt. Ihr Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt und wichtige Dokumente fehlen. Als wenig später eine weitere Frau tot aufgefunden wird, spricht alles für eine Mordserie. Die Weibliche Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel. Mit wechselnden Identitäten nutzt der Täter geschickt die unübersichtliche Lage im geteilten Berlin. Luise Adler stößt während ihrer Ermittlungen auf enorme Widerstände bei den alliierten Siegern. Dabei ahnt sie nicht, dass die dunklen Schatten der Vergangenheit sie verfolgen und ihr Todesurteil längst besiegelt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Weichert
ADLER
Weibliche Kriminalpolizei, Berlin
Zerstörung 1947
Kriminalroman
Triggerwarnung:
Vergewaltigung, Körperliche Gewalt,
Säureverätzung, Kindesmisshandlung
Verhehle, wer ich bin.
Und steh mir bei, mich zu verkleiden,
wie es taugt zu meinem Plan.
William Shakespeare
(Rosalinde in Was ihr wollt)
Prolog
»Nicht der deutsche Soldat, die deutsche Frau hat versagt. Wir hoffen, dass sie recht viel Spaß mit den Besatzern hat und ihnen zum Opfer fällt. Es dauerte sechs Jahre, um Deutschland zu besiegen, aber nur fünf Minuten, um eine deutsche Frau rumzukriegen.«
Ullrich Kranz,
Verband der Deutschen Kriegsheimkehrer
Zwei Jahre zuvor. Sonntag, 6. Mai 1945
Durch das Haus zog der Duft von frisch gebrühtem Kaffee, der gewöhnlichen Leuten schon zu Beginn des Krieges vergönnt war. Im Elternhaus der siebzehnjährigen Vera Dornberg war nichts gewöhnlich und der Krieg war nach sechs dunklen Jahren vorbei.
Ein besonderer Morgen im Mai 1945 – Erlösung und Vernichtung zur gleichen Zeit. Eine Welt aus Schutt, Asche und mit mehr als 50 Millionen Opfern. Adolf Hitler war zu dieser Zeit bereits tot. Mit zitternder Hand war es ihm im Führerbunker gelungen, erst seine Gemahlin Eva, dann seinen Hund Blondi und schließlich sich selbst hinzurichten. Und während Berlin nach dem letzten verheerenden Bombenhagel ein lodernder Trümmerhaufen war, schien hier, vor den Toren der Stadt, in der Villenkolonie von Neu-Babelsberg, alles beim Alten zu sein. Die Morgensonne erhellte das Speisezimmer, auf dem weißen Tischtuch standen der volle Brotkorb, die gekochten Eier, goldgelbe Butter sowie Marmeladen aus verschiedenen Früchten. Dazu drei silberne Kannen: Tee, Kaffee und heiße Milch. Brigitte Dornberg, die Dame des Hauses, trug ein wallendes Morgengewand aus geschmeidiger Seide und nippte an ihrer Tasse aus edlem Meissener Porzellan. Ihr Gatte, Karl-Otto, hielt sich eine Zeitung vor die Nase und Vera, die fast erwachsene Tochter, blickte durch das riesige Panoramafenster auf die gepflegte Gartenanlage, die, umringt von frühlingshaft blühenden Sträuchern, weiträumig bis zum Griebnitzsee ragte. Ihre Eltern gehörten bis dato zu den Privilegierten im Deutschen Reich. Berühmte Künstler, Diven, aber auch Nazigrößen gaben sich bei ihnen die Klinke in die Hand und es wurden rauschende Feste mit ihnen gefeiert. Ihre Mutter war eine renommierte Kostümgestalterin der UFA. Ihr Name stand in jedem Abspann und nicht nur der Propagandaminister, auch die Leinwandlieblinge lobten damals die schöpferischen Werke der Brigitte Dornberg. Bei ihr waren sie in guten Händen; sie verwandelte graue Mäuse in leuchtende Sterne.
Plötzlich brüllte ein laut zitterndes Motorengedröhne in die sonntägliche Stille. Ein russisches Militärfahrzeug preschte auf die Vorfahrt, um mit quietschenden Reifen direkt vor dem Hauseingang zu parken. Hinter dem Steuer saß ein Uniformierter, daneben ein Ranghöherer – es waren Rotarmisten.
»Versteckt euch! Ich regle das schon!«, sprach die Dornberg aufgeschreckt und alles musste nun schnell gehen. Während ihr Mann sich ein Versteck im Keller suchte, scheuchte sie ihre Tochter in die Küche. Sie selbst blieb hinter der Gardine stehen und sah die Männer draußen ihre Uniformen zurechtrücken. Wie durch ein zusammengerolltes Papierröllchen verengte sie ihren Blick und sah sie die hohe Steintreppe hochkommen. Das Knirschen der sandigen Stiefelsohlen wurde lauter, und sie wusste längst, dass diese Iwans nur gekommen waren, um ihren Gatten festzunehmen. Vielleicht würden sie ihn gleich erschießen, er war kein unbedeutendes Blatt im Deutschen Reich, im Gegenteil: Er war Karl-Otto Dornberg, Hitlers verlässlichster Drahtzieher im Räderwerk der Deportation und Ausplünderung jüdischer Haushalte. Ein Zahlenverdreher, ein Raubritter und ein ziemlich großer Mann im Staate, der nun klein und bucklig in seinem Keller zwischen gebrauchten Filmkleidern und staubigen Weinflaschen kauerte.
Es klingelte und sie ließ die Männer warten. Noch einmal kontrollierte sie ihr Haar im Spiegel und zog den Knoten ihres Morgenmantels fester. Es klingelte wieder und nun zwang sie sich, zu funktionieren und charmant zu sein. Nervös drehte sie an vielen Schlüsseln, schob den Riegel der Eingangstür zurück und öffnete sie.
»Guten Morgen die Herren! Was kann ich denn für Sie tun?«
»Ich bin Leitenant Goworow«, sagte der eine mit abgehacktem russischen Akzent. »Ist das hier Haus von Nazi-Sekretär Dornberg?«
»Und was möchten Sie, bitte?«, erwiderte sie überhöflich.
»Militärpolizei!«, sprach der andere knapp und stieß mit voller Kraft die Tür zur Seite.
Die beiden schritten durch den Flur, schauten sich um, sahen sich an und schwiegen. Erst als ihr Blick auf den gedeckten Tisch fiel, sprachen sie laut auf Russisch und der eine, der sich vorhin als Goworow vorgestellt hatte, befahl dem anderen, sich unverzüglich im Haus umzusehen. Er wollte in der Zeit hier warten und sie durfte sich nicht mehr bewegen.
»An die Wand!«, befahl er laut und sie gehorchte aufs Wort, als er ihr den Lauf seiner Pistole zeigte. Sein Kumpan indes marschierte mit festen Schritten durch die Flure, durchsuchte alle Zimmer und fand eine kleine hölzerne Tür. Er riss sie auf, schritt die abgetretenen Stufen hinab in den Keller und ließ den Strahl seiner Taschenlampe über staubige Hutschachteln, ein hohes Weinregal sowie einen großen Kleiderständer gleiten. Mit leichter Hand strich er über alte Filmkostüme und merkte nicht, dass genau darunter der gesuchte Reichssekretär unter einer verdreckten, braunfleckigen Decke kauerte. Dort zitterte Karl-Otto Dornberg mit eiskalten Schweißperlen auf der Stirn um sein Leben und traute sich weder einen Ton von sich zu geben noch zu atmen. Er hielt die Luft an und lauschte. Eine Welle der Übelkeit stieg in ihm hoch und es wühlte in seiner Brust, weil er wusste, dass es nun zu Ende war. Er wollte nicht auf so schäbige Weise von einem Russen in seinem eigenen Keller umgelegt werden. Es sollte ein würdiges Ende sein – er hätte seinen Untergang lieber selbst entschieden. Standesgemäß wie der Führer, mit Zyankali, mit dem Strick oder mit der eigenen Pistole. Nach Erlöschen seiner Verantwortung war ohnehin alles versunken und da ein Sieg für Deutschland unmöglich geworden war, hätte zumindest seine Niederlage ehrenvoll sein müssen.
Jedoch fand der Russe nicht, wonach er suchte, kratzte sich nur unter der Mütze und stieg wieder hinauf ins Tageslicht.
Zugleich stand Brigitte Dornberg im Speisezimmer mit dem Rücken zur Wand. Gebetsmühlenartig stellte ihr der Leutnant immerzu die gleiche Frage.
»Wo ist er?«
»Ich sagte Ihnen doch, dass niemand im Haus ist. Meine Tochter ist bei Freunden und …« Es war sinnlos, die Lüge weiterzuspinnen, da im gleichen Augenblick der andere Genosse mit Vera im gehebelten Polizeigriff aus der Küche gestolpert kam.
»Nicht so heftig, Mensch! Sie tun mir ja weh!«, sprach sie widerborstig und versuchte, sich aus seinen Fängen zu befreien. Um sie zu bändigen, presste der Rotarmist seinen Arm um ihre Kehle und umklammerte sie. Sein Griff um ihren Hals wurde zunehmend stärker und Vera rang nach Luft.
»Du willst weiter lügen und deiner Tochter beim Sterben zusehen?«, knurrte Goworow Brigitte Dornberg an und fuchtelte mit der Pistole. »Wo ist dein Mann? Wo versteckt er sich? Rede endlich!«
Als sie ihre Tochter zwischen den Schmiedezangen des russischen Peinigers nur noch würgen und röcheln hörte, nahm sie das Schicksal als unabänderliche Macht hin. Sie legte ihre freundliche Maske ab, bewegte sich von der Wand weg und ging auf ihn zu.
»Was sollen diese ewigen Fragen? Was willst du von mir hören, Russki?«, zischte sie. »Er ist nicht hier! Ich weiß nicht, wo er ist! Verstehst du es nicht?«
»Hinknien!«, befahl er. »Auf den Boden!«
Sie dachte nicht einmal daran. Mit den Fäusten an der Hüfte trat sie ihm trotzig entgegen.
»Wir hätten mit euch allen kurzen Prozess machen sollen, ihr seid wirklich nur Untermenschen!«, schrie sie und spuckte ihm vor die Füße. »Fahr zur Hölle, schmutziger Russe!«
Plötzlich ein kräftiger Schlag und ein gellender Schmerzensschrei. Ohne zu zögern, schlug der Rotarmist ihr mit der schweren Pistole ins Gesicht.
»Wie lange wollt ihr lügen?«, schrie er und malträtierte sie mit weiteren Schlägen. »Ich frage dich! Wie – lange – wollt – ihr – Deutschen – weiter – lügen? Wie – lan-ge?«
Vera musste alles mitansehen. Im Würgegriff des anderen schien sich ihr Kopf aufzublähen und Übelkeit stieg in ihr auf, auch weil sie das viele Blut ihrer Mutter nicht mehr sehen konnte. Doch sollte es noch schlimmer kommen, als der Rotarmist ein letztes Mal ausholte und ihrer Mutter mit voller Wucht einen Schlag versetzte. Brigitte Dornberg strauchelte wie eine betrunkene Balletttänzerin ins Nichts und fiel mit gebrochenen Augen zu Boden. Im Zimmer wurde es still, ganz still. Ruhe. Friedhofsruhe. Lebensbedrohliche Ereignisse sind nie laut, sondern die stillsten. Diese Stille war unerträglich und das Einzige, was Vera noch hörte, war ihr pochendes Herz.
Das Grauen lag in der Luft und sie wusste, in welcher Gestalt es sich jetzt zeigen würde. Der eine lockerte den Würgegriff, der andere den Gürtel seiner Hose. Er packte sie an den Schultern, um sie mit dem Gesicht gegen die Wand zu drücken, und stank nach Tabak, Schweiß und Blut. Unsägliche Angst lähmte ihren Widerstand, sie wollte sich nicht vorstellen, wie das Ganze hier endete. Daher nahm sie es als gegeben hin, schloss die Augen, neigte den Kopf und ließ es wortlos über sich ergehen.
Der Tatbestand der Vergewaltigung gilt nur bei unmittelbarer körperlicher Überwindung weiblichen Widerstands sowie bei glaubhafter Gegenwehr des Opfers, während alle anderen Formen sexueller Gewalt mit vaginaler Penetration nicht als solche bewertet werden können.
Besatzungsstatut 35/5.II/ uneheliche Kinder aus Vergewaltigungen durch Besatzungssoldaten
I Zugehörig
1
Zwei Jahre später. Freitag, 1. August 1947
Es war die Katastrophe des Krieges, die Berlin in den letzten beiden Jahren gezwungen hatte, sich neu zu erfinden. Das Ausmaß der Zerstörungen war beträchtlich. Vielen Häusern fehlten Dächer, Treppenhäuser, ja sogar Hauswände, sodass man den Leuten wie in einem offenen Adventskalender beim Leben zuschauen konnte. So schälte in einer Wohnung eine alte Frau Kartoffeln, während der Nachbar nebenan mit der Zeitung auf dem Sofa saß. Zugleich war Berlin mit Militär nur so vollgestopft. Die alliierten Sieger hatten die Stadt untereinander aufgeteilt und jede Besatzungsmacht hatte ihre eigenen Interessen. Die Russen hatten den Ostsektor als Machtbereich übernommen und der Westteil wurde von Briten, Amerikanern und Franzosen zur Trizone erklärt. Doch während die Westmächte sich schnell auf eine Zusammenarbeit einigen konnten, kam es immer öfter zu Konflikten mit der anderen Seite.
Im westlichen Bezirk Neukölln sah es wie überall in der Stadt aus und es war schwer, sich den Weg bis zur Mietskaserne im Richardweg Nr. 3 durch die beispiellose Verwüstung der Straße zu bahnen. Trotz der wackeligen Fassade war im Vorderhaus noch vieles intakt. Auch in der Wohnung von Luise Adler, in der sie mit ihrem alten Vater, Walter Adler, zusammenlebte, schien alles in Ordnung zu sein. Es gab wieder Licht, das Telefon funktionierte und es herrschte Frieden in ihr. Auch gab es eine neue Liebe in ihrem Leben. Ein großartiger und sehr ungewöhnlicher Mann, den ihr Vater noch zurückhaltend als »Übernachtungsgast« bezeichnete. Der Gast schlief aber nicht mehr, die andere Seite des Bettes war leer. Sie aber schlief noch einmal ein.
Träume dauern in Wirklichkeit nie lange, auch wenn der Traum einem ewig vorkommt. Wie in einem Kinofilm fügen sich Szenen aneinander, aber das Zeitgefühl verliert die Orientierung. Luise Adler fiel noch einmal hinab in eine kuriose Traumsequenz und verlor sich in Bildern. Darin schritt sie elegant im edlen Kleid, Mantel und Hut durch einen Torborgen in eine gewölbte Halle riesigen Ausmaßes. Sie schaute hoch und erblickte eine monumentale Skulptur auf einem wagengroßen Sockel; es war ein Stier, der seinen Kopf zum Himmel streckte. Auf dem Stier saß eine Frau, eine Gottheit, barfuß und nackt. Sie hatte die Arme in Siegeshaltung, in der rechten Hand die Weltkugel, auf der linken saß ein Greifvogel, der seine Flügel ausstreckte, vielleicht war es aber auch eine Friedenstaube, man konnte es nicht genau erkennen. Sie wusste: Die Frau war Europa und der Stier war der verzauberte Zeus, der Gott der Götterwelt.
Von Weitem hörte sie hinkende Schritte, die widerhallend auf dem kalten Marmor näherkamen. Sie gehörten ihrem alten Gegenspieler, der ihr schon mehrere Male das Leben zur Hölle gemacht hatte. Vor knapp sieben Jahren war er leidvoll durch eine tragische Explosion verunglückt, nun kam er über den glänzenden Boden gehumpelt und ging direkt auf sie zu. Ein lebender Toter mit narbigem Gesicht, der zwischen seinen knochigen Fingern einen halb gefüllten Cognacschwenker hielt. Das Bild war grotesk, doch sie erkannte ihn sofort.
»General Görnitz!«, sprach sie, blickte ihm ins zerstörte Gesicht, zündete sich eine duftende Zigarette der Marke Nestor Orient Gold an und nahm ihm dreist das fragile Glas aus der Hand. »Ein Mann, den man gleich erkennt, trotz der schlimmen Blessuren. Sie sehen ausgesprochen schlecht aus, schön, freut mich. Ich hätte nämlich meine Zweifel, ob ich Sie erkannt hätte, wenn Sie auf einem weißen Schimmel aus dem Paradies geritten wären. Ich hoffe, die Hölle bleibt der Ort, an dem Sie schmoren. Warum tragen Sie eigentlich noch Ihre Uniform?«, fragte sie frech, trank ihm den Cognac weg und schmiss das Glas hinter sich, das zerbrach. Danach noch ein kräftiger Zug an der Nestor, um ihm provokativ den Rauch genüsslich ins Gesicht zu hauchen.
»Ich habe für mein Land gekämpft, ich habe dem Führer gedient und ich bin stolz, ein Deutscher zu sein«, antwortete er kühn und wedelte sich den Qualm aus dem Gesicht. »Warum sollte ich diese Uniform nicht weitertragen, Fräulein?«
»Sie sehen ein bisschen aus wie Hanswurst«, antwortete sie. »Ich meine, Sie sind gestorben, Hitler hat sich erledigt und der Krieg ist vorbei. Ihr Weltbild wird aussterben, zumindest in Deutschland, also was soll noch der Mummenschanz, General Hinkebein?«
»Ach Adler, Sie neunmalkluges, dummes Ding«, spottete er niederträchtig mit den altbekannten Beleidigungen. »Schauen Sie doch genau hin! Ihr Kampf für das Gute ist unsere Chance, die Wahrheit zu kontrollieren. Sie kämpfen für Ideale, die nicht existieren, nie existiert haben. Wir werden uns zurückholen, was uns zusteht. Die Deutschen werden uns abermals nachlaufen. Unser Gift hat sich so tief in ihre Seelen gefressen, dass Sie es schwer haben werden, dieses Gift aus ihren Gedanken zu tilgen. Und auch wenn unser Dasein beendet zu sein scheint, werden wir uns in verschiedenen organischen und anorganischen Formen wieder bemerkbar machen. Die Ordnung unserer Volksgemeinschaft ist unveränderlich. Es ist das wertvollste Konzept von Recht und Gerechtigkeit für die kommenden Jahrhunderte. Sehen Sie sich nur das zersplitterte Glas an!« Er deutete auf den zerbrochenen Cognacschwenker am Boden. »Es enthält ein System von Atomen und Elektronen. Sie können es wegwerfen, zerstören und zerbrechen, doch die Ordnung des Materials bleibt unverändert. Und so ist es mit der deutschen Gesinnung. Daher kann ich Ihnen eines absolut versichern, Fräulein Adler: Es ist nicht vorbei. Ich bin und bleibe:
U N S T E R B L I C H!«
Das Echo des Wortes hallte zwar noch eine Ewigkeit nach, jedoch erwachte sie vom Knall einer entfernten Explosion und der Traum riss ab. Sie sprengten dauernd gefährliche Ruinen draußen und so fiel sie aus der Ruhmeshalle Europa in die Wirklichkeit zurück. Sie war erleichtert über den erlösenden Wachmoment, wollte in diesem Film nicht weiter mitspielen. Wie sie jedoch diesen schrägen Traum mit seiner Hauptfigur aus dunklen Tagen deuten sollte oder ob er überhaupt eine Bedeutung für sie hatte, darüber dachte sie besser nicht nach. Noch mit müden Augen sah sie zum Frisiertisch hinüber. Bevor sie gestern Abend mit ihrem Übernachtungsgast ins Bett gestiegen war, hatte sie dort feinsäuberlich ihre Nylons abgelegt. Ansonsten standen da nur ein paar Tiegel; nichts Atemberaubendes weit und breit. Nivea-Dose, Kölnisch Wasser, Lippenstift, aber nirgendwo ein Pillengläschen mit ihrem altbewährten Pervitin. Sie hatte es gut versteckt. Die Zeiten, in denen sie das aufputschende Mittel wie Hustenbonbons gefuttert hatte, waren lange vorbei. Ihre neue Droge war er, der Franzose: Elian Bouxwiller. Der Mann, der ab und zu bei ihr im Bett schlief und mit dem sie schon öfter geschlafen hatte. Er war kaum älter als sie und seines Zeichens Adjutant de corps, also Oberfeldwedel des 11. Régiments de Chasseurs der französischen Division. Auf dem Gang hörte sie ihn und ihren Vater schon tuscheln. Sie kicherten immerzu und zählten »Zwo, drei, vier«, als wollten sie ein Lied einstimmen. Sie ahnte, was die beiden ausheckten, und stellte sich schlafend, um friedlich abzuwarten, dass sie die Zimmertür öffneten.
»Joyeux Anniversaire! Äppi Birthday to you!«, sang Elian und erschien mit einem kleinen Kuchen mit einer brennenden Kerze in der Mitte.
»Nun ist sie wieder ein Jahr älter!«, begleitete ihr Vater den frankophonen Singsang seines Vordermanns und strich sich über den grau melierten Bart. Er steckte in seinem Lieblingspyjama, war wach und außerordentlich gut gelaunt. »Und? Hast du was Schönes geträumt?«, fragte er. »Dann geht es hoffentlich bald in Erfüllung. Aber nun steh mal endlich auf oder willst du etwa deinen ganzen Geburtstag verschlafen?«
»Du musst erst die Kerze auspusten, Chérie!«, ergänzte Elian in fehlerfreiem, aber französisch akzentuiertem Deutsch. »Das bringt Glück, Chérie!«
Sie richtete sich auf, gähnte und freute sich über die nette Geste und den schönen Moment.
»So habe ich ja meinen Geburtstag noch nie begonnen, dass mich gleich zwei Kavaliere umgarnen. Na, da kann ja nichts mehr schiefgehen.« Auch wenn ihre Stimme dabei fröhlich und warm klang, packte sie schon ein Hauch von Wehmut in diesem Moment, was aber nichts weiter war als ein kurzer Gedanke des Bedauerns. Ihr war klar: das Pendel der Lebensuhr machte auch bei ihr keine Pause, sie würde nicht jünger werden. Das Altern sah sie aber weniger als Kerker, eher als einen hohen Balkon, von dem man Jahr um Jahr immer weiter blicken konnte.
»Mit dem Alter ist es wie mit dem Elsässer Wein, Louise …«, scherzte Elian. »Es muss ein guter Jahrgang sein.« Während ihr Vater dastand und in sich hinein schmunzelte, nahm Elian auf der Bettkannte Platz und hielt ihr den Kuchen vor die Nase. Sie setzte sich aufrecht und pustete die Kerze aus.
»Noch einmal alles Gute, Chérie!«, sprach er und legte eine herabhängende Haarsträhne hinter ihrem Ohr zurecht. Immer wenn er das tat und so redete, klang es wie eine Liebeserklärung. Und ganz besonders sein sanftmütig gehauchter Akzent führte dazu, dass sie Wachs in seinen Händen war. »Und naturellement werde ich heute für meinen Liebling kochen, Chérie«, lullte er sie weiter mit Worten ein und verwickelte schließlich ihren Vater in das Vorhaben. »Soupe à l›oignon … eh … Zwiebelsupp‘. Und Sie werden mir gefälligst dabei helfen, Monsieur Adler! Non, non, heute keine Ausreden! Sie schneiden die Zwiebeln. Mein mitgebrachter Pinot Noir wird Ihnen die Arbeit sicher erleichtern.«
Der alte Adler schaute skeptisch und schien von der Idee, unter Tränen Zwiebeln schneiden zu müssen, nicht ganz begeistert zu sein. Mit dem Gedanken, den Vormittag mit dem sympathischen Monsieur Adjutant und einem guten Wein in der Küche zu verbringen, um etwas Gutes zu essen zu bekommen, konnte er sich aber durchaus anfreunden. Jede Nahrung war ihm willkommen, die Lebensmittelrationen reichten meist nicht und er war oft hungrig, auch wenn seine Tochter bei der Polizei eine höherwertige Lebensmittelkarte bekam. Zudem wäre niemand auf die Idee gekommen, diesem charmanten Mann im Uniformhemd der französischen Besatzungsarmee mit seinem freundlichen Lächeln unter den schmalen Schnurrbartstrichen einen Gefallen auszuschlagen. Er war ein echter Hauptgewinn, sah gut aus, war intelligent, warmherzig und unbestechlich. Er hatte einen nachsichtigen Blick auf die zerstörte Welt und eine edle Aura, die Luise unwiderstehlich fand. Nach eigenen Erzählungen war Elian im Elsass, im beschaulichen Le Pays d›Eguisheim an der Weinstraße, zweisprachig zwischen prächtigen Fachwerkhäusern und engen Kanälen aufgewachsen. Durch seinen Vater, einen General der Fremdenlegion, schlug er ebenfalls eine militärische Laufbahn an der Militärschule von Saint-Cyr ein. Nach der Befreiung Frankreichs wurde er in Berlin stationiert. Hier lebte und diente er die meiste Zeit in der Kaserne Quartier Napoléon im Wedding, dem ehemaligen Sitz des Infanterie-Regiments von General Göring. Luise lernte Elian im Zuge einer Fahndung kennen. Drei Frauen waren in kurzen Abständen nahe der Kaserne ums Leben gebracht worden. So hatte, wie sich später herausstellte, der zivilangestellte Küchenhelfer Ronald Bösgang seine Opfer immer erst in einen netten Wortwechsel verwickelt, dann begrapscht, getötet und beraubt. Man gründete sofort eine Sonderkommission namens Bräutigam. Adler sollte als Kommissarin der Weiblichen Kriminalpolizei die Ermittlungen unterstützen und Elian, als Vertreter der Alliierten, konnte im Auftrag des Quatier général die Kaserne nach dem Verdächtigen auskundschaften. Luise verliebte sich in Elian, obwohl Liebe für sie lange nur ein Wort, kein Gefühl mehr war. Durch diesen interessanten Franzosen jedoch wurde ihr die Bedeutung des Wortes wieder bewusst. Er war ganz anders als andere Männer und schien aus einer Welt zu stammen, die mit ihrer absolut nichts zu tun hatte.
In der Küche klapperten mittlerweile schon die Kochutensilien und in der Wohnstube dudelte Radiomusik. Der neu gegründete RIAS, der Radiosender im amerikanischen Sektor, spielte Hallo kleines Fräulein von den Drei Travellers. Eine swingende Kurzweil aus Akkordeon, Gitarre und lustigem Herrengesang. Deutscher Swing, zwar ein Paradox an sich, aber die passende Begleitmusik zum Geburtstag. Luise stieg aus dem Bett und begann, noch im Nachthemd, durch die Wohnung zu wippen und mitzusingen.
»Dudilidüp … Hallo, kleines Fräulein … haben Sie heut‘ Zeit … mit mir auszugehen … nur zum Zeitvertreib?«
Durch die laute Tanzmusik hätte sie fast das Rasseln der Türklingel überhört. An der Küche vorbei, in der die Männer lachten, sich ihr erstes Weinchen genehmigten und werkelten, schritt sie barfuß über das knarrende Parkett zur Wohnungstür, um durch den Türspion zu blicken.
»Ja? Wer ist da bitte?«
»Kommissarin Adler!?«, rief die schroffe Stimme hinter der Tür so laut, dass in der Nachbarwohnung ein Baby zu weinen anfing. »Öffnen Sie bitte!«
Adler nahm die Kette von der Tür, öffnete und erkannte den Mann auf der Stelle. Es war ein Mitarbeiter der Fahrbereitschaft der Kriminalpolizei.
»Ich bin hier, um Sie abholen, Frau Kommissarin! Mord in den Ruinen am Anhalter Bahnhof!«
2
Das Wetter war wie die Lage der Menschen in der Stadt: unbeständig. Die Fahrt zum Tatort ging zügig an zerstörten Geschäften und Hotels hinter Bergen von Geröll vorbei. Auf den Gipfeln des Schutts standen viele Trümmerfrauen in den immer gleichen Kittelschürzen und mit übergroßen Knoten in den Haartüchern. Rastlos schufteten sie und schlugen mit ihren Schlageisen auf Backsteine. Seit Monaten schafften sie Schutt aus der Stadt, um Straßen wieder frei zu machen und neues Baumaterial zu gewinnen. Adler sah ihre Anstrengungen durch das Beifahrerfenster und der Anblick zeigte ihr deutlich: Der Krieg war ausgekämpft, Ehemänner und Söhne gefallen, versehrt oder noch in Kriegsgefangenschaft, aber diese Frauen da bauten ihre Stadt wieder auf.
In letzter Zeit gab es auch für Adler viel zu tun; eine Unzahl an Fahndungsaufgaben für die weibliche Kriminalpolizei. Fast immer drehten sie sich um Frauen, die Opfer von schwerem Raub, Körperverletzung, Mord und Vergewaltigung wurden oder die nach solchen Taten Selbstmord begingen. Die Delikte wurden in Wohnungen, aber auch auf offener Straße verübt. Die Frauen wurden wahllos zum Opfer, die Täter waren eindeutig Armeeangehörige aller vier Besatzungsmächte. Der Kriminalpolizei und ihrer weiblichen Abteilung waren allerdings meist die Hände gebunden. Wenige Täter konnten dingfest gemacht werden; das meiste wurde von den Besatzern gedeckt und abgeschwächt. Sogar beim Tippen der Polizeiprotokolle musste sich Adler zurückhalten, durfte mit vorsichtiger Sprache nur von Tätern in sowjetischen oder anderen Uniformen reden und sollte in jedem zweiten Satz das Wort angeblich unterbringen, wie:
In der Nacht wurde die Gartenarbeiterin Erika E. angeblich von einer Person in einer amerikanischen Uniform überfallen und vergewaltigt. Der vermeintliche Täter entkam unerkannt. Die amerikanische Militärpolizei (M. P.) wurde von dem Vorfall benachrichtigt.
Inzwischen hatte der Wagen die wiederhergestellte Möckernbrücke des Landwehrkanals überfahren und das Areal des Anhalter Bahnhofs erreicht. Adler bat den Fahrer, sie direkt vor der großen Portalruine abzusetzen und stieg aus dem Wagen. Sie zog ihre Handtasche auf der Schulter zurecht und schaute zum zerstörten Bauwerk hinauf. Wie eine nicht mehr benötigte Filmkulisse mitten im Nichts warf die übrig gebliebene Eingangsfront aus Verblendsteinen und Terrakottaschmuck ihren riesigen Schatten auf sie. Dahinter eine unendliche Wüste aus Staub und Schotter, kein funktionierender Bahnhof mehr, keine rollenden Züge, kein Tor zur Welt, sondern das einsame Symbol für den Stillstand des pulsierenden Herzens der Stadt – ein Denkmal des Schreckens eines sinnlosen Krieges.
Adler schritt durch das Portal oder durch das, was davon übrig war, und erreichte direkt dahinter, neben zwei Einsatzfahrzeugen, eine Schar Polizisten sowie vertraute Personen aus der Kriminaldienststelle Westberlin. So lautete der neue Name des für die Trizone zuständigen Kriminalpolizeiamtes. Die Runde bestand auch aus Kollegen der Spurensicherung sowie einem GI, einem Soldaten der M.P. Ein Kaugummi kauender Typ, groß wie ein Schrank und mit poliertem Helm. Und selbstverständlich durfte Adlers Vorgesetzte, die schon leicht betagte, aber geistig hellwache Grete Hartmann, die Direktorin der Weiblichen Kriminalpolizei, nicht fehlen. Drei Staatsordnungen hatte sie mittlerweile überlebt, nun blickte sie perplex auf die Leiche einer Frau und hielt sich ihr besticktes Taschentuch vor die Nase. Sie hatte Schwierigkeiten, ihre Übelkeit zu unterdrücken, da ein eigentümlicher, ekelerregender Geruch von der Leiche herüberschlug.
»Ich grüße Sie, Kommissarin Adler! Alles Gute zum Geburtstag übrigens! Tja, man kann’s sich leider nicht aussuchen«, sprach sie mit gewohnt rauer Stimme durch das Taschentuch und gab Adler mit ihrem Blick einen gedachten Händedruck. »Kinder fanden die Frau heute beim Spielen in der Ruine. Bahnhöfe scheinen wohl Ihre Hausmarke zu sein. Aber, dieser Gestank ist wirklich kaum auszuhalten, was? So was Ekliges, einfach nur abscheulich!«
Es war die Grenze des Erträglichen und auch Adler rümpfte die Nase. Sie hätte sich an ihrem Geburtstag durchaus etwas Besseres vorstellen können als diesen unerträglichen Gestank nach vergammelter Leiche und versengtem Haar.
*
Zur gleichen Zeit verzog ihr Vater, Walter Adler, am Küchentisch vor einem Berg von Zwiebeln sitzend schmerzvoll das Gesicht. Der scharfe Duft war unerträglich, ihm brannten die Augen, schnitt er nun schon das achte Exemplar für die Suppe des netten Franzosen.
»Sie sollten zu einer Taucherbrille greifen, Monsieur Adler«, scherzte Elian, der gegenüber am Herd stand und mit dem Löffel im Topf kreisend eine liegende Acht malte. »Das sieht lustig aus und bietet sicher Schutz. Wie Sie feststellen, verlangt die französische Küche nicht nur Kunstfertigkeit, sondern auch Körperbeherrschung. Schauen Sie bei mir, Rühren ist nicht gleich Rühren. Ich bin ein Mensch, für den das langsame Rühren ein Bedürfnis ist, weil ich die Dinge beim Militär immer vite vite hinter mich bringen muss. Wenn ich koche und ein Zeichen der Unendlichkeit in die Suppe zeichne, fällt mir wieder ein, wie schön die Unendlichkeit von l‘amour, von der Liebe ist.«
Während der Alte die nächste Zwiebel zerhackte, die sich, wie ihre Geschwister zuvor, mit stechend riechendem Stoff wehrte, hielt ihm der Franzose die Flasche hin und goss ihnen nach.
»Kommen Sie, Herr Adler! Reichen Sie mir Ihr Glas! Wir trinken noch einen und stoßen an. Auf Sie, auf die gute französische Küche, auf la vie, das Leben, und den Geburtstag Ihrer Tochter Louise, der wundervollsten Frau der Welt. Santé!«
Sie ließen die Gläser klingen, nippten genüsslich an ihrem zweiten Glas Wein und Walter Adler zündete sich eine Zigarette an. Als er den Rauch Richtung Decke blies, sah er eine gute Gelegenheit, das seichte Geplauder von Mann zu Mann in ein vertrautes Gespräch mit einem möglichen Schwiegersohn zu verwandeln.
»Weil wir gerade bei Luise sind, Herr Adjutant, ich darf Sie doch Elian nennen?«
»Selbstverständlich dürfen Sie das, Monsieur!«, bestätigte er freundlich.
»Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die ich Ihnen schon lange stellen wollte. Wie ernst ist es Ihnen eigentlich mit meiner Tochter, Elian?«
»Sie meinen …?«
»Ja, meine ich. Ist es Ihnen sehr ernst mit meiner Tochter?«
Sein Gegenüber zuckte zunächst zusammen, guckte verdutzt aus der Wäsche, wusste aber, wohin die Frage ging, und schaltete schnell.
»Als Zeichen des Respekts würde ich natürlich zuallererst Sie fragen, Monsieur Adler, aber ich kann mir ein Leben mit Ihrer Tochter in jeglicher Hinsicht vorstellen. Ja, das könnte ich. Eine feste Bindung erhöht die sittliche Zuverlässigkeit eines Mannes, sagt man bei uns.«
»Das ist schön von Ihnen zu hören, ich möchte nämlich ehrlich zu Ihnen sein. Ich möchte sichergehen, dass meine Tochter glücklich wird. Sie musste viel durchmachen, gerade, als sie jünger war. Luise hatte es besser verkraftet, als meine Frau verstarb. Sie kümmerte sich damals um alles und ganz besonders um mich. Meine Tochter war immer für mich da, auch als ich nicht mehr leben wollte. Daher ist es mir besonders wichtig, dass der Mann, der die Absicht hat, sie zu heiraten, ihr alle erdenklichen Wünsche von den Lippen abliest und weiß, was ihr wichtig ist. Haben wir uns verstanden, Herr Adjutant?«
Noch nie hatte er so offen über seine Gefühle zu seiner Tochter geredet und war der Meinung, dass das auch reichen sollte. Elian reagierte prompt im schneidigen Soldatenton, streckte die Brust raus, zog den Bauch ein und hob die Hand zum militärischen Gruß.
»Selbstverständlich, Monsieur, à votre commande!«
»Nun mal langsam, so weit kommt es ja noch!«
Der französische Adjutant war vom Thema weiter angesteckt und geriet ins Schwärmen.
»Ich werde Louise überraschen und um ihre Hand anhalten. Wenn das Kasernenleben für mich vorbei ist, habe ich den Wunsch, dass aus ihr und mir eine echte Familie wird. In Frankreich sagen wir, dass das Leben mit Kindern nie langweilig ist. Kinder erfordern ein dickes Fell, aber dieses Fell muss weich sein. Und so ein Fell hat Louise. Sie ist geduldig, sanft, kann aber ganz schön hartnäckig sein. Auch wenn das mit den Kindern sicher bei ihr immer schwieriger werden wird.«
»Schwierig? Wieso schwierig?«
»Schauen Sie, Monsieur Adler. Frauen stehen ja unter enormem Zeitdruck. Für eine Frau in Louises Alter ist es sicher nicht leicht, schließt sich doch irgendwann ein Portail, eh, ich meine ein Tor, also wenn wir es mal rein von der Biologie aus betrachten. Irgendwann ist es zu spät, eine Familie zu gründen und ein erfülltes Leben zu beginnen.«
»Biologie? Erfülltes Leben?«, fragte Walter Adler skeptisch, zuckte mit den Schultern und kratzte sich durch sein spärliches Haar. »Wie soll ich das verstehen?«
»Louise wird sicher panique de dernière minute haben«, erklärte er weiter. »Es wird mit den Jahren chancenloser für Ihre Tochter, ich meine, das mit den Kindern. Da müssen wir zwei uns wohl ganz schön beeilen mit oh la la, Sie wissen schon!«
Der durchaus abgeklärte Adler wollte das alles gar nicht im Detail wissen. Es war ihm unangenehm, etwas darüber zu hören, und er fühlte sich unwohl dabei, in seinem Alter über derart delikate Fragen zu sprechen. Er war zwar nicht die Gouvernante des Hauses, doch war Torschlusspanik in der Welt der Damen absolut nicht sein Fachgebiet. Deshalb zerrieb er schweigend seinen Zigarettenstummel im Aschenbecher und zermarterte sein nächstes Zwiebelopfer. Während er immer heftiger und ungenauer auf dem Brettchen herumhakte, brütete er noch eine Weile über das Gesagte und musste noch einmal seine Meinung kundtun.
»Ich ein Opa, niemals!«, sprach er energisch. »Was für ein furchtbarer Gedanke. Ich kann mit Kindern einfach nichts anfangen. Außerdem, sagen Sie mir einen Grund, der dafürspräche, dass ich Großvater werden sollte und meine Tochter eine liebende Mutter, die zu Hause die Kinder hütet. Sehen wir es mal realistisch. Luises Lebensumstände, ihr Beruf bei der Weiblichen und die unregelmäßigen Arbeitszeiten sprechen doch absolut dagegen. Oder soll meine Tochter etwa mit einem Kind hier zu Hause rumhocken?«
*
Hinter dem Ruinenportal des Anhalter Bahnhofs hockte seine Tochter gerade vor einem toten Körper. Dessen bis zu den Strumpfhaltern hochgeschobene Kittelschürze ließ zwischen den gespreizten Beinen eindeutig erkennen, dass es sich um eine junge Frau handelte. Die Kleidung, mit Taubenkot verschmutzt, war bunt und hatte grob karierte Muster. Von einem Sexualverbrechen konnte man nicht sprechen, eher von einer Art Symboltat: Der Täter hatte das Gesicht des Opfers mit einem Pappkarton der bekannten amerikanischen Hilfsorganisation CARE USA abgedeckt. Solche Kartons waren sonst gefüllt mit Obstkonserven, Corned Beef oder Hershey-Schokolade und dienten der Versorgung deutscher Familien gegen den grassierenden Hunger. Adler lüftete den aufgestülpten Pappkarton vorsichtig und erblickte das Widerwärtigste, was sie je in all den Jahren bei der Weiblichen hatte sehen müssen: ein fehlendes Gesicht, das Fleisch verätzt, zerfledert, zersetzt. Alle Weichteile des Leichenschädels waren nicht mehr zu erkennen und Büschel blonder Haare fielen zur Seite. Daher kam also der bestialische Geruch. Jeder, der drum herumstand, blickte angewidert auf die kümmerlichen Reste. Adler fragte sich, wie man die Tote eindeutig identifizieren sollte, so ohne Gesicht. Sie entdeckte aber Anhaltspunkte. Es war eine amerikanische Armeekette, die der Toten um den kümmerlichen Rest ihres Halses gewickelt war. Mit spitzen Fingern nahm sie sie ihr vorsichtig ab, um die Gravur auf der Erkennungsmarke zu entziffern:
Corporal John.T. MAYFIELD
10/9/1926 No.3. CATHILIOC
»Excuse me, Miss!«, sprach der große GI über ihr. »Confidentiality!« Er zog ihr die Kette aus der Hand, um diese sofort zu sichern. »Property of the US-Army!«
Chefin Hartmann platzte neben dem groß gewachsenen Schrank sofort der Kragen und sie musste im ungeübten Sprachmisch aus Deutsch und schlechtem Englisch ihren Dampf ablassen.
»This bring me on the palm, mein Guter! I hold it not out! Sie können ihr das doch nicht wegnehmen! Das ist Beweismaterial, hören Sie?« Sie wurde immer lauter. »Be-weis-material! For the German Kripo! Weibliche Kripo, you know?«
»No, Mam! Secret Matter of Trust! Military Issue! Thank you!«, reagierte der Soldat nur sachlich. Er war weder bemüht, sie zu verstehen noch die Kette herauszurücken, und ließ diese augenblicklich in einem grauen Papierumschlag verschwinden.
»Das ist mir Wurst!«, schimpfte Hartmann. »That’s me wörst! Ach verflixt, ich geb’s auf, der versteht mich ja doch nicht!«
Unterdessen nahm Adler den leeren CARE-Karton in Augenschein und stellte fest, dass in diesem ein Lumpenbündel enthalten war: ein zusammengerolltes Hemd in grüner Tarnfarbe. Sie entfaltete es und entdeckte über der Brusttasche eine mit schnellen Nadelstichen aufgenähte Kennzeichnung mit der gleichen Inschrift des Anhängers der Kette. Heimlich riss sie den Aufnäher vom Hemd.
»Property of the US-Army! A Secret Matter of Trust, Mam! Military Issue!«, wiederholte der GI, als er das Hemd erblickte und auch dies konfiszierte. Was er allerdings nicht bemerkte, war das kleine Abzeichen, das Adler in ihrer Hand verbarg.
3
Die neunzehnjährige Frau trug ein großes Geheimnis unter ihrem Herzen. Verzweifelt saß sie am Küchentisch in der dunklen Wohnung ihrer gleichaltrigen Nachbarin und fing an zu weinen.
»Was soll ich denn machen? Da kann ich ja gleich Säure trinken, damit es sich auflöst. Es ist alles so sinnlos!«
Als Inge Voss vor einem halben Jahr die Stelle als cocktail waitress im Andrews Barracks Service Club, dem Tanzlokal der Kaserne, annahm, ahnte sie nicht, wie sehr sie das Liebesverhältnis zu dem afroamerikanischen Corporal John T. Mayfield in Schwierigkeiten bringen würde. Vorher hatte sie sich kaum für Männer interessiert, schmälte der Frauenüberschuss als Folge des unseligen Krieges ohnehin ihre Chancen im Spiel der Geschlechter. Doch irgendwann stand er vor ihr – John, ihr Traummann und Amerikaner durch und durch. Ein höflicher junger Boy, galant und witzig, mit einem Gesicht so glatt wie poliertes Ebenholz; Zähne strahlend weiß, Hände und Nägel ebenfalls tadellos. Inge fand, sie sah auch nicht so übel aus, als sie sich zum ersten Mal sahen. Sie trug damals ihr dichtes dunkelblondes Haar lockig und es lag perfekt, wie bei Margot Hielscher auf den Kinoplakaten von Hallo Fräulein.
Die Beziehung zu John wurde umso fester, je stärker ihre Liebe wurde. Und das trotz Fraternisierungsverbots, einem Gesetz, das Bekanntschaften zwischen den Besatzern und deutschen Frauen verhindern oder zumindest erschweren sollte. Sicher, es gab so manches German Froilein, das schnell erkannte, dass ihr die Liaison mit einem US-Soldaten gegenüber der kargen Ausbeute des Enttrümmerns und Hamsterns einen kürzeren, lustvolleren Weg in den Wohlstand verschaffte; für Zigaretten, für Kaffee oder Nylons. Inges Verhältnis zu John war aber nie eine Überlebensfrage und dass John und sie sich ineinander verliebten, sich liebten und dafür sorgten, dass ihre Liebe unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschah, konnten selbst die strengen Bestimmungen nicht verhindern.
Doch dann kam der Tag, an dem sie diese unsägliche Müdigkeit überkam, deren Grund sie meist auf die harte Arbeit im Club schob. Es störten sie auf einmal diverse Gerüche hinter der Bar, am meisten der dichte Zigarettenrauch der Lucky-Strikes. Vor dem Ausbleiben ihrer Periode spannten mit einem Mal ihre Brüste und wurden größer. Wochenlang hatte sie Weinkrämpfe oder Lachkrämpfe und schon ein Wort oder nur ein Gesichtsausdruck konnten das eine oder das andere bewirken. Dazu kam diese ständige Dauerpinkelei. Sie war sich irgendwann ganz sicher und wer heute ihre Taille im Profil genauer ins Visier nahm, der konnte nun eindeutig sehen, dass sie ein Kind in sich trug. John stand zu dem Kind, doch bei Inge kreisten immer die gleichen Fragen durch den Kopf: Was ist, wenn das Kind da ist? Was würden die Leute sagen, wenn sie die Herkunft des Vaters an seinem Aussehen ausmachten? »Guck mal, ein Baby aus Afrika …!«, würden sie sagen. »Die hat doch mit einem … du weißt schon, diese kleine Ami-Hure, dieses Besatzer-Liebchen.« Alle würden sie mit Blicken und Gerede wie eine Hexe foltern. Sie sah keinen Ausweg mehr. Niemand durfte es erfahren, niemand: ihre Mutter nicht, ihre Großmutter nicht, und ihr Vater – vor Kurzem erst aus der Gefangenschaft heimgekehrt – würde sie ohnehin auf der Stelle lynchen, wenn er erführe, dass sie ein Kind des Feindes in sich trug.
Nur ihre gleichaltrige Nachbarin, Vera Dornberg, an deren Tisch Inge in der Ritterstraße 21 in Kreuzberg saß, wusste alles von Anfang an. Von Weitem hätte sie jeder für Inges Zwillingsschwester gehalten. Von Nahem zeigte ihr Gesicht jedoch tiefe Furchen, ihr aschblondes Haar war kurz geschnitten und die Sommersprossen, die ihr Gesicht früher noch übersät hatten, waren blass. Vera war die meiste Zeit nur unterwegs. Von früh bis in den Nachmittag hinein arbeitete sie als Aushilfskraft beim Waschmittelfabrikanten MERIL und nachmittags handelte sie, wie viele Frauen heutzutage, auf dem Berliner Schwarzmarkt. Eigentlich wollte sie jetzt gleich los.
»Hör auf zu heulen, Inge!«, blökte sie Vera an. »Davon wird’s auch nicht besser, Mädel!«
»John will es! Er will das Kind mit mir!«, gab Inge im verzweifelten Ton zurück und wischte sich die Tränen mit dem Ärmel weg. »Er will das Kind. Er passt sogar im Club auf mich auf und behandelt mich wie ein rohes Ei. Aber hier? Du weißt ja, wie spießig sie alle bei mir sind.«
»Dir stehen zwei Möglichkeiten offen«, sprach Vera. »Entweder dich weiter an allen vorbeilügen und das Kind in fremde Obhut geben oder du gehst zur Madame, bevor es zu spät ist, und beendest das Ganze.«
»Zur Engelmacherin und abtreiben?« Inge wurde flau im Magen. »Das ist ein Verbrechen, Vera! Früher wärst du gehängt worden. Ich zerstöre ein Leben!«
»Es ist in erster Linie dein Körper und du zerstörst nur dein Leben, das kann ich dir sagen!«, hielt Vera dagegen. »Und die Madame soll eine wahre Expertin auf ihrem Gebiet sein, habe ich mir sagen lassen.«
Vera wusste genau, warum sie Inge dieses Kind aus dem Bauch reden musste, lebte sie seit einiger Zeit selbst mit einem unehelichen Kind in dieser kleinen heruntergekommenen Hinterhofwohnung mit ekelhaften Wänden, abgetretenem Parkett und alten Möbeln. Der Junge war fast zwei Jahre alt und hörte auf den kurzen Namen Fritz. Nicht nur seine brutale Zeugung, auch seine Geburt war für Vera die Hölle auf Erden gewesen. Wie sie ablief, dafür hatte sie nur eine karge Zusammenfassung und allerlei Standfotos in ihrem Gedächtnis, die sie gerne verdrängt hätte.
Fünf volle Tage und vier Nächte versuchte sie damals, das Kind durch ihr enges Becken zu pressen. Sie stöhnte, sie schrie, irgendwann flehte sie, man möge sie sterben lassen. Am Ende wurde sie ohnmächtig, weil ihre Beine gefühllos wurden und ihre Kraft verbraucht war. Ihr ganzer Körper war eine geschundene Masse. Eine Hebamme gab ihr kurz nach den Qualen der Geburt mitleidslos bekannt, dass vieles in ihrem Inneren zerrissen sei. Gewebe habe sich aufgelöst, die Blase sei beschädigt, die Harnröhre an den Beckenknochen zerrieben, sie könne nie wieder schwanger werden. Von da an strömte ein steter Fluss von Urin durch ihre Vagina und erzeugte entlang der Oberschenkel Entzündungen. Er weichte das Fleisch auf und bald stank sie faulig. Sie fühlte sich wie ein geschlechtsloses Monster, nur nicht mehr wie eine Frau – und irgendwann kam sie an den Punkt, an dem ihre Psyche einfach aufgab. Als sie den Säugling in den Armen hielt, löste Fritz bei ihr keinerlei Muttergefühle oder Reflexe aus, die Mütter sonst haben: halten, tragen, kuscheln. Natürlich hatte sie ihn versorgt, ihn gefüttert, gewickelt, gehalten. Aber das alles tat sie, um ihn satt zu kriegen oder zum Einschlafen zu bringen. Sie machte alles mit dem Kopf: die richtige Menge Milch in den Topf gießen für seinen Brei, die Decke richtig um ihn legen oder ihm das Mützchen so über den Kopf ziehen, dass er nicht fror. Später nutzte sie jede sich bietende Gelegenheit, um ihn im Nebenhaus bei der alten Rennack abzuliefern, weil sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen musste, in der Fabrik arbeiten musste oder abends ausgehen musste. Daher sah sie Fritz so selten wie möglich und sein Kinderbett vor dem Gasboiler war der einzige Beweis für seine Existenz in dieser Wohnung. Sie hätte ihn lieber für immer abgestoßen, konnte sie das schreckliche Erlebnis seiner Zeugung nicht aus ihren Gedanken streichen. Irgendwer müsste ihn umbringen, er hatte kein Recht weiterzuleben und sein Tod wäre der wunderbarste Segen für sie gewesen. Schweißgebadet schrak sie nachts auf, wenn die widerlichen Kerle in ihren Albträumen nach ihr greifen wollten. Von Ekel vor dem Geruch von Sperma und Blut geschüttelt, fuhr sie empor und quälte sich mit Selbstvorwürfen, doch das schreckliche Erlebnis von damals, als diese Russen zuerst ihre Mutter mit Brachialgewalt umbrachten und sie kurz darauf zum Geschlechtsverkehr zwangen, ließ sich nicht mehr verdrängen. Und das Allerschlimmste war, dass alle von ihr erwarteten, dass sie sich so verhielt, als wäre das alles nicht passiert.
4
»Prost, Frau Adler! Auf Ihr Wohl! Noch mal alles Gute zum Geburtstag. Irgendwie muss man das alles ja verdrängen.«
Am späten Nachmittag saß Adler im Büro ihrer Chefin. Vor ihr befand sich jedoch keine Aufmerksamkeit, geschweige denn Kuchen, sondern die spärlichen Indizien des Tatortes: die auf dem Tisch drapierte Kittelschürze in bunten Farben, ein Foto des zugerichteten Opfers in total und ein weiteres mit einer Nahaufnahme des verätzten Gesichts. Neben den Fotos lag der leere, vor sich hin stinkende CARE-Karton. Hartmann hatte sich eine klarsichtige Flasche aus den Tiefen ihres Schreibtisches geangelt und gönnte sich einen weiteren gehörigen Schluck daraus.
»Ahh, ich sage Ihnen, meine Liebe, in meinem Alter habe ich ja schon viel Elend gesehen und unzählige vergammelte Leichen riechen müssen, aber das hier ist der Gipfel, das stellt alles in den Schatten. Schnaps ist da die einzig wahre Methode, um diesen grässlichen Verwesungsgeruch zu verdrängen. Wollen Sie sich nicht doch einen Kleinen genehmigen, Adler?«
Nach dem Krieg wurde die Kriminalpolizei und ihre kleine Weibliche Abteilung in die Friesenstraße, Ecke Jüterboger Straße abgeschoben, nur einen Katzensprung vom Flughafen Tempelhof entfernt. Der preußische Ziegelsteinkomplex war in der Kaiserzeit als Kaserne erbaut worden und bis Kriegsende war die neu aufgestellte Reichsanstalt für Luftschutz Hausherr. Bei Einzug der Kriminaldienststelle Westberlin, das Pendants zur Kripo im sowjetisch besetzten Ostteil am Alexanderplatz, war zunächst alles sehr provisorisch gewesen, aber mittlerweile hatte man sich dort eingerichtet. Für Hartmann war es wie ein gutes Omen, dass sie, genauso wie in ihrem damaligen Amtssitz im Kriminalhauptamt am Werderschen Markt, direkt von ihrem Schreibtisch aus dem Fenster sehen konnte. Erst kürzlich hatte ihr der neue Kriminalrat, Dr. Klaus-Theo Raucheisen, dieses Büro und zwei weitere Amtszimmer zugewiesen. Vorher mussten sich sämtliche Mitarbeiterinnen der Weiblichen, es waren nach dem Krieg nur noch eine Handvoll, einen winzigen Raum mit einem Gitterfenster teilen; es war wie in einem Gefängnis. Die neuen Zimmer waren zwar auch nicht gerade riesig, aber wenigstens passte ihr altehrwürdiger Schreibtisch samt der alten Bestuhlung hinein – und sie saß wieder am Fenster, das war für die erfahrene Alte wichtig. Vorher musste sie an einem morschen Holztisch sitzen, nun gab es überall Telefon und Aktenschränke, die man aus dem Besitz des ehemaligen Reichssicherheitshauptamtes erhalten hatte. In denen warteten sogar noch Aktenleichen der Waffen-SS auf ihre Feuerbestattung.
Gleich nebenan, im Vorzimmer, saß neuerdings eine blutjunge Kriminalassistentin, die sich bisher allein um den angestauten Bürokram kümmerte und die Adler nur vom Sehen kannte. Ihr Name war Heidi Stern und sie machte ihrem Namen alle Ehre. Sie hatte einen strahlenden Leumund, einen Gesellschaftsschein für Zutritt in amerikanische Clubs, einen Führerschein und einen Gesundheitsschein. Sie besaß mit Sicherheit keinen Heiligenschein, wurde aber von Amtsleiter Raucheisen der Abteilung als nettes Fräulein für alles zugewiesen. Eine zierliche Frau mit intelligentem Gesicht, kurzer brünetter Bob-Frisur und leuchtend rotem Lippenstift. Noch ein wenig eisig und zurückhaltend, aber weder gefühlskalt noch zornig.
»Ja, schön, dass Sie anklopfen, Frau Stern!«, bat sie Hartmann herein. »Kommen Sie und setzen sich zu uns! Können bestimmt noch was lernen!«