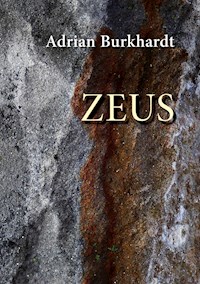
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bernhard Roulier verliert einen potenziellen Klienten durch Mord. Er recherchiert auf eigene Faust, stösst aber sofort auf massiven Widerstand. Durch die Zusammenarbeit mit Professor Dr. Zeus Wallbach, einem Spezialisten in Forensik (Systematische Untersuchungen von kriminellen Handlungen), stellt er fest, dass hinter der Affäre offensichtlich das organisierte Verbrechen, die Ndrangheta, die kalabrische Mafia, steht. Da Bernhard weiter ermittelt, kommt es zur Konfrontation und er wird angeschossen. Bernhards neue Bekanntschaft Rebecca unterstützt ihn sowohl moralisch wie auch durch ihre Spezialkenntnisse in Forensik und Psychologie. Die Flucht vor der Ndrangheta führt sie nach Südfrankreich, wo sich Zeus zu ihnen gesellt. Das Buch ist eine nicht überarbeitete Rohfassung des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Kampe
AIGIS
3. Gigantomachie
Nachwort
Figuren
Konzepte
Lebenslauf (verfasst von Adi, 2011)
Vorwort
Ich kannte Adrian nicht persönlich. Seine Frau Claudia hat mir vor einiger Zeit das Manuskript «Zeus» zum Lesen gegeben, das zu veröffentlichen Adrian leider nicht mehr vergönnt war. Die Leidenschaft, mit der er seinen Roman verfasst hatte, ist erloschen, bevor er einen Verleger für die Geschichte begeistern, mit einer Lektorin um die sprachlichen Details feilschen und an Lesungen ein Publikum gewinnen konnte. Aber Adrian hatte Glück. Er wurde von einer tollen Frau geliebt.
Claudia ist es, die dafür sorgt, dass Adrians literarisches Vermächtnis nicht unbeachtet verstaubt. Der Traum vom Verlag, der das Werk herausbringt und Adrian posthum zum Bestsellerautor macht, hat sie dabei nicht vor Augen. Zuviel Arbeit müsste noch in das Manuskript investiert werden. «Zeus» ist in der vorliegenden Form ein Rohdiamant. Mit Adrians Tod ist es, um es mit einem Begriff aus der Musikbranche zu erklären, ein Demo Tape für ein grosses Album geblieben. Sprachlich ist es noch nicht ausgereift, inhaltlich wird öfters übers Ziel hinausgeschossen. Das Lektorat würde an vielen Stellen gnadenlos den Rotstift ansetzen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Die Finalisierung eines Manuskripts ist für alle Autoren ein wertvoller, wenn auch manchmal schmerzhafter Lernprozess. Man muss mit Kritik umgehen lernen, Kompromisse eingehen, eigene Unzulänglichkeiten eingestehen. Und man wächst als Mensch und Schreiber daran.
Für Adrian ist das leider keine Option. Sein Werk ist wie es ist. Sein Buch ist 100% Adrian. Darum ist die Leserschaft für seine Geschichte auch schnell definiert. Es sind seine Familie, seine Freunde, seine Bekannten, die das nun vorliegende Buch verschlingen werden. Ein kleines Publikum, das Adrian persönlich gekannt und geschätzt hatte. Mit seiner Geschichte kehrt er zu ihnen zurück und zeigt sich von einer bisher unbekannten Seite. Sie begegnen ihm auf eine faszinierende Art neu und Adrian lebt weiter unter ihnen.
Ich empfinde grossen Respekt für das unbeirrbare Engagement und das Herzblut, das Claudia in die Veröffentlichung von Adrians Werk und damit in sein Andenken investiert hat.
Adrian wäre bestimmt nicht nur sehr glücklich darüber, sondern auch unglaublich stolz auf seine Frau.
Roger Strub
Autor
Die Kampe1
21. Dezember
Ich bin nicht gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln. Gewiss, es ist ein Gebot der Vernunft, diese zu benutzen, der überbordende Individualverkehr bringt Infrastruktur und Natur an die Grenze - trotzdem bin ich am Morgen nicht gerne zusammengepfercht mit pickligen Schülern, spiessigen Beamten, aufgetakelten überparfümierten Weibchen und ungepflegten Zeitgenossen. Im Winter stinkt es ein bisschen weniger, aber die Dröhnung der Gerüche und das Tschaggatatschaggata von über 20 MP3-Playern im Bus sind auch nicht gerade erhebend. Die erzwungene Stille, die doppelplus Nichtkommunikation und das Starren ins Leere, um ja jeden Augenkontakt zu vermeiden, ähnlich wie im Lift, eine Bande von sozialen Autisten auf dem Weg zu was man entweder Arbeit oder Ausbildung nennt, aber niemandem wirklich Spass zu machen scheint, ein Heer von geistlosen Vorstadtzombies, in Gedanken wohl bei irgendwelchen Belanglosigkeiten des Lebens, die sie nicht verarbeiten konnten: Pickel, Untreue, Nicht-Beförderungen, unbezahlte Rechnungen, Mobbing, abartige sexuelle Veranlagungen, Bussgelder, ungenügenden Noten, Infekte an den Geschlechtsorganen oder auch anderswo, Rauchverbot undweissichderteufelwas.
Ich war in einer Scheissstimmung – das dürften Sie inzwischen ja wohl bemerkt haben sofern…. Entschuldigung!
„Bärn blablablabla……“ Schon wieder dieses Konterfei, das mir langsam zum Hals heraushing. Die joviale Fratze eines Politikers, der sich neben einem hochbezahlten Regierungsamt noch Zigtausend Franken als Präsident einer NGO auszahlen liess. Medien- und geldgeiler Sack – und das als Mitglied einer sozialistischen Partei. Wenn das Wladimir Iljitsch Lenin wüsste –von Josef „Stalin“ Dschugaschwili ganz zu schweigen, da wären 25 Jahre Gulag in einer Salzmine schon fast ein Geschenk. Aber eben, auch Sozialisten sind heute nicht mehr was früher sondern hocken mitunter in fett bezahlten Ämtern und verbreiten populistisch lächelnd krampfhaft arbeiterfreundliche Botschaften. Freisinnige weisen dafür Bettler weg und das Schweizervolk wirft kriminelle Ausländer raus. Wie gesagt, mein Biorhythmus war auf der Talsohle…
Draussen war es kalt bei -5 Grad und Nebel. Auch die weihnächtliche Beleuchtung, fette Weihnachtsmänner aus PVC (da versagt die Modebranche – so ein paar anorektische Weihnachtsmänner wären doch ganz nett und kämen durch jeden Kamin…), Rentiere aus Styropor und weitere heidnische Symbole vermochten die depressive Wetterlage nicht zu vertuschen.
Ich holperte im Bus von Ostermundigen zurück in die Stadt. Es war ein langer Tag gewesen. Sechs Stunden Interviews mit verschiedenen und nicht immer kooperativen Angestellten. Jedes Interview individualisiert und auf Video aufgezeichnet. Dazwischen Auswertungen und Modifikationen der Fragenkataloge für die nachfolgenden Kandidaten. (Noch) kein Resultat, nur ein Bauchgefühl. Wirtschaftsspionage ist ein ernstes Vergehen – es geht oft um Millionenbeträge, mein Klient wollte lediglich wissen, warum er in den letzten 18 Monaten bei 5 Offerten um jeweils genau 5% unterboten worden war. Umsatzverlust bei 9.7 Millionen Franken. Immer dieselbe Konkurrenzfirma hatte ein wenig billiger offeriert.
„Wir haben ein Qualitätsmanagementsystem. Deshalb fassen wir bei jeder verlorenen Offerte nach und versuchen in Erfahrung zu bringen, weshalb wir den Auftrag nicht gekriegt haben.“ Stanislas Fodors, ein Hüne mit markantem zerfurchtem Gesicht und den wohl üppigsten Augenbrauen, die ich je gesehen habe, zeigte Temperament. Manche kauen Nägel, andere brechen Genicke. Er gehörte zur zweiten Sorte. „Und ich habe noch nie gesehen, dass wir immer vom selben Konkurrenten jedes Mal um 5 Prozent – bis auf 1000 Franken genau bei Millionenaufträgen – unterboten worden sind. Es gibt nur eine logische Erklärung dafür: Wir haben einen Verräter in der Firma!“ Er ballte seine Faust und schlug donnernd auf den Tisch. Ich war froh, kein Tisch zu sein. „Und das in meiner Firma!“ Er spuckte beim Reden. Falls er vom Norovirus infiziert war, würde ich die nächsten 2 Tage auf der Toilette verbringen und meine Innereien leeren. Ich sagte dazu nichts. Er sollte sich nur mal austoben. Nach 3 Minuten Ankündigungen, was er mit dem Betreffenden machen würde (nicht das dies ganz legale Verarbeitungsversuche gewesen wären), beruhigte er sich ein wenig.
Vorsichtig fragte ich nach: „Herr Fodors, könnte es nicht auch so sein, dass der Täter beim Kunden sitzt, und ihre Konkurrenz nach dem Eingang Ihrer Offerte informiert?“
Er starrte mich an und stutzte. Es brauchte einen Augenblick, bis der Groschen gefallen war. Die rote Gesichtsfarbe verblasste und Entgeisterung breitete sich auf seinem Gesicht aus. „Gopfertamisiechnonemau!“ Ein waschechtes Berner Schimpfwort, kein Ungarischer Fluch. Klar, er fühlte sich als Berner. Seine Eltern hatten in Ungarn in den 50er-Jahren durch die Bodenreform von Imre Nagy drei Viertel ihres Bodenbesitzes verloren. Als sein Vater sich politisch zu engagieren versuchte, wurde durch den Zusammenschluss der Kommunisten und der Sozialdemokraten die Magyar Dolgozók Pártja MDP (Deutsch: Partei der Ungarischen Werktätigen), gegründet. Die Partei seines Vaters wurde verboten. Als Ungarn 1956 den Austritt aus dem Warschauer Pakt erklärte und der einrückenden Streitmacht der Sowjetunion zu trotzen versuchte, erkannte sein Vater, dass seine Gesinnung und damit auch seine Familie in Ungarn keine Zukunft mehr hatten und entschloss sich zur Flucht. Die Ausreise war gut organisiert. Sie gingen als Hochzeitsgäste mit 2 Autos los, sein Cousin und seine Familie waren im 2. Auto. Niemand durfte für mehr als 2 Nächte Gepäck bei sich haben. Habseligkeiten und Möbel hatten sie via ein Transportunternehmen nach Salzburg schicken lassen, sie würden die Grenze aber zuvor überqueren. Der Grenzposten von Sopronpuszta war damals noch nicht so populär. Niemand konnte ahnen, dass er fast 50 Jahre später zum Symbol des Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs werden sollte und die Ostdeutschen in Massen an dieser Stelle ausreisen würden. Die jungen Grenzbeamten wurden von 2 Sowjetischen Kommissaren assistiert. Als die Fodors an den Schlagbaum kamen, mussten sie ihre Ausweise zeigen und den Grund ihrer Ausreise erklären. Stanislas Vater Tamás erklärte den Beamten, es gehe um ein Familienfest in Salzburg. Der junge Grenzbeamte nickte und wollte sie durchgehen lassen, als einer der 2 Kommissare dazu trat. „Ein Familienfest. Wie nett. Zeigen Sie ihre Parteiausweise!“ Niemand der Familie war Parteimitglied. Tamás zeigte sich verwirrt. Wozu brauche man denn einen Parteiausweis der MDP um Verwandte besuchen zu dürfen? „Aussteigen!“ war die lakonische Antwort des Kommissars. „Mitkommen!“
Verängstigt warteten die Angehörigen auf Tamás Rückkehr. Plötzlich hörten sie Schreie und Schüsse. Tamás stapfte aus dem Posten. Er blutete im Gesicht und ein Blutfleck breitete sich auf seiner Brust aus. „Haut ab, durchbrecht die Schranke!“ brüllte er und richtete eine Pistole auf den Kommissar und den Grenzbeamten neben ihrem Auto. Der Kommissar liess sich fallen und zog seine Waffe. Tamás schoss zweimal auf ihn, doch schien ihn nicht zu treffen. Der Kommissar schoss einmal und Tamás blieb abrupt stehen. Er schien etwas sagen zu wollen und kippte dann nach vorne. Mit aufheulendem Motor fuhren die 2 Autos los, die Windschutzscheibe des ersten Wagens zersplitterte, aber nach 2 Minuten waren die Fodors als Flüchtlinge in Österreich. Trotz 3 offiziellen Nachfragen wurden der Vorfall und der Tod von Tamás Fodors von offizieller Seite nie bestätigt. Der 13-jährige Stanislas hatte mit ansehen müssen, wie sein Vater starb. Das Gesicht des Kommissars mit den grauen Augen hinter der runden Stahlbrille, dem roten narbigen Fleck auf der rechten Stirnseite, der gebogenen Nase und den asymmetrisch abstehenden Ohren verfolgte den Jungen noch in manchen Träumen.
Umsichtiger weise erfolgte die Überführung ihrer Habseligkeiten gleichzeitig an einem anderen Grenzübergang. So hatten sie zumindest ein Startkapital. Die Familie liess sich in Salzburg nieder und eröffnete eine kleine Papeterie. Stanislas‘ Cousin Levente hatte eine solche in Debrecen betrieben und diese Geschäftsidee schien die Vielversprechendste zu sein. Die Schliessung einer kleinen Druckerei an vielsprechender Lage in Salzburg hatte ihnen einen idealen Standort beschert; zudem begannen viele Ex-Kunden der Druckerei Produkte zu beziehen. Mit für den Erfolg verantwortlich war eine neuartige Maschine der Rank Group, mit der man Dokumente fotographieren und ausdrucken konnte, ein sogenannter Fotokopierer. Die Stadtverwaltung von Salzburg liess nach wenigen Monaten einen guten Teil wichtiger Dokumente auf diese Weise vervielfältigen. Das Durchschlagspapier und die Matrizendrucker waren für Dokumente qualitativ unbefriedigend. Levente hatte der Stadtverwaltungen einen Vertrag ausgehandelt, der je nach Menge Preisreduktionen vorsah. Nach 3 Jahren mussten sie den nächsten Fotokopierer anschaffen. Die Familienmitglieder arbeiteten für einen tiefen Lohn. In Kürze hatten sie einen guten Kundenstamm aufgebaut und verfügten über einen guten Namen. Stanislas absolvierte eine Lehre als Betriebskaufmann und begann nach seinem Abschluss im Familienbetrieb zu arbeiten. Nach 2 Jahren im Geschäft verbrachte Stanislas Ende der Sechzigerjahre als junger Mann eine Woche ferienhalber in der Schweiz und erkannte, dass diese Hochpreisinsel ein unglaubliches Potenzial für das kleine Familienunternehmen darstellte.
1971 eröffnete er eine kleine Filiale seiner Papeterie mit Kopierservice in Zürich. Nach 7 Jahren gab es Filialen in Bern, Basel, Schaffhausen und Winterthur. 1994 setzte Stanislas voll auf das Internet. Er gründete den ersten Online-Bürobedarfsshop der Schweiz. Aktuell war seine Firma in Österreich die Nummer eins in dieser Branche, in der Schweiz immerhin die Nummer zwei.
Inzwischen hiess die Firma TF-Officeline, das TF stand in Gedenken an Tamás Fodors. Sie hatte 487 Mitarbeitende in drei Ländern und wertvolle Kooperationen mit Logistikunternehmen. Über 80% der Artikel waren so innert 48 Stunden lieferbar, ein Standard, auf den TF-Office-line stolz war.
Stanislas war im Herzen ein Kämpfer geblieben – wie sein Vater. Mit sehr viel Temperament und Engagement. Ein wertvoller, aber ein wenig zu impulsiver Zeitgenosse. Ich schilderte ihm die Hypothesen und schlug ihm ein einfaches Vorgehen nach dem Ausschlussverfahren vor:
Phase 1: Interviews mit den Mitarbeitenden, die über die relevanten Informationen verfügen.
Phase 2: Falls keine Resultate erzielt werden, Erstellen mehrerer verschiedener Fake-Offerten und Identifikation der undichten Stelle.
Phase 3: Einbezug der Kunden.
Stanislas war einverstanden und in Bezug auf die Konditionen mehr als grosszügig. Die nächsten paar Tage waren gebongt2. Solche Kunden sind für mich das Salz der Erde.
Ich stieg in den Bus, entspannte mich auf meinem Sitz und schloss die Augen. Mit der Entspannung war’s allerdings Essig. Bei der nächsten Station stieg eine Gruppe Hiphopper ein, die offensichtlich ein Problem mit sich, dem Establishment, der Welt an sich und mit gewissen Passagieren hatten. 3 Stationen weiter hatten sie sich auf ein bärtiges übergewichtiges Subjekt in einem beigen Kamelhaarmantel eingeschossen. „Fettsack!“ „Güggelifriedhof!“ „Zuchtsau!“ Weitere Nettigkeiten folgten. Das Zielobjekt blickte starr geradeaus und vermied jeglichen Augenkontakt. Ach Gott. Ich seufzte innerlich, stand auf und begab mich gemächlich in Richtung der Störenfriede. Das Opfer registrierte mein Herannahen und suchte kurz den Blickkontakt. Die anderen Fahrgäste schauten geflissentlich zur Seite. Man konnte es ihnen nicht verübeln. In den letzten Monaten waren mehrere Fälle publik geworden, bei denen Leute zu Tode oder in die Invalidität geprügelt worden waren. Täter waren fast immer Jugendliche um die Zwanzig.
„Kannst du mit deinen Würstchenfingern noch in der Nase Bohren, du Fettsack? Warte, ich helf dir, aber danach musst du es essen!“ Einer der Jungs bohrte dem Dicken den Finger in die Nase und die Gang grölte vor Vergnügen. Das Weitere geschah blitzschnell. Der Dicke hatte mein Herannahen bemerkt, warf mir einen entschlossenen Blick zu, ich nickte unmerklich. Mit einer raschen, fast beiläufigen Bewegung packte er die Hand des Jungen und brach ihm mit einem laut hörbaren Knacken den Zeigefinger. Der Junge schrie wie am Spiess. Der Dicke erhob sich und knallte dem nächststehenden Jungen die flache Hand an die Nase. Wieder glaubte ich ein Knacken zu hören, aber vielleicht war das Einbildung. Die zwei anderen Jungen wichen zurück. Der eine zückte ein Schmetterlingsmesser. „Dieses Arschloch hat mir den Finger gebrochen“, fluchte der Dunkelhaarige, „macht ihn zur Sau!“ Das zweite Opfer sass auf einem Sitz und presste seine Hände auf die Nase. Blut sickerte ihm über Kinn und tropfte auf den Boden. Von ihm ging offensichtlich keine Gefahr mehr aus. Ich baute mich neben dem Dicken auf. Der blondgefärbte Hiphopper streckte uns sein Messer entgegen und kam in geduckter Haltung einen Schritt näher. Ich war gut einen Kopf grösser und sicher 20 Kilo schwerer als er. Der andere fluchte auf Serbisch. Ich zog langsam meine Lederjacke aus und wickelte sie um meinen linken Unterarm, und sah ihm dabei ununterbrochen in die Augen. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass ein Fahrgast hastig in sein Handy flüsterte. Jemand schrie dem Busfahrer zum er solle anhalten. Ich hielt meinen linken Arm schützend vor mich, als der Junge mit dem Messer angriff. Er zerstörte meine teure Lederjacke, da ich aber zurückgewichen war, geriet er ein wenig in Vorlage. Ich trat ihm mit voller Wucht mit der Schuhspitze ins Knie seines Standbeines, er schrie auf, knickte ein und ich liess einen Handkantenschlag auf sein Genick folgen. Nicht zu stark, ich wollte ihn ja nicht töten. Er liess das Messer fallen und sackte auf den Boden. Der Bus hielt an und die Türen wurden geöffnet. Ein Teil der Fahrgäste stiegen hastig aus, der unversehrte Halbstarke auch. Ich wandte mich an das verbleibende Trio. „Verpisst euch, Idioten. Die Polizei kommt jeden Moment. Ihr habt Mist gebaut, lasst euch das eine Lehre sein. Das nächste Mal landet ihr im Knast. Haut bloss ab!“ Ich liess ein serbisches Kraftwort folgen. Sie zogen ab wie die Eidgenossen bei Marignano. Nummer drei mussten sie stützen, er würde wohl sein Knie beim Arzt untersuchen lassen müssen. Der Busfahrer kam angerannt und verkündete, er habe über die Zentrale die Polizei angefordert. Ich wollte mich eigentlich lieber verdrücken, auf stundenlange Aussagen am Waisenhausplatzrevier konnte ich verzichten. „Prima!“ Ich klopfte dem Fahrer anerkennend auf die Schulter, „das haben sie gut gemacht! Ich überprüfe noch wohin die Täter sich verdrücken, halten sie hier die Stellung und schauen sie, dass die Zeugen nicht abhauen!“ Verdattert blickte er mich an und sah sich um, wer von den Fahrgästen noch im Bus sitzen geblieben war. Ich stieg aus und schritt zügig Richtung Innenstadt. Nach gut zweihundert Metern hörte ich zwei Geräusche: Eine Polizeisirene und ein Schnaufen, das höchstwahrscheinlich von einem entlaufenen Nilpferd stammte. Ich drehte mich um und sah den Dicken im Kamelhaarmantel hinter mir. „Warten sie!“ keuchte er, “Darf ich Sie zu einem Getränk einladen? Sie haben mir sehr geholfen!“ Er spazierte seine Siebteltonne neben mir und wirkte auf eine eigenartige Weise sehr bestimmt und fordernd.
Wir gingen ins nächstgelegene Lokal, ein spanisches Bistro, und mein Überraschungspaket begann zu sprechen. „Seien Sie meiner Dankbarkeit versichert!“ Sein Dialekt war eine Mischung aus Berndeutsch und wohl etwas Deutschem ich tippte innerlich auf Bayern. „Gestatten Sie dass ich mich vorstelle: Theodorus Zeus Wallbach. Doktor der Mathematik der Universität Linz.“ Nicht Bayern, Österreich also. Auch nicht weit daneben. „Sie sind ein tatkräftiger junger Mann. Ich habe sofort realisiert, dass sie höchstwahrscheinlich eingreifen würden. Ich bin ihnen dafür sehr dankbar!“ Er bestand darauf, dass er den Schaden an meiner Lederjacke berappen durfte. Das Teil hatte 850 Schweizerfranken gekostet, der Doktor der Mathematik klappte seine Brieftasche auf und drückte mir einen Tausender in die Hand. Ich wehrte mich nicht übertrieben, als er dann aber noch meinen Namen und meine Adresse wissen wollte gab ich meinen Nachnamen und eine erfundene Adresse an, bestellte auf Spanisch einen kleinen Carlos Primero auf seine Kosten, er ein Glas Rioja und nach wenigen Minuten verdrückte ich mich nach Hause. Ich hatte Gescheiteres zu tun, als mich mit diesem blöden Vorfall zu beschäftigen. Zuhause stellte ich fest, dass das Messer meine Haut doch erreicht hatte. Mein Hemd hatte eine 3 Zentimeter lange Blutspur am linken Unterarm. Merfen und Dermaplast, die 150 Franken extra reichen für ein neues Hemd. Na also! Vielleicht war ja der Tag gar nicht so beschissen, wie ich angenommen hatte?
23. Dezember
2 Tage später leerte ich meinen Briefkasten. Verblüfft blickte ich auf einen Briefumschlag, der als Absender Dr. Th. Z. Wallbach, Münstergasse 23 in Bern auswies. Wie zum Teufel hatte er mich gefunden? Ich riss ihn auf und las die Karte:
Sehr geehrter Herr Roulier!
Ich möchte mich noch einmal in aller Form für Ihr beherztes Eingreifen am 21. Dezember bedanken. Sie haben mich durch ihr umsichtiges, entschlossenes und mutiges Verhalten vor wesentlichem Unbill bewahrt. Seien Sie deshalb meiner Dankbarkeit versichert. Auch wenn es nicht einfach war, Ihre Identität mit mathematischer Logik zu eruieren, werden Sie wohl anerkennen müssen, dass meine Methoden funktionieren. Genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen und lade Sie deshalb ein, den Abend des 31.12.2007 in meiner bescheidenen Behausung an der Münstergasse 23 zu begehen. Falls Sie eine Begleitung mitbringen, lassen Sie es mich wissen.
Hochachtungsvoll
Theodorus Z. Wallbach
Ich überlegte kurz, knüllte die Karte zusammen und warf sie in den Papierkorb. In der Küche bereitete ich ein wissenschaftliches Brötchen zu: 2 Scheiben Roggenbrot, Butter mit ein wenig Dijonsenf vermischt, Kresse, 3 Scheiben Ei, 2 Scheiben Golfetta-Salami, 2 dünne Scheiben Essiggurken, 1 Blatt Saanen-Hobelkäse. Dazu 1 Glas Orangensaft und einen schwarzen Espresso. Ich setzte mich auf den Hocker meiner Bar, begann zu essen und blätterte gemütlich im „Bund“. Es klingelte an der Tür. Ich zupfte rasch Trainerhose und T-Shirt zu Recht, sah innerlich in den Spiegel und ging die Tür öffnen. Frau Hefner, die schrullige Alte aus dem 1. Stock. Sie blickte kurz missbilligend auf meine Kleidung und meine Rasur (aufgrund der überteuerten Rasierklingen rasiere ich mich nur jeden 2. Tag) und teilte mir in klagendem Ton mit, Mitzi sei verschwunden. Mitzi war eine übergewichtige dreifarbige Katze mit dem IQ einer Aubergine und der Liebesbedürftigkeit eines brünstigen Makiaffen. Regelmässig ging sie durch offene Türen und Fenster in Wohnungen und Keller, liess sich dort einschliessen, entleerte dann Darm und Blase und wurde dann von entnervten Anwohnern rausgeworfen und mit wenig schmeichelhaften Attributen belegt. Falls es in unserer Nachbarschaft eine Todesliste für Haustiere geben würde, wäre Mitzi bestimmt einsame Spitzenreiterin gewesen.
„Ich mache mir solche Sorgen! Und das gerade an Weihnachten.“ Sie schniefte und fragte weinerlich:“Können sie nicht nachschauen?“ Ich drehte den Kopf zur Wohnung und schnupperte:“Also hier ist sie nicht. Oder jedenfalls nicht lange. Das riecht man sonst. Zudem ist meine Freundin Katzenallergikerin und muss sofort niesen, wenn eine Katze in der Nähe ist. Gestern war sie da und hat nie geniest.“
„Können sie nicht noch im Keller nachschauen?“ Ich versprach es, wünschte ihr schöne Weihnachten und gute Jagd. Mitzi wäre eigentlich ein perfekter Fall für Electronic Monitoring, Frau Hefner vor dem Bildschirm und die Katze mit einem Halsband mit Mikrochip – eine zu schöne Vorstellung. Ich spürte ihren missbilligenden Blick, als ich mich umdrehte und die Tür schloss. Sie wusste nie ganz, ob ich sie ernst nahm. Keine Ahnung weshalb. Ich kehrte zur Bar zurück und trank meinen mittlerweile lauwarmen Espresso. Friede auf Erden.
24./25./26. Dezember
Zuerst das Positive: Mitzi hatte weder in meiner Wohnung noch in meinem Keller ihr Geschäft verrichtet. Die Weihnachtsbescherung durfte offenbar ein Anderer in Empfang nehmen. 2 x Weihnachten gefeiert, einmal bei meinen Eltern (Strickpullover und Büchergutschein gegen Bratenthermometer und Swisstool), ein Mal bei meiner LAP (Lebensabschnittspartnerin – ich glaube der Wortstamm ist „Abschneiden“), mich danach geweigert, bei ihren Eltern noch einmal zu feiern, was mir als mangelnde Bereitschaft, mich in ihre Familie zu integrieren ausgelegt wurde. Streit und dramatischer Abgang. So verbrachte ich den 26. vornehmlich im Bett vor der Glotze. Diesmal hatte ich es wohl wirklich verkachelt. Es ist ein Ros entsprungen.
27. Dezember
Sie brauchte Abstand. Und war mit ihren Eltern in ihr Ferienhaus im Engadin gereist. Mitzi war am 25. im Heizungsraum des Nachbarblocks halb verdurstet gefunden worden. Sie konnte nicht mal mehr miauen. Kein Wunder, nachdem sie alle 4 Ecken des Räumchens ordentlich begossen und verschissen hatte. Frau Hefner hatte allerdings schon ein Inserat in der Lokalzeitung aufgegeben und war ganz empört, als ihr mitgeteilt worden war, dass sie das Inserat nicht mehr zurückziehen könne:“Eine Unverschämtheit ist das! Dabei könnten sie den Platz ja mit einem anderen Inserat füllen – stellen sie sich vor: Hundert Franken für gar nichts! So lasse ich das Inserat trotzdem erscheinen, ich habe es ja bezahlt! Also Leute gibt’s!“ Oh du Fröhliche.
28. Dezember
Als ich mittags kurz in mein Büro ging stapfte mir 5 Meter vor der Eingangstür die kolossale Gestalt von Dr. Theodorus Zeus Wallbach entgegen. Er war in einen dicken schwarzen Mantel gehüllt, trug eine Pelzmütze, die offensichtlich aus den Beständen der roten Armee stammte und ein zirka 2 Quadratmeter grosses Halstuch. Er sah aus wie Pavarotti auf Sibirientournee. Dabei stand das Thermometer gerade auf lächerlichen minus 2 Grad.
Wie zum Teufel hatte er mich identifizieren können? Ich hatte ihm rein gar keine Informationen über mich gegeben. Und wie zum Henker noch Mal kam er auf die Idee, dass ich Sylvester mit ihm feiern wollte? Da ich weder die Zeit noch die Kondition hatte, ihn zu umgehen, begrüsste ich ihn.
„Mein Freund, mein Freund“ skandierte er begeistert und brach mir 2 Finger meiner Lieblingshand. „Eine sehr leichte Aufgabe, Sie zu finden!“ Nun wenn schon, er war da und wohl nicht so einfach zu vertreiben. Ich bat ihn in mein Büro, schaltete die Kaffemaschine ein und setzte mich hinter den Schreibtisch.
Er schälte sich aus seinen Kleidern, während ich mir mal einen Kaffee zubereitete. Man kann ja nicht zu unhöflich sein und ich fragte ihn, ob er nicht auch…?
Selbstverständlich. Bevor er aber zu Quasseln begann, legte ich etwas fest: „Bevor wir hier über irgendetwas diskutieren, will ich wissen, wie sie mich gefunden haben¨“
Er blinzelte mich aus seinen Augenschlitzen listig an: „Das wurmt sie? Ich habe eine Methode entwickelt, die auf den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht. In ihrem Falle hatte ich doch etliche Daten zur Verfügung!“
„Als da wären???“
„Nun mal…. Sie sind zwischen 35 und 42 Jahren alt. Sie sprechen mehrere Sprachen. Sie mässigen sich in Bezug auf Alkohol. Sie sind Stadtberner, am Dialekt unschwer zu erkennen. Sie verfügen aufgrund ihres Wortschatzes und ihrer Verhaltensweisen über eine tertiäre Bildung, stammen aus der oberen Mittelschicht, besuchen offensichtlich ein Fitnessstudio, betreiben Krav Maga (die Selbstverteidigungstechnik des Mossad), arbeiten – oder haben gearbeitet – in einem Interventionsbereich wie Polizei, Vollzug oder Privater Sicherheit, wohnen im Stadtgebiet von Bern, verkehren oft im „Schlüssel“. Da Sie sich der polizeilichen Befragung entziehen wollten, arbeiten Sie eher nicht für den Staat. Ihr Habitus hat klar aufgezeigt, dass Sie in Krisensituationen souverän reagieren. Sie haben schon öfters negative Erfahrungen mit Polizeiverhören gemacht, deshalb ihre Fluchtreaktion. Solche Erfahrungen machen nur Polizisten, Kriminelle oder aber Leute im privaten Sicherheitsbereich. Im Militär waren Sie klar in einer Kampftruppe und hatten zumindest eine Gruppenführung inne. Ihre Reaktion hat aufgezeigt, dass Sie klar anspruchsvollere Jobs erledigen als öde Bewachung. Entweder wären Sie im mittleren Kader einer grösseren Sicherheits- oder Ermittlungsfirma oder ein spezialisierter Kleinanbieter. Ich habe alle Varianten nach Wahrscheinlichkeit bewertet und dann meinem kleinen Programm gefüttert. Das hat die Daten verwurstet und am Ende blieben 2 in Frage kommende Personen übrig. Sie und ein Toter.“
„Oh, Sherlock Holmes ist also doch nicht über die Reichenbachfälle gestürzt?“ sagte ich mit weit aufgerissenen Augen und erstauntem Blick.
„Das war zu erwarten.“ Er kniff die Augen zusammen und sah aus wie Bud Spencer vor seiner Steuerrechnung. „Es trifft sie, dass ich sie so leicht gefunden haben. Wenn sie wissen wollen, wie ich das genau gemacht habe, dann kommen sie am 31. zu mir. Es soll an Genuss nicht mangeln. Und ich will ihre professionelle Meinung hinsichtlich meines Vorgehens. Ich bezahle sie dafür, Expertenmeinung für – sagen wir 500 Schweizerfranken plus Spesen.“
Ich verdrehte innerlich die Augen. Ein Spinner. Andererseits hatte ich in der Vorwoche meine neuste Bekanntschaft durch suboptimale Reaktion auf ihre Liebesbedürftigkeit und inadäquate Reaktion auf ihre Familie an Weihnachten vergrault und mir somit ein einsames Silvester beschert. Dazu würde ich noch bezahlt werden und der Dicke hatte sicherlich einen guten Unterhaltungswert. Also sagte ich zu, liess mir einen weiteren Finger brechen, als der Koloss mir die Hand erneut drückte und sich verabschiedete und sank dann auf meinen Bürosessel. Draussen plätscherte ein Glockenspiel pausenlos Jingle Bells. Halleluja. Ich öffnete meinen Büroschrank, nahm eine Flasche Redbreast 12 heraus, schenkte mir drei Fingerbreit ein und nahm einen Schluck. Wenn auch die Welt zum Teufel gehen sollte, dann wenigstens mit Stil. Und den Menschen ein Wohlgefallen.
29. Dezember
Am nächsten Morgen begab ich mich erst um halb elf in mein Büro. Auf dem Anrufbeantworter waren 2 Anrufe: Einer von einem offensichtlich paranoiden Ehemann und ein zweiter von einem Spitaladministrator, der mich dringend zu sprechen wünschte. Dem Ehemann rief ich auf sein zweites Handy an (es gibt Leute, die dies haben) und erklärte ihm, dass ich – wie übrigens meiner Website zu entnehmen war – keine Beziehungsgeschichten untersuche. Der Spitalheini – Markus Werren war sein Name - weigerte sich, am Telefon genauere Angaben zu machen, er müsse zuerst sehen, ob er Vertrauen in mich und meine Methoden haben könne. Also fixierte ich einen Termin mit ihm. In meiner Mailbox war ausser den üblichen Mails zur Vergrösserung von Körperteilen und nigerianischen Vorschlägen zur Verbesserung meines Wohlstandes nichts. Ich blockierte die Absender, wohlwissend, dass morgen von einer neuen Adresse aus wieder dieselben gutgemeinten Angebote erscheinen würden.
Ich machte mir einen Espresso und vertiefte mich in die Berner Zeitung. Eine lästige Angewohnheit meines Berufes ist, dass ich sämtliche Nachrichten bezüglich ihrer Relevanz für meine Tätigkeit beurteile. Fehlanzeige. Es sah ganz nach einem Administrationstag aus. Nach 2 Stunden Schreibtischarbeit ging ich etwas essen. Im „Schlüssel“ isst man in der Regel gut, aber noch besser für mich war, dass auch etliche Kantonspolizisten dort verkehrten und ich so den einen oder anderen Tipp oder Auftrag erhalten konnte. Aber auch damit war’s Essig und der Tag schien zwingend in Müssiggang enden zu wollen. Zudem erwies sich das Menu „Suprême de Poularde avec son coulis d’Aceto Balsamico, Légumes de Saison et Riz à La Camargue“ als trockenes Pouletbrustschitzel mit COOP-Aceto und Prodega-Gemüsemischung und ein wenig rotem Reis – heute war wohl nicht mein Tag. Ich schlenderte gemächlich durch die kalte Winterluft. Der Oppenheimer Brunnen sah für einmal nicht wie ein schleimiger grün-brauner Turm aus, sondern wie eine bizarre Eisskulptur. Der Hochnebel hatte sich gelichtet und die Sonne schien blass durch die dünne Nebelschicht. Der Waisenhausplatz sah dank der Ferien nach dem Mittag für einmal nicht wie eine Mülldeponie aus, rund 1000 Schüler und Lehrlinge bei nur 12 Abfalleimern und 4 Fastfood-Lokalen in der Nähe schienen für die Stadtväter eine unlösbare Gleichung zu sein. Ich hatte gerade auf einen Spielsalon Kurs genommen, als mein Handy klingelte. Der Spitalheini.
„Können sie nicht sofort kommen? Es ist etwas Entscheidendes geschehen¨“ Seine Stimme tönte leise und gehetzt. Plötzlich schien er offensichtlich auf wundersame Weise Vertrauen gewonnen zu haben. Auf meine Nachfrage hin, worum es denn gehe, blieb er stur: Nur von Angesicht zu Angesicht. Ich sagte ihm, ich sei in einer halben Stunde bei ihm und nahm Kurs auf das Tram. Tram (Die Strassenbahn von Bern) ist Nostalgie pur. Gemütliches Tempo, antiquierte Klingel, unverständliche Informationen über Lautsprecher – was will man mehr!
Nach 20 Minuten war ich beim Viktoriaspital angelangt. Vor dem Haupteingang stand ein Polizeiwagen mit blinkendem Blaulicht. Ich betrat den Eingangsbereich und schritt zur Rezeption. Eine blondgelockte Schlumpfine mit grossem Busen strahlte mich an und fragte, was sie für mich tun könnte. Ich beschloss, die Tragweite dieser Frage nicht auszuloten und sagte, ich hätte eine Verabredung mit Herrn Werren, dem Administrator. Schlagartig verschwand das Strahlen aus ihrem Gesicht. Dieser Werren schien ja nicht gerade beliebt zu sein. Sie bat mich, Platz zu nehmen, ich würde gleich abgeholt. Also setzte ich mich hin und begann in den üblichen Zeitschriften für Hypochonder zu blättern, welche wohl in jedem Spital und in jeder Arztpraxis herumliegen. Nach 5 Minuten hatte ich diagnostiziert, dass ich wohl unbedingt eine Auszeit in einer Wellnessklinik im Schwarzwald brauchte, wollte ich nicht frühzeitig ableben. Birkenteeinläufe schienen ja etwas ganz Tolles zu sein. Noch bevor ich deren Angebot genügend studieren konnte, näherten sich mir zielstrebig zwei Individuen in Uniform.
„Herr Roulier?“ Der eine Polizist, ein Hüne von fast zwei Metern mit beeindruckenden Oberarmen baute sich vor mir auf und blickte mich streng an. Der andere blieb auf meiner Seite stehen und hielt eine Hand an der Waffe. Hoppla!
Da schien etwas aus dem Ruder zu laufen. Ich blickte den Hünen an. „Was ist los? Ich bin gerade gekommen.“
„Was heisst hier „gerade“?“
„Vor 5 Minuten.“
„Wie sind sie gekommen?“
„Mit dem Tram“, erwiderte ich. Langsam begann ich zu ahnen, dass ich in etwas Gravierendes hineingeraten war.
„Zeigen Sie uns ihre Fahrkarte!“ Klassisches Verhalten: Beweise sammeln.
„Ich habe ein Abonnement.“
„Woher kennen Sie Herrn Werren?“
„Hören Sie, wenn das so etwas wie ein Verhör werden soll, dann sagen sie mir gefälligst, worum es hier geht. Ich habe keine Lust, hier irgendwelche Fragen zu beantworten, solange ich nicht weiss, was Sache ist. Entweder sie sagen mir sofort, weshalb sie mich befragen oder ich sage gar nichts mehr. Sie können es sich aussuchen.“
Er tauschte kurz einen Blick mit seinem Kollegen aus, dieser nickte unmerklich. Er wandte sich mir wieder zu und sagte bedeutungsvoll: „Herr Werren ist tot. Aus dem 4. Stockwerk auf Beton geknallt. Deshalb möchten wir von ihnen wissen, weshalb sie ihn treffen wollten.“
Ich überlegte kurz und erklärte den eifrig notierenden Beamten die Sachlage. Der Hüne schien nicht nur Muskeln, sondern auch ein wenig Grips zu besitzen und versuchte mit geschickten Fragen zu ergründen, was der Grund von Werrens Anfrage hätte sein können, aber ich konnte ihm nicht dienen. Ich antwortete ihm ganz offen und gab die Telefongespräche fast wörtlich wieder, was ihn zu einem anerkennenden Nicken veranlasste. Ich merkte mir seinen Namen: Korporal Robert Bucher.
„Handelt es sich hier um Mord?“ fragte ich nach.
„Um eine Untersuchung eines Todesfalls. Wir können und dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Tatsache, dass er bei ihnen Hilfe holen wollte, deutet allerdings darauf, dass wir die Umstände des Todes genau untersuchen müssen. Wir behalten uns vor, sie noch einmal zu befragen und bitten sie, uns zu melden, falls sie die Region in der nächsten Zeit verlassen wollen.“
Ich bat Korporal Bucher, mir doch eine schriftliche Verfügung zukommen zu lassen, was meine Mobilität betraf – ich erklärte ihm auch, dass meine berufliche Tätigkeit zuweilen grössere Verschiebungen erforderte. Er zuckte mit den Achseln und merkte lächelnd an, dass es hierbei noch nicht um ein formelles Gebot handelte, sondern um eine dringliche Empfehlung. Er könne sich aber durchaus vorstellen, dass der Untersuchungsrichter meine Bewegungsfreiheit massiver einschränken könnte. Na toll!
Er wandte sich mir vor dem Weggehen noch einmal kurz zu und blickte mir direkt in die Augen:“Ich danke ihnen für ihre Kooperation. Falls sie noch irgendetwas finden, was uns weiterhelfen könnte, teilen sie es doch mir mit. Hier haben sie meine Karte. Wenn ich einmal etwas für sie tun kann, lassen sie es mich wissen. Tragen Sie mir doch bitte ihr Mail und ihre Telefonnummer in die Agenda ein. Er reichte mir seine Agenda und einen Kugelschreiber und ich kritzelte meine Koordinaten hin.
Gar nicht bullenüblich, der Junge!
Okay, wieder ein Auftrag flöten gegangen. Ich schnappte mir das nächste Tram und kehrte zum Büro zurück. Dort machte ich 2 Telefonate, das eine zu einem Assistenten des Gerichtsmedizinischen Instituts, der mir noch einen Gefallen schuldete und einen zweites zu Pit Frautschi, einem meiner Freelancer. Er sollte im Viktoria-Spital Gerüchte einholen.
Danach studierte ich die Website des Spitals und machte eine 3-stündige Internet-Recherche. Das Viktoria-Spital war vor 14 Monaten von einer grösseren US-amerikanischen Spitalgruppe übernommen worden. Im Rahmen der internen Optimierung der Spitalgruppe war man daran zu evaluieren, welche Dienstleistungen in welchen Spitälern als Kernkompetenzen zu betrachten seien. Der CEO der Gruppe, Holger Wennstrom, ein US-Amerikaner mit schwedischen Wurzeln, hat den 3 Spitalregionen Deutschland, Dänemark und Schweiz klare Vorgaben bezüglich der finanziellen Resultate gemacht. Er galt als profunder Kenner des Gesundheitswesens und hatte bereits etliche Erfolge als Mitarbeiter und zuletzt als CEO des US-Gesundheitskonzern V-Care zu verzeichnen. Er war bekannt für radikale und konsequente Vorgehensweisen und finanzielle Erfolge. Angefangen hatte er als Berufssoldat bei den US-Streitkräften als Logistik-Sergeant bei den Sanitätstruppen, wurde aber nach 3 Jahren von einem kleinen Medizinalproduktehersteller abgeworben. Dort wurde er im Aussendienst eingesetzt. Seine Spezialität war Beratung von militärischen Kunden hinsichtlich medizinischen Armeematerials. Anfangs 80er-Jahre zog er den grossen Fisch an Land: Während die USA dem Irak rund hundertfünfzig Kampfhubschrauber lieferten gründete Wennstroms Unternehmen eine Tochterfirma in Israel und belieferte via den Iran mit Medikamenten, Verbandsmaterial bis hin zu ganzen Feldspitalsausrüstungen – wohl um die von modernen Kampfhubschraubern zusammengeschossenen Iraner wieder zusammenzuflicken. Innert weniger Monate hatte sich der Umsatz verhundertfacht. Wennstrom wurde Vizedirektor und Teilhaber des Unternehmens, das sich mittlerweilen V-Care nannte und in den folgenden Kriegen am Golf, im Balkan, in Afghanistan kräftig mitverdiente. Von da an liest sich sein Lebenslauf wie eine Erfolgsstory in „Forbes“. V-Care dehnte sein Tätigkeitsfeld aus, baute Spitäler, Altenheime, Ambulatorien und wurde zu einem Konzern mit einer 9-stelligen Bilanzsumme. Und zuoberst thronte der ehemalige Logistik-Sergeant Wennstrom.
2 Mal war V-Care in die Schlagzeilen geraten: Einmal wurden 5‘000 verunreinigte Venenkatheter ausgeliefert. Folge davon waren 17 Blutvergiftungen mit 2 Todesfällen. V-Care konnte froh sein, dass dies in Eritrea geschehen war und die dortige Gesetzgebung in Hinsicht auf solche Verfehlungen gelinde gesagt milde bis inexistent war. Die Sache hatte V-Care zwar nur eine tiefe siebenstellige Dollarsumme gekostet (der Löwenanteil war die Rückruf-Aktion und das Schmieren der Behörde). Die Publizität hatte allerdings bewirkt, dass der Aktienwert innert einer Woche um 18% gesunken war. Daraufhin hatte V-Care ein Budget von 25 Millionen Dollar gesprochen, um sämtliche relevanten Betriebe nach den ISO-Normen 13485 (Zertifizierung der Qualitätsmanagementsysteme von Medizinprodukteherstellern) und ISO 15378 (Zertifizierung von Primärverpackungen für Arzneimittel mit Referenz zu GoodMedicalPractice-Regeln) zertifizieren zu lassen. Zusätzlich wurde die Erfüllung dieser Forderungen innerhalb eines Jahres von allen Lieferanten gefordert. Eine renommierte Schweizer Firma überprüfte all diese Firmen eingehend und deckte Schwachstellen auf, die umgehend behoben wurden. Seither hatte sich kein nennenswerter Zwischenfall mehr ereignet.
Beim zweiten Mal war eine Schlammschlacht nach der Entlassung eines Direktionsmitglieds ausgelöst worden. Earl C. Jones, Mitglied der Geschäftsleitung, Ressort Logistik, hatte nach seiner Entlassung schwerwiegende Vorwürfe gegenüber seinem früheren Arbeitgeber erhoben. Er warf V-Care vor, bewusst teuer im eigenen Konzern einzukaufen und damit Konsumenten und Versicherungen zu schädigen. V-Care konnte aber nachweisen, dass in jedem Falle Gegenofferten eingeholt worden waren und V-Care sich im Sinne der Kunden verhalten hatte. Es kostete mich gerade mal 30 Minuten um herauszufinden, dass V-Care Leute auch in den Aufsichtsgremien der sogenannten Konkurrenz Einsitz hatten und auch Aktien im Besitze von V-Care Exponenten waren. So viel zum Einholen neutraler Offerten. Earl C. Jones war offensichtlich dem Stress einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung nicht gewachsen und verstarb in seinem Heim in Miami an einem Herzinfarkt, den er unglücklicherweise beim Schwimmen im hauseigenen Pool erlitt. Seine Haushälterin fand ihn am Morgen, die Autopsie ergab ein klares Herzversagen. Daraufhin fand sich niemand, der den Prozess hätte weiterführen wollen und die Akte wurde geschlossen.
Ich druckte die jeweiligen Seiten aus und legte sie in einem Dossier ab. Daraufhin schickte ich dem Regionsleiter Germany & Switzerland von V-Care, Dieter Jannsen, ein Email ab, in dem ich folgendes festhielt:
An… <[email protected]>
Von… <[email protected]>
Betreff: Todesfall M. Werren
Sehr geehrter Herr Jannsen
Ich bedaure das Hinscheiden ihre Mitarbeiters M. Werren. Sie sollten folgendes wissen: Vor 24 Stunden rief mich Herr Markus Werren aus der Klinik Viktoria, die zu ihrer V-Gruppe gehört, an. Ich bin privater Ermittler. Er bat mich zu einem Treffen, ohne mir vorerst Gründe dafür anzugeben. Heute früh um 11.00 rief er mich wieder an und bat um ein sofortiges Treffen. Am Telefon hat er mir ein paar Dinge mitgeteilt, die mir nicht unwesentlich scheinen. Als ich mich um 1300 beim Spital einfand und nach Herrn Werren fragte, war dieser bereits tot, wie Sie ja sicher wissen. Die Polizei hat mich vernommen, ich habe ihnen jedoch nur erklärt, dass Herr Werren mich unbedingt in einer nicht definierten Angelegenheit zu Rate ziehen wollte. Falls Sie daran interessiert sind, mehr Informationen zu erhalten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Bernard Roulier, Privater Ermittler“
Ich gähnte, schaute auf die Uhr: 19:17 Uhr. Zeit für einen Aperitif und etwas zum Essen. Ich hatte nichts erledigt, einen potenziellen Kunden verloren und fischte im Trüben. Das schrie nach einem Chardonnay im „Klötzlikeller“. Vielleicht ja noch nach einer Schüssel Moules mit Knoblauch im „Camargue“?
Als ich um 21.00 nach Hause kam, hatte mich meine Nachbarin abgefangen. Sie trug so etwas wie einen Strickmantel aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts und war aus dem Häuschen:“ Sie können sich gar nicht vorstellen was geschehen ist!“, jammerte sie. Eigentlich wollte ich das ja auch nicht… „Heute ist mein Inserat in der Zeitung erschienen und dann hat sich dieser… dieser Mensch bei mir gemeldet!“ Ihre Stimme zitterte vor Empörung. „Dieses Scheusal …. Hat bei mir geklingelt und sich erfrecht…“ „Beruhigen sie sich!“ Ich hob beschwichtigend die Hände und musste zart aufstossen. Der Knoblauch.
„Er… er verlangte FINDERLOHN!“ Sie zischte das Wort durch die Lippen, als wäre es die grösste Obszönität.
„Finderlohn? Wie kommt er dann darauf??“
„…. Das Inserat. Im Inserat stand, dass ich Finderlohn bezahle. Dabei ist er als Hauswart ja für seine Liegenschaft verantwortlich! Wahrscheinlich war er es, der Mitzi eingesperrt hat! Das ist doch nicht in Ordnung, oder?“
Innerlich brüllte ich vor Lachen. Das war genau das, was mir noch gefehlt hatte, um wie ein satter Säugling einzuschlafen. Friede auf Erden.
30. Dezember
An… <[email protected]>
Von…<[email protected]>
Betreff: Werren
Lieber Bernard
Werren war ein äusserst exakter und wegen seines ausgeprägten Sparticks und seines pingeligen Wesens unbeliebter Spitaladministrator. Er ist vor knapp 2 Jahren eingestellt worden, Betriebswirtschafter FH, zuvor in einem Diako-nisssenhaus in St. Gallen als Leiter Finanzen tätig, geschieden, 2 Kinder mit Besuchsrecht. Keine Einträge auf Facebook & Twitter. Keine Freundin, Gerüchte über Homosexualität im Umlauf, aber nichts Konkretes auffindbar. Fährt einen SMART, spielt Golf und ist im Vorstand eines Oldtimerclubs aktiv. Am Mittag immer im Spitalrestaurant gegessen. Kirchengänger bei der Landeskirche, auch dort im Kirchgemeinderat aktiv. Bis auf das unbestätigte Gerücht ein wahrer Musterknabe. 2x je eine Krankenschwester ausgeführt, gilt als knausrig und beide Male bleib es bei einem Essen. Anscheinend ein Langweiler. Oberleutnant bei den Luftschutztruppen. Datenschutzfreak, dauernd am herummäkeln. Bestand darauf, dass alle Mitarbeiter ihre persönlichen Passwörter monatlich wechseln, er selber machte das wöchentlich. Polizei hat seinen PC beschlagnahmt, kommt aber nicht an alle Daten heran, da Werren 3 Tage vor seinem Todestag das Passwort ersetzt und dem SysAdmin nichts mitgeteilt hat. Daher können Einträge mittels Desaster Recovery nur bis zum 26. gelesen werden, 24.-26. war er aber nie am Arbeitsplatz. Die Polizei setzt einen Spezialisten ein, um an die Daten heranzukommen.
Wundere dich nicht über die Spesen, musste 2 seiner Mitarbeiterinnen ausführen und locker machen ;-)
Gruss
Pit
Betreff: Re:Werren
Hallo Pit
Danke für die rasche Arbeit! Bezüglich Spesen: Die einen lassen den Charme sprechen, die anderen müssen Frauen betäuben…
Gruss
Bernard
Am Nachmittag führte ich die zweite Serie Einzelinterviews bei TF-Officeline durch. Die Sitzordnung war klar übers Eck. Nie frontal, das wirkt angriffig. Ich bedankte mich bei jedem einzelnen Mitarbeiter zuerst und versicherte ihnen, dass der Täter nur gefasst werden könne, wenn sie uns ihre Beobachtungen und Hypothesen mitteilen würden. Ich gab jeweils meine Karte ab und bat sie, mich doch zu kontaktieren, wenn ihnen etwas Wesentliches später in den Sinn kommen sollte. So machte ich sie zu Zeugen und Ermittlern für den Betrieb und nicht zu Verdächtigen. In der Regel klappte das gut und sie können sich auf Nebenschauplätzen tummeln, während man unauffällig ein paar Kernfragen einstreuen konnte. Das mit dem Video erklärte ich so, dass sonst angezweifelt werden könnte, dass sie so etwas gesagt hätten und ein Wortprotokoll zu aufwändig wäre. Somit diene das Video quasi zu ihrem Schutz. Die Kamera war diskret positioniert und nach kurzer Zeit wurde sie ignoriert. Ich begann immer mit den gleichen Anfangsfragen:
1. Stört sie die Kamera?
2. Haben sie sich freiwillig gemeldet, eine Aussage zu machen?
3. Sind sie mit ihrer jetzigen Arbeitssituation zufrieden?
Die erste Frage müsste eigentlich mit „Ja“ beantwortet werden, die 2. Mit „Nein“, bei der dritten Frage wusste ich vom Personalchef, wer zufrieden war und wer nicht. So konnte ich bereits zu Beginn feststellen, ob jemand log und wie Mimik, Gestik und Tonfall beim Lügen waren.
Es wurde ein anstrengender Nachmittag.
31. Dezember
Haben Sie schon jemals morgens um zwei Uhr nach dem Verzehr eines köstlichen, zartrosa gebratenen korsischen Wildschweinbratens (mit frischen Kräutern, reichlich Knoblauch und geriebenem korsischen Ziegenkäse, viertelstündlich mit einem Gläschen Codivarta begossen) und dem Genuss von 3 Flaschen Terre Brune und 3-4 Grappas von Elisi Barrique einen wissenschaftlichen Vortrag über Stochastik3 gehört?
Wahrscheinlich nicht und somit erspare ich Ihnen die technischen Details und beschränke mich auf das Wesentliche. Der Dicke versuchte mir wortreich und eindringlich zu erklären – nicht dass ihm eine gewisse Höflichkeit abhanden gekommen wäre - dass meine Methoden untauglich, unangemessen und veraltet wären – nett von ihm. Wären das Essen und der Terre Brune nicht so vorzüglich gewesen, hätte ich mir schon längst ein Taxi kommen lassen. Dass dies wohl einmal ein eher unrühmliches Kapitel in meinen Memoiren werden sollte, konnte ich damals ja noch nicht ahnen...
„Die Aufklärungsrate bei Verbrechen liegt je nach Delikt zwischen 20 und 94 Prozent!“, dozierte Zeus und fuchtelte wild mit dem Zeigefinger vor meinem Gesicht herum, „was jedoch absolut skandalös ist, ist die AufklärungsZEIT. Über 40% der Fälle werden erst nach 24 Monaten oder mehr geklärt! Dies ist gelinde gesagt katastrophal und spricht für meine Theorie!“ Er bot ein groteskes Bild. In seinem monastischen Bademantel, mit nassen wirren Haaren, Krümeln im Bart und Rinnsalen von Wein auf der rechten Kinnseite sah er wie der fleischgewordene Bacchus aus.
Als ich vor 2 Stunden bei ihm geklingelt hatte, war ich mitten in ein phantastisches Szenario geplatzt. Irgendein Chor sang wehmütige Lieder als sein Faktotum, ein gutangezogener, unrasierter alter Herr mit weissem Hemd und Fliege die Türe öffnete. Sein weisses Haar stand wirr ab. Er sah aus wie ein gefrorener Kaktus nach einem Stromschlag. Er führte mich in ein riesiges Wohnzimmer mit Kaminfeuer, einer Tonne mit 2 Metern Durchmesser, belegt mit Schaffellen. Daneben ein Zinkbottich. Darin lag Wallbach, umgeben von Schaum, und liess sich von einer jungen Asiatin im Bikini den Bauch schrubben. Sie war nicht ganz hässlich. Ich näherte mich dem wallbachschen Bottich. Jetzt erst erblickte mich Zeus, stiess ein begeistertes Lachen aus und erhob sich mühsam. Mein Gott! Die Geisha begann ihn unverzüglich abzutrocknen, wobei sie nicht übertriebene Scham vor heikleren Körperteilen an den Tag legte. Er wickelte sich in ein zirka eine Are grosses Badetuch, was seinem Körperumfang durchaus angemessen schien. Sein Faktotum verschwand im Nebenzimmer und kehrte mit einem überdimensionierten schwarzen Bademantel mit dem goldenen Monogramm TZW zurück. Zeus schlüpfte umständlich hinein und wälzte sich auf mich zu, wobei er kleine Pfützen aus Schaum und Wasser hinter sich zurückliess. Offensichtlich hatte die Geisha diverse Körperteile übersehen.
„Mein Freund, mein Freund!“ skandierte er begeistert.
Na ja. Begrüssen sie mal eine Siebteltonne offensichtlich angetrunkenes und plitschnasses Fleisch auf angemessene Weise. Meine Strategie war, meine rechte Hand so weit wie möglich auszustrecken, um mich mittels Händedruck elegant aus der Affäre zu ziehen. Fehlanzeige. Er zerquetschte meine rechte Hand, zog mich an sich, legte seinen linken Arm um mein Genick und umarmte mich in offensichtlicher Unkenntnis biomechanischer Vorgänge. Dazu stiess er Begeisterungslaute aus, die dem Paarungsruf des Schabrackentapirs nicht unähnlich klangen.
Nach 2-3 Sekunden stellte ich fest, dass ich doch noch nicht zur Tetraplegie verdammt zu sein schien und konnte mich mittels eines heftigen Leberhakens – für Zeus offensichtlich ein freundschaftlicher Klaps – so weit befreien, dass ich wieder atmen konnte. Meine rechte Hand würde nach 2-3 Wochen sicher wieder gebrauchsfähig sein.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen würden, lag immerhin bei über 60%. Da ihre derzeitige Freundin mit ihren Eltern im Engadin weilt, ist sie auf über 76% gestiegen. Und schau her, da sind sie!“
Das Faktotum – sein Name war anscheinend Jules – brachte mir ein Glas Champagner. „Auf das Abenteuer!“ prostete mir Wallbach zu und leerte seinen Kelch in einem Zug. Ich blieb ein wenig vorsichtiger und begnügte mich mit einem Schlückchen.
„Erst das Essen und dann das Geschäft! Jules, du kannst auftragen.“ Er zeigte keinerlei Anstalten, sich umzukleiden und setzte sich an einen 2 x 4 Meter grossen, massiven Holztisch. Ich kniff mich diskret in den Arm um mich zu vergewissern, dass ich nicht träumte. So habe ich Zeus näher kennen gelernt….
Theodorus Zeus Wallbach war am 17. Dezember 1967 in Linz geboren worden. Seine Eltern gehörten der Oberschicht an, sein Vater war ein bekannter Anwalt und Lokalpolitiker, seine Mutter stammte aus einer vermögenden Familie und hatte genug Zeit und Geld, um trotz ihres Geschichtsstudiums lediglich adäquate gesellschaftliche Anlässe zu besuchen und sich im karitativen Bereich zu betätigen. Im Sommer wohnten sie meist in ihrem Herrschaftshaus mit 15 Hektaren Parkanlage, sie beschäftigten eine Haushälterin, eine Köchin und einen Gärtner. Wie sein Grossvater wurde Zeus auf den Namen Theodorus getauft. Als einzige Folge von Mutters Geschichtsstudiums kam noch der Göttervatername dazu, von Verwandten darauf angesprochen erwiderte sie stets lakonisch, dass sich ein zweiter Vorname auf einer Visitenkarte gut mache.
Unbestrittener weise setzten beide Elternteile hohe Erwartungen in ihren einzigen Sohn. Es zeigte sich bald, dass dieser die Erwartungen in manchen Bereichen weit übertraf, in gesellschaftlich relevanten Fertigkeiten aber massiv renitent war. Zeus war stets der Klassenbeste, was in einer Österreichischen Elite-Schule nicht ganz selbstverständlich war. Betrüblicherweise waren da aber die ewigen Eskapaden, die nach 5 Jahren sogar in einem Schulausschluss gipfelten. Bereits in der ersten Klasse musste sein Vater mehrmals vor dem Oberstudienrat erscheinen. Ein Mal hatte Zeus sich geweigert, am Religionsunterricht teilzunehmen. Als er vor die heilige Inquisition – Oberstudienrat und Klassenlehrerin – zitiert worden war, fragten ihn diese, weshalb er denn nicht den Unterricht nicht mehr besuchen wolle. Der kleine Theo hatte stur vor sich hingestarrt und dann die blasphemischen Worte gesagt: „ Weil dies alles Lügen sind.“ Händeverwerfen, Schimpfen, Eltern her zitieren, Zetermordio!
Sein Vater hatte ihn zur Seite genommen und ihn gefragt, was den um Himmels Willen los sei?
„Die Geschichten. Sie stimmen nicht. Sie sind nicht logisch.“ Die Arche Noah war eine Lüge, weil ja gar nicht alle Tiere auf dem richtigen Kontinent waren. Termiten und Holzwürmer auch dabei waren. Die Speisung der Fünftausend war eine Lüge. Niemand konnte auf dem Wasser gehen. Schon gar nicht ein Meer teilen.
Elterliches Händeringen.





























