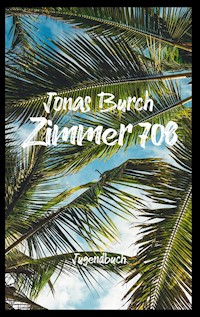
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zimmer 708 - ein Jugendbuch. Drei Wochen Hawaii. Nach seiner Schulzeit will der 19-jährige Tim einfach nur weg von zu Hause - ohne Freundin, ohne Eltern und ohne Verpflichtungen. Sein Zimmer 708 wird schnell zum Treffpunkt für Sprachschüler aus aller Welt: Auch für Isabel aus Kolumbien, die Tim sofort in ihren Bann zieht. Zum ersten Mal muss sich Tim damit auseinandersetzen, wer er eigentlich ist und wer er sein will. 'Zimmer 708' ist ein Buch für alle Jugendlichen dieser Welt und für alle, die es mal waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für alle Jugendlichen dieser Welt
Inhaltsverzeichnis
Endlich Freiheit
Ich, der Eliteschüler?
Die neue Pilgerstätte
Sorgen im Paradies
Und dann kam sie
Hat sie oder Hat sie Nicht?
Love is in the Air
Wovon träumst du?
Wie die Ruhe vor dem Sturm
Alles Gute zum Geburtstag
Sie bleibt ein Rätsel
Mein Leben, Dein Leben
Tim 2.0
Ich kann nicht mehr Warten
ENDLICH FREIHEIT
Sonntag, 3. Januar
Angekommen! Endlich. Am anderen Ende der Welt. Nach einem Flugmarathon von Zürich über Seoul nach Honolulu. Von sieben Zeitzonen voraus, wieder neunzehn zurück. Während meines x-stündigen Fluges habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie es sein wird, endlich hier zu sein. Ohne meine Freundin, ohne meine Familie, ohne Prüfungsstress. Wenn man in diesen x-Stunden kein Auge zugetan hat, kommen etliche Gedanken hoch. Immer und immer wieder. In Endlosschlaufe. Letztlich wollte sich kein „Genau-so-wird-essein“-Szenario in meinem Hirn festsetzen. Zu unberechenbar und unvertraut ist mir diese neue Welt fernab der Heimat.
Was ich jedoch unerwartet stark wahrnehme, ist dieses intensive Gefühl der Freiheit. Ich deute es jedenfalls so, weil es sich so unbekümmert und leicht anfühlt. Schon komisch, offensichtlich spüre ich zum ersten Mal so etwas wie Freiheit in meinem Leben. Vielleicht ist es auch nur eine Mischung aus Nervosität und Vorfreude. Jedenfalls bin ich nun hier, in diesem winzigen Farbtupfer inmitten des gigantischen Pazifiks.
Am Flughafen nimmt das Leben unaufgeregt seinen Lauf, als wäre es ein beliebiger Ort auf dieser Welt. Wahrscheinlich ist es das schon längst: Honolulu, Rio de Janeiro, Bali – die weite Welt ist für uns nur noch ein Mausklick entfernt. Selbst für einen frischgebackenen Schulabgänger wie mich. Trotzdem hatte ich vor der Ankunft all diese Bilder aus dem Fernsehen im Kopf: Klischees von lachenden Hula-Tänzerinnen und Ukulele spielenden Einheimischen.
Auf dem Weg zum Ausgang des Flughafens erlebe ich dann das genaue Gegenteil von Hula und Ukulele: Menschen rennen mit verschwitzten T-Shirts und knallrotem Sonnenbrand durch die grauen Hallen, während genervte Passagiere in einer kilometerlangen Schlange auf ihren Check-in warten. Wirklich glücklich und zufrieden scheint hier niemand zu sein. Solche Bilder wurden damals im TV nie gezeigt.
Die vielen Menschen am überfüllten Flughafen verderben mir zwar nicht die Laune, aber es macht mich noch müder. Alles zieht an mir vorbei, als wäre es eine Art Computerspiel. Ich schliesse die Augen, um mich zu erinnern, wo ich überhaupt hingehen muss. Tief durchatmen. Erst mal Gepäck holen, anschliessend werde ich von jemandem aus der Sprachschule beim Hauptausgang abgeholt. So steht es im E-Mail, das ich ausgedruckt im Handgepäck mitgenommen und während meines Fluges mindestens zehn Mal gelesen habe.
Zum Glück geht die Passkontrolle schnell voran. „Viel Spass in Hawaii“, lächelt die Flughafenpolizistin und winkt mich durch. Da war es! Das erste Lächeln auf der Insel. Damit betrete ich offiziell Boden der Vereinigten Staaten von Amerika. Weiter geht’s zur Gepäckausgabe, die nur wenige Meter von der Passkontrolle entfernt ist. Mein Puls schlägt höher, denn von der Gepäckausgabe kann ich bereits den Hauptausgang sehen. Hinter diesem Ausgang startet mein Abenteuer, auf das ich mich seit Monaten so sehr gefreut habe. Vom Flughafen Zürich nach Honolulu sind es etwa 12‘000 Kilometer. Jetzt sind es noch 20 Meter. Nach wenigen Minuten Wartezeit – mir kommt’s vor wie Stunden – nimmt das Laufband Fahrt auf. Ich schnappe meinen Koffer und laufe in Richtung Ausgang.
Als sich die breite Türe öffnet, warten bereits Dutzende Menschen auf die Ankömmlinge. Kleine Kinder mit Stofftierchen und Ballons, Männer mit Blumensträussen, Chauffeure mit Hemd, Krawatte und Namensschild. Sich in diesem Wirrwarr an Namen und Willkommensgeschenken einen Überblick zu verschaffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Beim langsamen Vorbeigehen versuche ich auf jedem Schild meinen Namen oder einen sonstigen Hinweis zu erkennen: „George Hansen“, nein, „Mr. Parker“, nein, „Li Shen“, definitiv nein.
Während ich den Schilderwald von oben nach unten durchforste, höre ich aus der Ferne eine Frauenstimme mit breitem, amerikanischem Akzent: „Tim, Tim, Tim, bist du’s?“
Wie ein verwirrter Tourist blicke ich fragend umher, bis ich einige Meter abseits eine Frau entdecke, die wild mit ihren Händen fuchtelt.
„Tiiiim, hallo, Tiiiim!“, ruft sie erneut.
Ich winke kurz zurück und gebe ihr mit einem Daumen hoch klar zu verstehen, dass ich wirklich dieser „Tiiiiim“ bin, dessen Namen nun alle Menschen in der Eingangshalle kennen.
„Alohaaaa, willkommen auf Hawaiiiii!“, kreischt es mir entgegen, auch wenn sich der Abstand zwischen uns auf wenige Schritte reduziert hat. Ich bin überrascht, dass in einer so zierlichen, 1,50-Meter grossen Frau eine solche Energie steckt. „Du bist also Tim, ja? Mein Name ist Lizzy, ich bin die Direktorin deiner Schule“, sagt sie und hängt mir im selben Atemzug, auf den Zehenspitzen stehend, einen traditionell-bunten Hawaiikranz um. Lizzy erfüllt alle Merkmale einer Schuldirektorin: Brille, gelocktes, blondes Haar und ein direktes, fast schroffes, aber überzeugendes Auftreten. Angesteckt von Lizzy‘s Energie, gebe ich ein ebenso ausgedehntes „Alohaaaaa“ zurück. Meine ersten Worte seit der Ankunft.
Nach den üblichen „Wie-war-dein-Flug?“-, „Bistdu-das-erste-Mal-auf-Hawaii?“- und „Wie-ist-das-Wetter-in-der-Schweiz?“-Fragen unterbricht Lizzy unser Gespräch für ein krächzendes „Aleeeeks, hallo Aleeeeks“. Das kenne ich von irgendwoher. Wie auf Knopfdruck, spult Lizzy nochmals dieselben Worte mit langem „Alohaaaa“ und „wiiiillkommen“ ab. Seine Reaktion? Wortloses, verlegenes Zunicken. „Dann sind wir ja komplett“, strahlt Lizzy und hängt auch Aleks das knallige Plastikgeschenk um den Hals. Mit seinen langen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren und dem breiten Körperbau wirkt Aleks wie ein amerikanischer Profisurfer. Das markante, kantige Gesicht erinnert mich wiederum an meine Fussballfreunde aus dem Balkan. Ein sympathischer Mix.
„Schaut zu, dass ihr als Schweizer nicht zu viel Deutsch sprecht, sonst lernt ihr kein Englisch!“, sagt Lizzy.
„Ah, du bist auch aus der Schweiz?“, fragt Aleks sofort.
„Ja, aus dem Aargau. Du?“
„Bern!“, antwortet Aleks. „Und du heisst also Tim?“
„Ja, genau. Und du Aleks?“
„So ist es. Freut mich!“, sagt Aleks mit einem kräftigen Händedruck.
„Wie war das nochmals mit dem Deutsch und Englisch?“, fragt Lizzy halb grinsend, halb drohend.
Nach zwei Gehminuten sind wir bereits im Parkhaus. Lizzy öffnet die Autotüren ihres grauen Jeep Cherokees und lässt uns einsteigen. Noch auf dem Weg aus dem Parkhaus erkundigt sich Aleks bei Lizzy vorsichtshalber, ob Bier trinken in der Öffentlichkeit erlaubt sei und wie man sich in groben Zügen das hawaiianische Nachtleben vorstellen müsse. Fragen, die ich mir heimlich ebenfalls ein paar Mal gestellt habe. Ich spüre, dass sich hier eine grosse Freundschaft entwickeln könnte.
Unsere 30-minütige Fahrt führt kurz vor den berühmten Waikiki Beach, wo ich die nächsten drei Wochen leben werde. Noch wirkt alles, was in den letzten Minuten passiert ist, total absurd. Meilen vor uns strecken sich die Wolkenkratzer von Honolulus Downtown in die Höhe, typisch Amerika, aber für mich als Schweizer tief beeindruckend. Ich kurble das Autofenster runter, frischer Wind bläst mir ins Gesicht. So fühlt sich Freiheit an! Auch die Landschaft imponiert: Rechts die Weiten des Meeres, links grüne Hügelzüge, welche eine natürliche Grenze zwischen Stadt und Natur bilden. Im Sog der Emotionen blicke ich zu Aleks, klopfe ihm auf die Schulter und sage:
„Das wird eine geile Zeit!“
„Definitiv Bro, definitiv.“
Lizzy hat uns zufälligerweise im Rückspiegel beobachtet.
„Kennt ihr euch eigentlich schon von irgendwoher?“
„Nein“, sagen wir.
„Ok, dafür wirkt ihr beide schon ziemlich vertraut.“
Aleks und ich schauen uns an und nicken einander zu.
Die Wolkenkratzer kommen immer näher und werden immer höher.
„Wir sind bald da“, sagt Lizzy und zeigt mit ausgestrecktem Arm, in welche Richtung wir noch fahren müssen. Wir tauchen ein in Honolulu Downtown, wo das Leben seinen geregelten Lauf nimmt. Männer in Anzügen – bei locker 30 Grad – hetzen durch die Strassen, Teenager halten sich an der Bushaltestelle die Smartphones vors Gesicht und Autofahrer hupen sich gegenseitig an. Erstaunlich, dass sich tausende Kilometer vom Festland entfernt eine solch moderne Grossstadt gebildet hat. Mit all ihren Vor- und Nachteilen. Surfer-Mentalität sucht man auf Honolulus Strassen vergebens.
Knapp zehn Minuten später kommen wir in unserem Wohnblock an. Ein grauer Turm so hoch, dass ich mir beim Hochschauen fast eine Nackenstarre zuziehe. Gut möglich, dass auf dem Gipfel dieses Betonriesen eine andere Klima- und Zeitzone herrscht. Lizzy hat uns erklärt, dass alle Studenten der Schule im siebten Stockwerk untergebracht sind. Nach einer kurzen Instruktion über Regeln und Gepflogenheiten, bekommen wir die Schlüssel zum neuen Reich.
In der kleinen Empfangshalle sitzt ein dicker, kauziger Angestellter hinter seinem Desk. In der Schweiz wäre die treffende Berufsbezeichnung Receptionist, in den USA sprechen wir von einem bewaffneten Sicherheitsmann. Das wirkt, neben der ohnehin schon unsympathischen Art des Mannes, gleich doppelt unsympathisch. Wir checken ein und steigen in einen der vier Lifte, die etwa drei Meter vom Desk entfernt sind. Das Benutzen der Treppen sei nur in absoluten Ausnahmefällen gestattet, trichtert uns der Securitysonderling mit Nachdruck ein. Willkommen in Amerika!
„Was meinst du, stossen wir nachher noch zusammen an?“, frage ich Aleks im Lift nach oben. „Du sprichst mir aus der Seele“, grinst er.
In den siebten Stock dauert es 10 Sekunden. Bing, aussteigen. Der Flur erinnert an ein stinknormales Hotel. Ein Zimmer reiht sich ans nächste. Hier wohnen also alle Studenten. Noch herrscht gespenstische Ruhe: Keine Geräusche, keine Party, keine Alkoholleichen, die nach einer durchzechten Nacht nicht mehr zurück ins Zimmer gefunden haben. Zur Entschuldigung: Es ist immerhin schon 15:55 Uhr.
Meine Zimmernummer ist die 708, etwa zehn Schritte vom Lift entfernt. Aleks muss weiter um die Ecke, ins Zimmer 714.
„Sehen wir uns in 30 Minuten auf dem Flur, okay?
Ich muss dringend duschen“, sage ich.
Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, atme tief ein und betrete mein neues Leben. Der erste Eindruck überzeugt. Gleich beim Eingang steht ein kleiner Kochbereich mit Kühlschrank, vier Herdplatten und einer kleinen Fläche, um notfalls Gemüse zu schneiden. Alles zweckmässig. Rechts vom Eingangsbereich geht’s zum Badezimmer. Die bräunlich-altmodischen Kachelmuster rund um die Armaturen und in der Dusche erinnern mich an Grossmutters Zeiten. Trotzdem: Auch hier alles in Ordnung. Ich gehe zurück, mache vier Schritte durch die „Küche“ und gelange ins Wohnzimmer, das Herzstück des Raums. Die Einrichtung kommt steril daher: Kleiner TV, kleines Tischchen mit Stuhl, vergilbter Teppichboden. Immerhin sammeln die grosse Fläche und das Doppelbett sofort Pluspunkte. Neben dem Bett gibt’s noch einen Balkonbereich mit einem weiteren Tischchen und zwei Stühlen. Platz hätte es aber noch für einige Stühle und Tische mehr. Der Zauber liegt sicher nicht in der Einrichtung, sondern darin, was mit dieser Einrichtung alles möglich ist.
Nach diesen Eindrücken lasse ich mich wie ein Stein aufs Bett fallen: neues Land, neue Leute, neue Wohnung. Jetzt brauche ich Ruhe, um das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Ich fühle mich überfordert. Vor rund 24 Stunden hiess es in der kalten Schweiz Abschied nehmen. Jetzt bin ich hier, als hätte die mühsame, stundenlange Anreise nur ein Wimpernschlag gedauert.
Neben dem Bett entdecke ich WLAN-Router und Passwort. Ich schreibe die obligatorische „Ich-binwohl-angekommen“-Nachricht an Mama, mit knallrotem Emoji-Herzchen versteht sich. Bei der Nachricht an meine Freundin nehme ich mir etwas mehr Zeit. Nicht ganz freiwillig. Um ehrlich zu sein, weiss ich nicht, was ich ihr schreiben soll: „Hey du!“, tippe ich ein. Naja, klingt irgendwie unpersönlich. Ich lösche den Text wieder und beginne mit: „Hey Schatz!“. Dann weiter mit: „Ich bin gut angekommen, die Wohnung ist hammer! Wie geht es dir? Ich vermisse dich jetzt schon!“
Wirklich überzeugt bin ich von meiner Nachricht nicht. Denn eigentlich geniesse ich schon jetzt diese unbekannte Freiheit. Trotzdem lasse ich das Whatsapp so stehen. Sicher ist sicher. Was bringt mir unnötige Unruhe? Ich schreibe lieber, was meine Freundin hören will, als das, was ich wirklich denke. Ist das fair? Nein! Aber das ist mir in diesem Moment völlig egal. Nach all diesen Nachrichten schaltet mein Kopf automatisch auf Standby.
Wie lange ich wirklich gedöst habe, weiss ich nicht, aber geweckt werde ich von einem energischen Klopfen an der Zimmertür. Genau zwei Menschen wissen, dass ich hier wohne: Aleks und der schräge Securitymensch vom Empfang.
„Aleks? Sag mir bitte, dass du das bist!?“, rede ich in Richtung Eingangstür.
„Ja, sicher! Wer denn sonst?“, tönt es durch die Tür.
„Nicht so wichtig!“
„Überraschuuuung“, grinst Aleks und wedelt mit einem 6er-Pack Corona. Ein Klirren der Freude.
„Pssst, nicht so laut!“, sage ich und halte meinen Zeigefinger vor den Mund.
„Ich darf hier in Amerika keinen Alkohol trinken.
Du weisst, Gesetz und so.“
„Was? Wie alt bist du denn?“, fragt Aleks geschockt.
„19! Ich muss aufpassen. Aber ist das Bier wenigstens kalt?“
„Kälter als die Polizei erlaubt!“
„Dann kann ich kaum nein sagen.“
Wenige Sekunden später weihen wir feierlich meinen Balkon ein.
„Ich bin gespannt auf die Leute morgen“, sagt Aleks und nippt an seinem Bier.
„Was wünschst du dir für Leute?“
„Zuerst einmal mehr Frauen als Männer. Und dann noch mehr schöne als weniger schöne Frauen“, lächelt Aleks.
„Hoffen wir’s. Warum bist du eigentlich hier? Schöne Frauen gibt es doch überall auf der Welt?“
Aleks zögert. „Weisst du“, sagt er und zögert erneut. „Ich bin 25 Jahre alt und habe eine intensive Zeit hinter mir. Jetzt muss ich mal ausspannen, nicht nur für eine Woche oder so, sondern wirklich ausspannen. Und je weiter weg von zu Hause, umso besser. Weisst du, was ich meine?“
„Ja, irgendwie schon“. Aber irgendwie auch nicht.
„Und du?“, fragt Aleks postwendend zurück, bevor ich über seine Gründe nachdenken kann.
„Ich habe gerade die Kanti abgeschlossen. Jetzt brauche ich auch Abstand. Zur Schule, zur Schweiz, zu allem. Sogar zu meiner Freundin.“
„Freundin???“
„Ja, sie heisst Olivia. Wir sind seit zwei Jahren zusammen, haben uns im Ausgang kennengelernt. Alles gut. Aber das ist jetzt mein Abenteuer!“
„Hältst du dich auch an die 1000er-Regel?“
„1000er-Regel?“
„Wenn du 1000 Kilometer von deiner Freundin entfernt bist, ist alles erlaubt, wenn du weisst, was ich mein.“
„Alles erlaubt? Nein, ich bin treu, das habe ich ihr versprochen.“
„Okay, guter Mann! Ich werde dich dabei unterstützen.“
„Du hast keine Freundin?“
„Nicht mehr, seit ein paar Monaten. Die ganze Geschichte erzähle ich dir ein anderes Mal“, sagt Aleks, nimmt den letzten Schluck aus der Bierflasche und verabschiedet sich per Handschlag.
„Ich bin dann mal weg, bis morgen, Bro!“
„Bis morgen, Aleks!“
Dann richte ich mich noch in der Wohnung ein, dusche endlich und entspanne. Besonders das Doppelbett gefällt mir immer besser, vor allem deshalb, weil ich zu Hause immer in einem kleinen Einzelbett geschlafen habe.
Ich checke nochmals die Infos für den ersten Schultag und versuche nach dieser Reise einfach nur zur Ruhe zu kommen. Licht aus. Auf dem Handy leuchtet eine Nachricht von Olivia:
„Ich vermisse dich auch, Schatz! Ich kann es kaum erwarten, bis du wieder bei mir bist! Ich liebe dich so fest.“ Die fünf Emoji-Herzchen zeigen mir gleich fünffach, dass sie das ernst meint. Ich schalte das Handy auf lautlos. Genug für heute.
ICH, DER ELITESCHÜLER?
Montag, 4. Januar
Um Punkt 7.30 Uhr werde ich vom Wecker aus dem Land der Träume geholt. Erstaunlicherweise fühle ich mich richtig ausgeschlafen. Wie auf Adrenalin steige ich unter die Dusche, putze meine Zähne und nehme ein paar sommerliche Kleider aus dem Koffer. Irgendwie verrückt: sommerliche Kleider im Januar! Aber heute sollen es angenehme 26 Grad warm werden. Einmal aus dem Zimmer, klopfe ich bei Aleks an die Türe.
„Hey Aleks! Und, alles klar?“, spreche ich durch die Türe, nachdem ich auf der anderen Seite ein paar Schritte höre.
„Voll, aber ein bisschen kaputt noch“, erwidert Aleks, während er langsam die Tür öffnet. „Komm mal rein, ich muss noch kurz die Zähne putzen.“
Aleks‘ Wohnung sieht aus wie eine Kopie von meiner. Nur hat Aleks seinen Koffer bereits komplett ausgeräumt und die zusammengefalteten Kleider in den einzelnen Fächern im kleinen Wandschrank verstaut. Ein Wandschrank im Zimmer? Mir ist fast peinlich, dass ich nicht weiss, ob so einer auch in meinem Zimmer steht.
„Also, bin so weit, gehen wir!", sagt Aleks und bindet sich seine vielen Haare zu einem Dutt zusammen.
Die Bushaltestelle „Seaside Avenue“, von wo aus wir zur Schule fahren, ist nur ein Steinwurf von der Unterkunft entfernt. Wäre mein Zimmer auf der anderen Seite des Hochhauses, könnte ich die Haltestelle sogar vom Fenster aus erkennen. Zu Fuss sind es jedenfalls fünf Minuten bis zu diesem kleinen grünen Bushäuschen, das nur aus einem einfachen Dach, einem zerkratzten Halteschild und einem unübersichtlichen Fahrplan besteht. Umgeben von modernen Hochhäusern und Läden wie Starbucks oder McDonalds, wirkt diese Haltestelle wie ein vergessenes Überbleibsel aus den 60er-Jahren.
Jedenfalls zähle ich vier Menschen, die mit Aleks und mir auf den Bus warten. Das Rätselraten beginnt: Sind das unsere neuen Schulkollegen? Oder nur jemand davon? Mein Blick schweift neugierig umher: Vielleicht der kleine Asiate da mit Fotoapparat und Anglerhut? Eher weniger. Das streitende Pärchen gleich daneben? Noch unwahrscheinlicher. Was ist mit dem älteren Halb-Hippie-Halb-Lebenskünstler, der verwirrt den Fahrplan studiert? Hoffentlich nicht! Bei der Ankunft des Busses bleibt weiterhin alles eine grosse Überraschung. Es kribbelt im Bauch.
Im Bus fühlt man sich wie in einem fahrenden Irrenhaus: Die ersten Sitzreihen sind eigentlich für Ältere und Leute mit einer körperlichen Beeinträchtigung reserviert. Wie auch immer „Beeinträchtigung“ in den USA definiert wird, döst ein Amerikaner mit einem Körpergewicht der Kategorie „Das-glaube-ich-erst-wenn-ich-es-miteigenen-Augen-gesehen-habe“ auf dem erst besten Platz neben dem Chauffeur vor sich hin. Oder passender: auf den erst besten Plätzen. Im Mittelteil werde ich von einem verwirrten Bibelprediger gesegnet (oder verflucht?), jedenfalls benutzt der Hobbymessias das Wort „Jesus“ öfter als Zlatan Ibrahimovic das Wort „ich“. Nach langem Blickkontakt wendet sich der bärtige Greis von mir ab und empfängt die nächsten Fahrgäste mit Zeilen aus dem Alten Testament. Halleluja! Im hintersten Teil finden Aleks und ich endlich eine mehr oder weniger ruhige Sitzgelegenheit.
„Die schönen Frauen lassen noch ein bisschen auf sich warten“, sagt Aleks kopfschüttelnd.
„Würdest du als schöne Frau freiwillig in dieses Fasnachtsmobil einsteigen?“, frage ich Aleks. Er schüttelt nochmals seinen Kopf.
Auf dem Weg zur Schule fahren wir an unzähligen Strassen vorbei, von denen keine den Postkartenglanz Hawaiis versprüht. Auch hier nimmt das Leben seinen Lauf: ein paar Kinder steigen ein und nach ein paar Stationen bei der Grundschule wieder aus, andere hetzen in letzter Sekunde auf den Bus. Die Umgebung wirkt karg, an den Gebäuden bröckelt die Fassade ab. Nur die hochgewachsenen Palmen sorgen ansatzweise für exotische Stimmung.
„Endlich hier“, sage ich erleichtert, als wir in Honolulu Downtown ankommen.
„Kann man diese Schule auch als Fernstudium besuchen, ohne je wieder in diesen Bus steigen zu müssen?“, witzelt Aleks.
Wir steigen aus. Durch die neuen Eindrücke sind die 25 Minuten Fahrzeit wie im Fluge vergangen. Aleks zieht das Infoblatt aus der Hosentasche, das in groben Zügen den Weg zur Schule beschreibt. „Geradeaus, dann zwei Mal links, dann sollten wir dort sein“, sagt er und zeigt mir mit dem Finger den Weg auf der verpixelten Karte.
Nach fünf Minuten Fussweg durch die Hochhausschluchten stehen wir vor dem Ziel. Also eigentlich vor einem weiteren, himmelhohen Gebäude in dem irgendwo die Schule untergebracht sein soll. Ich seufze vor mich hin, nichts da mit der tropischen Schule am Strand, umgeben von einem hübschen Garten und Meeresrauschen im Hintergrund. Im Hochhaus steigen wir im 3. Stock aus dem Lift, Treppen scheinen auch hier nur als Notausgänge zu dienen. Der Aufzug führt uns direkt in den Eingangsbereich der Sprachschule.
Mein erster Eindruck? Überzeugend! Denn wir werden gleich mit einem Willkommensspiel empfangen: Alles dunkel und gruselig aufbereitet, ein Geisterbahngefühl in Perfektion.
„Aloha auf Hawaii“, brummelt eine tiefe Stimme aus dem Nichts vor sich hin. „Wie heisst ihr denn?“, will die schwarze Gestalt hinter dem Pult wissen. Spätestens jetzt erinnert die Szene an einen billigen Horrorfilm. Hollywood in Honolulu. „Füllt dieses Formular aus, dann dürft ihr eintreten“, murmelt die Stimme und händigt uns zwei Blätter aus. Es kommt mir vor, als würde ich soeben meine Sterbeurkunde unterschreiben. Als plötzlich ein Lichtstrahl die Dunkelheit durchbricht, bin ich entweder im Himmel oder jemand hat erkannt, dass geöffnete Rollläden einem Raum deutlich mehr Tageslicht spenden als geschlossene.
Gleich beim Empfang um die Ecke muss der Aufenthaltsraum sein, in dem sich, gemäss Infoblatt, alle Neuen versammeln. Auf geht’s. Wie in einem Labyrinth suche ich den schnellsten Weg dorthin, durchquere eine Art Küche, begegne diversen Wesen aller Körpergrössen und Hautfarben und komme dann endlich beim Treffpunkt an. Der Raum ist eine Mischung aus Kindergarten und Brockenstube: An den Wänden hängen schiefe Bilder von hawaiianischen Inseln, dazwischen grinst der „Student des Monats“ auf einem kitschigen Plakat, das mit dem vor 15 Jahren schon aus der Mode gekommenen „WordArt“ gestaltet wurde. Die Tische im Raum sind mindestens so alt wie Hawaii selbst und die zehn verschiedenen Stuhlmodelle von unbequem bis sehr unbequem passen ebenfalls ins Gesamtbild. In dieser chaotischen Einrichtung liegt wohl auch der Charme. Mir gefällt’s, irgendwie. Aleks flüstert mir noch das Wort „Altersheim“ ins Ohr, aber ich habe noch nie ein Altersheim ohne natürliches Tageslicht gesehen.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















