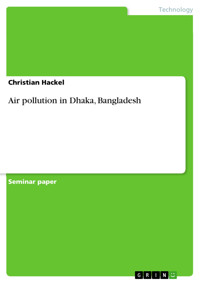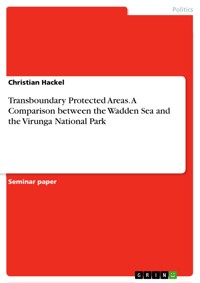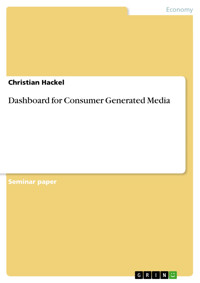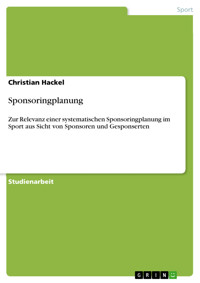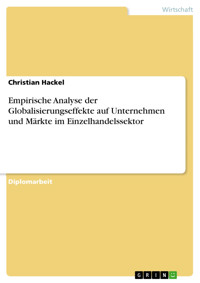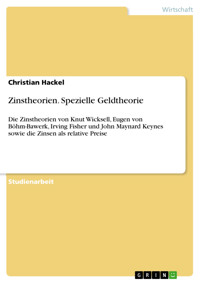
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 2,0, Universität zu Köln, Veranstaltung: Spezielle Geldtheorie, Sprache: Deutsch, Abstract: Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, so fällt auf, dass die Betrachtung des Zinses nicht von Anfang an wirtschaftlicher Natur war, wie es die Vermutung nahe legen würde. Es waren vielmehr die Philosophen und Religionsvertreter die sich zuerst dem Zinsphänomen annahmen. Bereits Aristoteles setzte sich vor mehr als 2000 Jahren auf philosophischer Ebene mit dem Zins auseinander und kam zu dem Schluss, dass die Vermehrung von Geld durch dessen bloße Verleihung naturwidrig sei, da er Geld für von Natur aus unfruchtbar hielt. Die Kirche sah es ihrerseits für Christen als verwerflich an von ihren Brüdern Zinsen zu nehmen und bezeichnete diese als Wucher. Diese tief verwurzelte kirchliche Lehre führte daher zur Verankerung des sogenannten Zinsverbots, welches nicht nur Vertreter des Klerus, sondern auch weltliche Bürger betraf. Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Zinsen jedoch lediglich aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Die Zinstheorie ist die ökonomische Lehre des Zustandekommens von Zinssätzen und deren Höhe. Ausgehend von der klassischen Zinstheorie, die im Folgenden kurz angerissen wird, sollen die weiterführenden Überlegungen bedeutender Ökonomen auf diesem Gebiet beleuchtet werden. Die Theorien von Knut Wicksell, Eugen von Böhm-Bawerk, Irving Fisher, sowie John Maynard Keynes werden dabei im Verlauf dieser Arbeit in zinstheoretischem Kontext in einen logischen Zusammenhang gebracht. Dabei sollen wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien aufgezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die klassische Zinstheorie
3 Die Zinstheorien der Neoklassik
3.1 Der Pionier – Eugen von Böhm-Bawerk
3.1.1 von Böhm-Bawerks Prämissen
3.1.2 Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien
3.1.3 Die positive Zinstheorie
3.1.4 Implikationen der positiven Zinstheorie
3.2 Später Ruhm – Knut Wicksell
3.2.1 Wicksells Prämissen
3.2.2 Die Zinsspannentheorie
3.2.3 Implikationen der Zinstheorie Knut Wicksells
3.3 Der Exzentriker – Irving Fisher
3.3.1 Prämissen der Fisherschen Zinstheorie
3.3.2 Die Fisher-Separation
3.3.3 Preiserwartungseffekt und Erwartungshypothese
3.3.4 Implikationen der Theorien Fishers
4 John Maynard Keynes
4.1 Keynes’ Prämissen
4.2 Keynes’ Zinstheorie
4.3 Implikationen der Liquiditätspräferenztheorie
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Zins als intertemporales Phänomen
Abbildung 2: Die Zinstheorie von Knut Wicksell
Abbildung 3: Das Fisher-Separationstheorem
Abbildung 4: Die Liquiditätspräferenztheorie in Form des IS-LM Modells
1 Einleitung
Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, so fällt auf, dass die Betrachtung des Zinses nicht von Anfang an wirtschaftlicher Natur war, wie es die Vermutung nahe legen würde. Es waren vielmehr die Philosophen und Religionsvertreter die sich zuerst dem Zinsphänomen annahmen. Bereits Aristoteles setzte sich vor mehr als 2000 Jahren auf philosophischer Ebene mit dem Zins auseinander und kam zu dem Schluss, dass die Vermehrung von Geld durch dessen bloße Verleihung naturwidrig sei, da er Geld für von Natur aus unfruchtbar hielt.[1] Die Kirche sah es ihrerseits für Christen als verwerflich an von ihren Brüdern Zinsen zu nehmen und bezeichnete diese als Wucher. Diese tief verwurzelte kirchliche Lehre führte daher zur Verankerung des sogenannten Zinsverbots, welches nicht nur Vertreter des Klerus, sondern auch weltliche Bürger
betraf. [2]
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen die Zinsen jedoch lediglich aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Die Zinstheorie ist die ökonomische Lehre des Zustandekommens von Zinssätzen und deren Höhe.[3] Ausgehend von der klassischen Zinstheorie[4], die im Folgenden kurz angerissen wird, sollen die weiterführenden Überlegungen bedeutender Ökonomen auf diesem Gebiet beleuchtet werden. Die Theorien von Knut Wicksell, Eugen von Böhm-Bawerk, Irving Fisher, sowie John Maynard Keynes werden dabei im Verlauf dieser Arbeit in zinstheoretischem Kontext in einen logischen Zusammenhang gebracht. Dabei sollen wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien aufgezeigt werden.
2 Die klassische Zinstheorie
Die Periode der klassischen Zinstheorie umfasst in etwa die 100 Jahre zwischen der zweiten Hälfte des 18. und des 19. Jahrhunderts.
Die Anhänger der Klassik sahen den Zins als Gebühr für ein Kapitaleinkommen, welches durch die Wertproduktivität langfristigen Kapitals entsteht. Zinsen bilden hierbei in stark abstrahierter Form einen Gleichgewichtspreis zwischen dem Geldangebot der Sparer und der Geldnachfrage der Investoren, wobei die Höhe des Zinses vom Kapitalreichtum eines Landes bestimmt wird. Je höher die Konsumneigung der Wirtschaftssubjekte, umso höher der Zins.[5] In der Klassik wird der Zins als reale Größe betrachtet, welche durch die monetäre Größe des Geldes bzw. die Geldmenge langfristig nicht beeinflusst wird. Man spricht hierbei von der Neutralität des Geldes, welche in der klassischen Dichotomie, also der Trennung zwischen monetärem und realem Bereich der Volkswirtschaft, zum Ausdruck kommt.[6]
Eine weitere zentrale Ansicht der Klassiker ist das Wirken des Sayschen Theorems wonach sich jedes Angebot selbst seine eigene Nachfrage schafft, da nur etwas angeboten wird um mit dem Erlös wieder Güter und Dienstleistungen nachzufragen. Dadurch tendiere eine Volkswirtschaft immer von allein in ein Gleichgewicht.[7]
Da die klassische Zinstheorie aufgrund der starken Abstraktion von der Realität das Zustandekommen und die Funktionsweise von Zinsen nur unzureichend erklären konnte, bot sie den Vertretern der Neoklassik[8] ausreichend Anlass zur Weiterentwicklung.
Die Vernachlässigung der Einkommenskomponente, der fehlende Zeitbezug des Zinses, oder die Nichtberücksichtigung der Erwartungen der Wirtschaftssubjekte sind nur einige der Schwachpunkte der klassischen Zinstheorie, welche durch Erweiterungen und neue Theorien verbessert werden sollten.