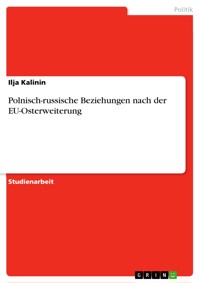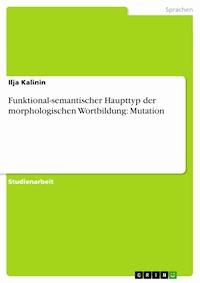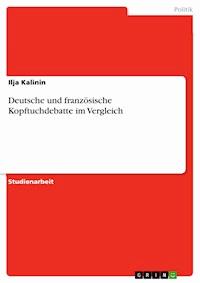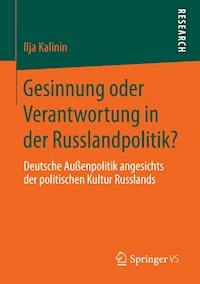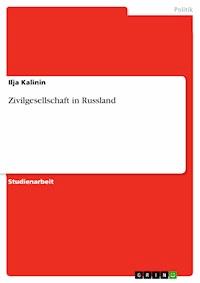
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Region: Russland, Note: 2,3, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Institut für Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Demokratie, Sprache: Deutsch, Abstract: In den letzten 20 Jahren hat der Begriff der „Zivilgesellschaft“ an Aktualität gewonnen. In Osteuropa wurde sie zu einer Antwort auf die Jahrzehnte währende Gleichmacherei der kommunistischen Regime. Auch die russische Politik und Öffentlichkeit hat die Anliegen der Zivilgesellschaft begriffen. Die russische Verfassung legt dafür ein Zeugnis ab. Inwieweit jedoch die Ideen der großen theoretischen Verfechter der Zivilgesellschaft in der russischen Verfassungswirklichkeit realisiert wurden, ist nicht nur eine ob ihrer Aktualität zu stellende Frage. Wenn man die russischen Perspektiven verstehen möchte, muss man inzwischen auch den Faktor Zivilgesellschaft in die Prognosen einbeziehen. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die aktuelle Lage Russlands hinsichtlich dessen zivilgesellschaftlicher Entwicklung vorzustellen und zu kommentieren. Eine besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Region Krasnodar (synonym dazu Kuban) im Südwesten des Landes (Nordkaukasus) zu. Als eine multiethnisch geprägte Region, die sich nicht im Einflussbereich der Metropolen Moskau oder Sankt Petersburg befindet, repräsentiert sie am treffendsten die gesamtrussische Situation. Nichtsdestotrotz darf auch der Hinweis nicht fehlen, dass es in Russland starke Differenzen sowohl positiver als auch negativer Art gibt. Die Arbeit hebt an mit einer Erläuterung des theoretischen Hintergrundes, um die Zivilgesellschaft als soziales Phänomen und als historischen Begriff fassbar zu machen. Die Vorstellung der unterschiedlichen Bereiche der Aktivität der Zivilgesellschaft im Abschnitt III.2. liefert einen groben Überblick über die russlandweit konfliktbeladenen Prozesse der Entstehung einer russischen Zivilgesellschaft auf den Gebieten der Umwelt, Öffentlichkeit, Demokratie und Soziales. Ein fünfter Bereich der Aktivität der Zivilgesellschaft, nämlich die Menschenrechte, wird an Hand der vier größten kubaner Nichtregierungsorganisationen vorgestellt, wobei ihre zivilgesellschaftlichen Funktionsleistungen erläutert werden. Die erarbeiteten Fakten fließen abschließend in eine wertende Schlussfolgerung ein. Obwohl sich die vorliegende Arbeit auf möglichst aktuelle Befunde stützt, kann kein Anspruch auf momentane Geltung der aufgeführten Sachverhalte erhoben werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 3
Zivilgesellschaft in Russland
I. Einleitung
In den letzten 20 Jahren hat der Begriff der „Zivilgesellschaft“ an Aktualität gewonnen. In Osteuropa wurde sie zu einer Antwort auf die Jahrzehnte währende Gleichmacherei der kommunistischen Re gime. Auch die russische Politik und Öffentlichkeit hat die Anliegen der Zivilgesellschaft begriffen. Die russische Verfassung legt dafür ein Zeugnis ab. Inwieweit jedoch die Ideen der großen theoretischen Verfechter der Zivilgesellschaft in der russischen Verfassungswirklichkeit realisiert wurden, ist nicht nur eine ob ihrer Aktualität zu stellende Frage. Wenn man die russischen Perspektiven verstehen möchte, muss man inzwischen auch den Faktor Zivilgesellschaft in die Prognosen einbeziehen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die aktuelle Lage Russlands hinsichtlich dessen zivilgesellschaftlicher Entwicklung vorzustellen und zu kommentieren. Eine besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Region Krasnodar (synonym dazu Kuban) im Südwesten des Landes (Nordkaukasus) zu. Als eine multiethnisch geprägte Region, die sich nicht im Einflussbereich der Metropolen Moskau oder Sankt Petersburg befindet, repräsentiert sie am treffendsten die gesamtrussische Situation. Nichtsdestotrotz darf auch der Hinweis nicht fehlen, dass es in Russland starke Differenzen sowohl positiver als auch negativer Art gibt. Die Arbeit hebt an mit einer Erläuterung des theoretischen Hintergrundes, um die Zivilgesellschaft als soziales Phänomen und als historische n Begriff fassbar zu m achen. Die Vorstellung der unterschiedlichen Bereiche der Aktivität der Zivilgesellschaft im Abschnitt III.2. liefert einen groben Überblick über die russlandweit konfliktbeladenen Prozesse der Entstehung einer russischen Zivilgesellschaft auf den Gebieten der Umwelt, Öffentlichkeit, Demokratie und Soziales. Ein fünfter Bereich der Aktivität der Zivilgesellschaft, nämlich die Menschenrechte, wird an Hand der vier größten kubaner Nichtregierungsorganisationen vorgestellt, wobei ihre zivilgesellschaftlichen Funktionsleistungen erläutert werden. Die erarbeiteten Fakten fließen abschließend in eine wertende Schlussfolgerung ein.
Obwohl sich die vorliegende Arbeit auf möglichst aktuelle Befunde stützt, kann kein Anspruch auf momentane Geltung der aufgeführten Sachverhalte erhoben werden.
II. Konzept der Zivilgesellschaft
1. Hauptkonzepte der Zivilgesellschaft
Das Phänomen der Zivilgesellschaft ist im Abendland schon seit mehreren Jahrhunderten Gegenstand von philosophischen, soziologischen und politologischen Betrachtungen. Zu den wichtigsten zivilgesellschaftlichen Theoretikern zählen John Locke (1632-1704), Charles Montesquieu (1689-1755), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Ralf Dahrendorf (*1929) und Jürgen Habermas (*1929). Wolfgang Merkel und Hans-Joachim Lauth stellen in ihrem Aufsatz „Systemwechsel und
Page 4
Zivilgesellschaft in Russland
Zivilgesellschaft: Welche Zivilgesellschaft braucht die Demokratie?“1die wichtigsten Zivilgesellschaftskonzepte vor und entwickeln eine Typologie von Zivilgesellschaften und ihren spezifischen Funktionsleistungen. Die vorliegende Arbeit rekurriert in theoretischer Hinsicht auf den genannten Aufsatz.
John Locke, der zu den Begründern der liberalen Tradition der Demokratie gezählt wird2, entwarf in seiner „Zweiten Abhandlung über die Regierung“ „eine naturrechtlich fundierte Gesellschafts- und Staatstheorie“3. Grundlagen dieser Theorie waren nach Manfred G. Schmidt die „Vorstellung von der natürlichen Freiheit und Gleichheit des Menschen, das Recht jedes Einzelnen auf Eigentum, worunter Locke Leben, Freiheit und Vermögen versteht, sodann die religiöse Toleranz, ferner die Suprematie der Gesellschaft über das Politische, überdies die Herrschaft des Rechts, Gewaltentrennung zwischen Legislative und Exekutive, weiterhin das Widerstandsrecht der Bürger gegen jede unrechtmäßige Regierung und überdies das Regieren auf der Basis der Zustimmung des Staatsvolkes (government by consent), mit eng begrenztem Staatszweck und begrenzten Machtmitteln der öffentlichen Gewalt“4. Locke postuliert damit in erster Linie die Schaffung einer unabhängigen gesellschaftlichen Sphäre in Abgrenzung zum Staat. Die Leitlinie dieser Sphäre soll der Schutz der negativen Freiheit der Bürger darstellen.
Die bei Locke ungelöste Frage nach der Vermittlung der gesellschaftlichen und der staatlichen Sphäre wird von Charles Montesquieu aufgegriffen. Dieser bringt ein komplexes „Modell der Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung“ ein, in dem gesellschaftliche Netzwerke, so genannte „corps intermédiaires“, als kontrollierende Gegengewalten die Zentralautorität einschränken respektive korrigieren. Diese unabhängigen aber rechtlich geschützten Gebilde kann man sich als „amphibische“ Körperschaften vorstellen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der politischen Struktur entfalten. Durch eine solche Verzahnung der zwei Sphären wird die größtmögliche Freiheit des Bürgers bei gleichzeitiger Sicherung des rechtlichen Rahmens ermöglicht.5
Auf die Eigenschaften und Funktionen dieser „freien Assoziationen“ geht Alexis de Tocqueville in seinem Werk „Über die Demokratie in Amerika“ (1835-40) ein. Für ihn sind sie die Schulen der Demokratie, da sie den Bürger zu demokratischem Denken und zivilem Verhalten durch die alltägliche Praxis erziehen. Um die Demokratie einüben zu können, müssen diese Assoziationen so beschaffen sein, dass sie als Orte der Selbstregierung fungieren können. Dies bedeutet konkret, dass sie nicht übermäßig groß, dafür aber zahlreich sein müssen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Assoziationen auf allen politischen Ebenen verteilt sind. Damit wird insbesondere die lokale Ebene bedacht. Wenn diese
1Merkel, Wolfgang/Lauth, Hans-Joachim (1998): Systemwechsel und Zivilgesellschaft: Welche Zivilgesellschaft braucht die Demokratie?, in: ApuZ, B 6-7.
2Er selbst benutzte nach Manfred G. Schmidt nicht das Vokabular der Demokratietheorien oder des damals noch nicht vorhandenen Liberalismus.
3Schmidt, Manfred G. (2000): Demokratietheorien: Opladen: S. 68.
4Ebd.
5Merkel/Lauth (1998): S. 4.