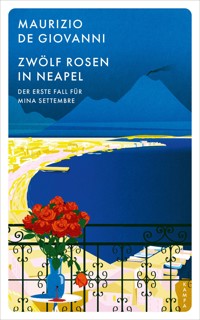Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mina Settembre
- Sprache: Deutsch
Wenn alles verloren scheint, tritt Mina Settembre auf den Plan. Sie ist Sozialarbeiterin der Beratungsstelle West im Spanischen Viertel von Neapel und weiß Rat, wo andere die Segel streichen. Dabei hilft ihr eine große Prise Verrücktheit. Mina steht denen zur Seite, die weniger Glück hatten als sie. Denn das Leben hat es gut gemeint mit ihr und tut es noch, sieht man von der eisigen Kälte ab, die in diesem Winter in Neapel herrscht, und von Minas zwei Dauerproblemen: Das erste ist ihre unausstehliche Mutter, das zweite ein körperliches Merkmal, das Mina mehr Aufmerksamkeit beschert, als ihr lieb ist. Aber all das zählt jetzt nicht: Die Sozialarbeiterin bekommt es mit der mächtigen Familie Contini zu tun, deren Einfluss bis in die dunkelsten Gassen Neapels zu reichen scheint. Mina nimmt den Kampf auf, unterstützt von ihren besten Freundinnen und ihrem heimlichen Schwarm, dem Arzt Domenico Gammardella, während zeitgleich ihr Ex-Mann, Staatsanwalt De Carolis, einen Todesfall untersucht. Ein älterer Literaturprofessor ist unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Gibt es eine Verbindung zwischen Minas Ermittlungen und denen ihres Ex-Manns?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Zu kalt für Neapel
Der zweite Fall für Mina Settembre
Roman
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth
Kampa
Für meine Mutter.
Wegen des Märchens vom alten Großvater und all der anderen Geschichten.
Diese mit eingeschlossen.
I
»Erzähl’s mir noch mal. Nur einmal noch.«
»Musst du keine Hausaufgaben machen?«
»Habe ich schon vor einer Stunde gemacht.«
»Gibt’s denn nichts im Fernsehen? Kinder in deinem Alter gucken doch um diese Uhrzeit Zeichentrickfilme, oder nicht?«
»Das sollten sie besser nicht. Weißt du nicht, dass Fernsehen schlecht ist für Kinder? Fernsehen macht dumm. Schau dir nur Mama an.«
»Nein, danke. Gott verzeih mir, aber je seltener ich deine Mutter sehe, umso besser geht’s mir.«
»Auf jeden Fall sitzt sie ständig vorm Fernseher. Entweder Teleshopping oder Ich bin ein Idiot – Holt mich hier raus oder Beim Fremdgehen erwischt! …«
»Also – das ist aber nichts für ein kleines Mädchen!«
»Aber darum geht es, verstehst du? Da ist einer von seiner Frau betrogen worden und hat vor sich vier Typen sitzen, einer davon ist der Lover von seiner Frau, und er muss rauskriegen, wer.«
»Wirklich? Und wie kriegt er das raus?«
»Ah, keine Ahnung. Mama schickt mich immer aus dem Zimmer, wenn’s interessant wird. Ich glaube, er stellt ihm Fragen über Dinge, die nur jemand wissen kann, der mit der Frau zusammen war, zum Beispiel, wie sie kocht oder wie sie …«
»Hör auf, das reicht! Das ist hier wirklich wie im Irrenhaus. Irgendwann rufe ich beim Kindernotruf an und lasse dich hier rausholen. Natürlich anonym, versteht sich.«
»Aber warum? Meinst du vielleicht, bei anderen Leuten ist es besser? Eine Klassenkameradin von mir muss immer, wenn ihr Vater nicht da ist, zur Nachbarin, weil die Mutter dann Besuch von einem Freund bekommt und sie das nicht mitkriegen soll. Unter uns Freundinnen erzählen wir uns solche Sachen, musst du wissen.«
»Aber warum bekommt die Mutter … Na ja, ich will es gar nicht wissen.«
»Ist auch besser so. Und jetzt erzähl mir die Geschichte vom chinesischen Bauern.«
»Aber die habe ich dir doch schon x-mal erzählt! Willst du nicht mal eine andere hören?«
»Nein, die. Bitte, erzähl sie mir, bitte, bitte …«
»Na gut, wenn’s denn sein muss. Also, es war einmal ein alter Bauer, der …«
»Nicht so – du musst sie richtig erzählen! Wo kam der Bauer her? Er war ein Chi-ne…«
»Du hast recht, das habe ich vergessen. Also, es war einmal ein alter Bauer aus China, der war sehr arm. Er und sein Sohn, der ihm bei der Feldarbeit half, hatten ein Pferd, das die schweren Lasten für sie trug.«
»Und was war das für ein Pferd?«
»Es war eine Stute. Eine braune Stute, mit schönen großen Augen, so wie deine. In Ordnung? Darf ich weitererzählen?«
»Eine hübsche kleine Stute, genau. Ja, erzähl weiter.«
»Nun, eines Tages kam der Sohn völlig außer Atem zu dem alten Bauern gelaufen. ›Vater, Vater!‹, rief er. ›Unsere schöne Stute ist aus dem Stall ausgebrochen! Was für ein Unglück!‹ Doch der Greis erwiderte seelenruhig: ›Wer sagt denn, dass es ein Unglück ist?‹«
»Klar ist das ein Unglück! Wie sollen sie denn ohne die Stute klarkommen? Wer trägt ihnen die schweren Lasten?«
»Du hörst jetzt einfach mal zu, ja? Am nächsten Tag kamen die Bewohner aus dem Dorf zu dem alten Bauern und fragten: ›Was wollt ihr denn jetzt machen?‹ Der Sohn nahm seine Freunde zur Seite. ›Mein Vater ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Stellt euch vor, was er gesagt hat: ›Wer sagt denn, dass es ein Unglück ist?‹‹ Und während sie dort standen und sich über den verkalkten Alten lustig machten, kam plötzlich die schöne Stute zurück. Und zwar nicht allein.«
»Wie, nicht allein? Wer war denn da bei der Stute?«
»Also, hör mal, das weißt du doch! Ich habe dir die Geschichte schon hundertmal erzählt!«
»Nein, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Mit wem ist die Stute zurückgekehrt?«
»Weil die Stute genauso schöne Augen hatte wie du, kam sie mit einer ganzen Herde von Wildpferden zurück, die alle in sie verliebt waren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich der Sohn war! Seine Freunde waren natürlich furchtbar neidisch, und die Leute aus dem Dorf konnten es nicht fassen. Eine ganze Herde – plötzlich waren sie reich! Der Einzige, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, war der alte Bauer, der reglos auf seinem Stuhl unter dem Vordach saß. Du kennst die typische Sitzhaltung der Chinesen, oder?«
»Klar kenne ich die. Ich kann sie sogar nachmachen, schau mal!«
»Sehr gut, der Lotussitz, perfekt! Auf jeden Fall sagte der Sohn zu seinem Vater, als er dessen Gleichmut bemerkte: ›Vater, freust du dich denn gar nicht über unser großes Glück?‹ Und der Alte antwortete …«
»›Wer sagt denn, dass es ein Glück ist?‹«
»Genauso war es. Und tatsächlich, ein paar Tage später fiel der Sohn von einem der Wildpferde, das er versucht hatte zu zähmen, und brach sich das Bein. Weinend humpelte er zu dem Alten und sagte: ›Was für ein Unglück, Vater! Was machen wir denn jetzt?‹ Und wie immer erwiderte der Alte: ›Wer sagt denn, dass es ein Unglück ist?‹«
»Wieso das denn? Der Sohn hat sich das Bein gebrochen – weißt du, wie weh das tut? Ich habe mir doch mal den Knöchel verstaucht: Erinnerst du dich noch daran, wie sehr ich geweint habe?«
»Ja, klar erinnere ich mich noch daran. Jedenfalls hatte der Greis schon wieder recht, denn an dem Tag kamen die Feldjäger und zogen alle Freunde des Sohnes in den Krieg ein, nur ihn nicht, weil er ein gebrochenes Bein hatte.«
»In den Krieg? Und was ist mit ihnen passiert?«
»Der Krieg ist etwas sehr Schreckliches: Viele von ihnen starben auf dem Schlachtfeld, andere kehrten verwundet oder verstümmelt zurück. Nur der Sohn des alten Bauern blieb verschont und hatte viel Zeit zum Nachdenken, denn mit einem gebrochenen Bein kann man nicht auf dem Feld arbeiten.«
»Und worüber hat er nachgedacht?«
»Er hat darüber nachgedacht, was sein Vater gesagt hat. Und dass jemand, der alt ist, nicht gleich verkalkt sein muss. Klar ist das, was so ein alter Mensch von sich gibt, sicher lange nicht so interessant wie die Insel der Fremdgänger, aber …«
»Die Insel der Idioten! Das mit den Fremdgängern ist was anderes.«
»Egal, ich wollte sagen, dass ein alter Mensch vielleicht langweilig ist, aber, so dachte sich der Junge mit dem gebrochenen Bein, es lohnt sich, ihm zuzuhören. Denn an seinen Worten kann durchaus etwas Wahres sein. Ein Glücksfall macht einen nicht immer glücklich, und Unglück kann auf lange Sicht auch seine guten Seiten haben.«
»Und wie erkennt man, ob ein Glücksfall eigentlich ein Unglück ist, Großvater? Und ein Unglück ein Glücksfall?«
»Man muss etwas tun, das sehr schwierig ist. Etwas, das man nur mit viel Mühe und Überwindung lernen kann.«
»Was denn?«
»Warten. Man muss warten, mein Schatz.«
2
Vor vielen Jahren (sechsunddreißig, um genau zu sein, und bei dem Gedanken daran überkam sie ein Frösteln) hatte die Dottoressa Gelsomina Settembre, genannt Mina, in der Klosterschule eine Einweisung in den Katechismus über sich ergehen lassen müssen.
Einen Intensivkurs, ein Training der Sonderklasse, nur sie allein. Auslöser war der Widerwille des jungen Mädchens gegenüber festen christlichen Bräuchen, vor allem was das Tischgebet betraf. Sie fand es einfach sadistisch von den Nonnen, die Kinder mit gefalteten Händen und knurrendem Magen vor einem Teller Pasta sitzen zu lassen, während ihnen das Wasser im Mund zusammenlief und die Nudeln immer kälter und pappiger wurden. Also wagte sie durchaus schon mal einen Bissen ante tempus, um sich anschließend umso eifriger dem Gebet zu widmen oder aber ihre gerechte Strafe anzutreten.
Nach der dritten Ermahnung gab es die Gelbe Karte und gegen Ende der Schulzeit dann jenen Auffrischungskurs bei Schwester Angelica, deren Spezialgebiet das Alte Testament war (mit ihren neunzig Jahren schien sie Mina fast aus derselben Epoche zu stammen) und deren Herz sich nach Jahrzehnten des Unterrichtens aufsässiger Mädchengenerationen in Stein verwandelt hatte. Eine ihrer Lektionen – wie sich Mina an jenem Montagmorgen im Januar erinnerte, was sie wenig freute, während ein eiskalter Wind vor ihrem Fenster heulte und sie die letzte halbe Stunde vor dem Weckerklingeln in ihrem warmen Bett auszukosten versuchte – betraf bildhafte Darstellungen vom Allmächtigen.
Ich war ein Kind, dachten ihre im Schlaf aktiven Neuronen, da war mir doch egal, wie im Mittelalter Gott gemalt wurde. Irgendwas muss dich daran ja fasziniert haben, erwiderten genervt ihre anderen Gehirnzellen, die gern noch länger ungestört geblieben wären. Vielleicht suchst du ja nach Anregungen für einen erotischen Traum in extremis, oder warum sinnierst du ausgerechnet jetzt darüber, verflucht noch mal?
Schwester Angelica jedenfalls deutete mit ihrem Gichtfinger auf die Illustration eines finster dreinblickenden blauen Auges, das sich in der Mitte eines flammenumzüngelten Dreiecks befand. Den zweiten Platz auf der Tribüne hatte eine weiße Taube eingenommen, und auf dem dritten Platz hockte ein bärtiger Hippie in einem weißen Flattergewand, der in der Hand ein mit Stacheldraht umwickeltes Herz hielt.
Die junge Mina wollte sich keine unnötigen Gedanken über die Verkrümmung von Schwester Angelicas Fingergliedern machen, sondern lieber herausfinden, aus welchem mysteriösen Grund sich nur ein einziges Auge in dem Dreieck befand. Wenn Gott allmächtig war, so ihre Schlussfolgerung, warum hatte er dann diese Unvollkommenheit zugelassen?
Als wäre es gestern erst gewesen, kramte ihr Unterbewusstsein prompt die Erinnerung an Schwester Angelicas Ohrfeige hervor. Eine Reaktion, die die junge Mina seinerzeit für maßlos überzogen hielt, die aber immerhin die Debatte beendet hatte.
Während die eine Gruppe ihrer Gehirnzellen sich weiterhin über die Ruhestörung beschwerte, stellten die anderen, nun hellwachen Neuronen fest, dass seit damals das Riesenauge mit einem Gefühl des Bespitzeltwerdens verbunden war. Schon als Heranwachsende hatte sich Mina geradezu zwanghaft eingebildet, ständig und überall beobachtet zu werden, was bei ihr zu regelrechten Verdauungsproblemen geführt hatte. Sie konnte partout nicht verstehen, wie andere Leute sich seelenruhig entleerten, während sie durch die Wand hindurch beobachtet wurden – und zwar nicht von irgendwem. Es mochte nur ein einziges Auge sein, doch sie war überzeugt, dass es alles sehen konnte.
Ihre schlafenden Gehirnzellen, die mindestens bis zum Weckerklingeln und auch gerne länger weiterdösen wollten, starteten einen Überraschungscoup: »Take Five«, in der Version von Dave Brubeck, mit Brubeck höchstpersönlich am Klavier und dem großartigen Paul Desmond am Saxophon. »Jetzt sind wir aber mal gespannt«, sagten sie zu den wachen Neuronen, »wie ihr das toppen wollt. Und bis ihr so weit seid, können wir ja ruhig noch ein bisschen weiterschlafen.«
Die wache Gruppe verknüpfte die beiden Dinge miteinander: das Auge im Dreieck und die Jazzmusik, den Katechismus und das Sopransaxophon, Schwester Angelica und die verrauchte Fünfzigerjahre-Bar. Es passte alles zusammen.
»Neun«, sagte die Stimme drei Zentimeter vom Ohr der schlafenden Mina entfernt.
Sie sagte es in dem sachlichen und endgültigen Tonfall einer unausweichlichen Prophezeiung.
Mina, die selbst im Schlaf über schauspielerisches Talent verfügte, versuchte eine Art Grunzen, das an ein leichtes Schnarchen erinnerte. Kurz befürchtete sie, vom Geiste Schwester Angelicas heimgesucht zu werden, der aus der Hölle, in der sie wegen ihres inquisitorischen Charakters schmorte, wieder aufgetaucht war. Doch es musste sich um die Stimme Gottes handeln, denn als sie ihr rechtes Lid einen millimeterbreiten Spalt öffnete, blickte sie geradewegs in ein riesiges blaues Auge, das sie finster musterte. Nun hatte es sie doch gefunden.
»Gulp«, sagte sie schlaftrunken. Sie hustete, schluckte und fragte erneut: »Neun? Ist es etwa schon neun? Hat der Wecker nicht geklingelt?«
Das Auge blieb ausdruckslos. Die wachen Gehirnzellen registrierten, dass der Allmächtige einen raffinierten blauen Lidschatten aufgelegt hatte.
»Neun graue Haare. Letzte Woche waren es erst acht. Jetzt sind es neun.«
Die schlafenden Zellen gaben auf und trällerten wütend weiter »Take Five«.
»Verdammt, Mama, mal sind es Krähenfüße, mal Stirnfalten, jetzt graue Haare … Wann verstehst du endlich, dass mich mein Äußeres nicht interessiert? Es ist so, wie es ist, was soll ich machen?«
Das Auge zog sich für ein paar Zentimeter zurück, und Minas vernebeltem Blick bot sich auch der Rest in seiner ganzen Pracht. Jeden Tag fragte sie sich aufs Neue, wie es möglich war, dass dieser Roboter namens Concetta, ihre Mutter, der darauf programmiert war, anderer Leute Selbstwertgefühl zu zerstören, es immer wieder schaffte, bereits morgens um sieben, wenn nicht früher, wie aus dem Ei gepellt auszusehen: Obwohl sie im Rollstuhl saß, war ihre violette Dauerwelle perfekt gelegt, ihr Make-up makellos und ihre Kleidung höchst adrett.
»Ach, das geht ganz schnell: Aus acht grauen Haaren werden neun, dann achtzehn, und ehe du dich versiehst, sind es sechsunddreißig. Dann, sechs, sieben Monate später siehst du plötzlich aus wie Schneewittchens böse Stiefmutter, nur ohne ihre Kochkünste.«
Mina kramte nach Argumenten.
»Abgesehen davon, dass du dir das mit der Vermehrung der grauen Haare nur einbildest: Wo steht denn geschrieben, dass graue Haare nicht attraktiv sind? Wenn du zum Beispiel nicht diese absurde Tönung benutzen würdest, wären deine Haare schneeweiß. Darf ich etwa nicht in die Fußstapfen meiner Mutter treten?«
Concetta grinste. Niemals hatte das Wort »grinsen« besser gepasst: Durch ein kaum merkliches Verziehen der Lippen vermochte sie zugleich Spott und Gönnerhaftigkeit, Mitleid und Grauen auszudrücken. Mina war überzeugt, dass sie sich eine chronische Gesichtslähmung einhandeln würde, sollte sie die Mimik ihrer Mutter nachzuahmen versuchen.
»Anders als du, meine Liebe, besitze ich so etwas wie Charme. Ich könnte auch eine Glatze haben und trotzdem mit dem Mann meiner Träume ins Bett gehen, selbst mit diesem Rollstuhl hier. Du hingegen bist so charmant wie ein Müllcontainer, allerdings nicht so nützlich. Also, wenn du weiter so abbaust, hast du noch weniger Chancen, einen Mann zu finden, der dich finanziert. Und du hast schon ganz schön nachgelassen. Ich sage das übrigens nur, weil ich …«
»… weil du mein Bestes willst«, vervollständigte Mina den Satz, wobei sie jedes einzelne Wort wie einen Kirschkern ausspuckte. »Danke, liebstes Mamilein, für deine wertvolle moralische Unterstützung. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun sollte. Wirklich nicht.«
Concetta zog die zu einem schmalen Strich gezupften Augenbrauen hoch.
»War das jetzt etwa ironisch gemeint? Du solltest lieber Untertitel unter deine Worte setzen, weißt du? Nach dem Motto: ›Achtung, Ironie!‹ Sonst versteht man die nämlich nicht.«
Mit diesem lapidaren Statement verließ sie den Schauplatz. Eine Drehung um hundertachtzig Grad mit dem Rollstuhl, dann mit quietschenden Reifen im Rhythmus der ersten »Take Five«-Takte auf dem Saxophon ab in Richtung Flur. Mina wusste, dass sie mindestens noch eine Woche in ihrem Kopf nachhallen würden. Wenn nicht länger.
»Siehst du«, tönten ihre wachen Neuronen, die bei voller Gehirnleistung für die Abteilung »Pessimismus« zuständig waren, »was haben wir dir gesagt: ›Take five‹ und das Riesenauge.«
Sie setzte die Füße auf den eiskalten Boden.
Wie ich diesen Januar hasse, sagte sie zu sich selbst.
3
Die Hände hinter dem Rücken ineinander verschränkt, drehte der elegante Herr mit der dunklen Hornbrille und dem akkuraten Seitenscheitel gemächlich seine Kreise. Keine Regung in seinem Gesicht verriet, dass er an seine Jugend zurückdachte.
Er war ein einsames Kind gewesen. Sein messerscharfer Verstand und seine arrogante Haltung, gepaart mit herausragenden Schulleistungen hatten nicht selten dazu geführt, dass seine Klassenkameraden Mordgelüste ihm gegenüber verspürten. Seine Eltern hatten unterschiedlich darauf reagiert: Während sein Vater vor allem stolz auf seinen Sohn war, hatte sich die Mutter ständig Sorgen um ihn gemacht und beispielsweise seine Teilnahme an Wettkämpfen torpediert, bei denen diese Rabauken ihm unauffällig ans Leder gekonnt hätten.
Die Folge waren lange Urlaube mit den Eltern, bei denen er die Zeit mit Lesen und Spazierengehen totschlug. An Weihnachten legte er mit seinen Wanderungen zwischen Wohnung und Stadtbibliothek, die er mehrmals am Tag unternahm, Dutzende von Kilometern zurück.
Sinnliche Erfahrungen, dachte der Mann mit der Brille, beleben das Erinnerungsvermögen. Ähnlich wie die Proust’sche Madeleine brachte der Geruch von verbranntem Holz ihn zurück in jene tristen, verschneiten Wochen, die er als Fünfzehnjähriger verbracht hatte. Damals wie heute war es fürchterlich kalt, und damals wie heute blies ein eisiger Wind um jede Ecke und drohte, ihm eine Trigeminusneuralgie einzubringen.
Allerdings war er damals umgeben von frierenden Eichhörnchen und weiß gepuderten Tannen, während heute eine Leiche mit stark geröteter Haut vor ihm auf einer Pritsche lag. Der Geruch nach verbranntem Holz kam von einem alten Ofen, der – so sagte es ihm seine Nase, denn der Bericht des Gerichtsmediziners lag noch nicht vor – durchaus ursächlich für den Tod sein konnte. Damit hatte es sich aber schon mit den Parallelen zwischen seiner ebenso bereichernden wie einsamen Jugend und der aktuellen Situation, dachte er.
Die Leiche mit der rötlichen Hautverfärbung und der Mann mit der dunklen Brille waren jedoch nicht die einzigen menschlichen Wesen im Raum, wenngleich in unterschiedlichen Zuständen von Lebendigkeit. Das dritte Subjekt befand sich irgendwo dazwischen, denn genau wie bei dem Mann mit der Brille funktionierte zwar sein Respirationsapparat, aber genau wie bei der Leiche war die Haut deutlich verfärbt, bei ihm allerdings ins Bläuliche tendierend. Seine Zähne klapperten, und hin und wieder machte das Wesen einen seltsamen Hüpfer, als wollte es seine Durchblutung ankurbeln.
Es trug eine Uniform mit roten Streifen an der Hosennaht und hatte die Kappe tief in die Stirn gedrückt. Seine Abzeichen wiesen ihm den Rang eines Stabsfeldwebels der Carabinieri zu. Die bläuliche Hautfarbe kam nicht nur von der Kälte, sondern auch von dem verzweifelten Bemühen, nicht zu husten. Doch der Drang war einfach zu stark.
»Gargiulo, haben Sie etwa immer noch nichts gegen Ihren Husten unternommen?«
Der Carabiniere versuchte, das Ganze herunterzuspielen.
»Das ist nur eine Art Reizhusten, Dottore. Nichts Ernstes.«
Der Mann mit der Brille setzte den Fuß auf, den er bis dahin in der Luft hatte schweben lassen, und pflanzte sich nur wenige Zentimeter vor dem Uniformierten auf. Die Hände noch immer hinter dem Rücken verschränkt, betrachtete er das zerknirschte Gesicht seines Gegenübers.
Vielleicht wollte der andere ihn ja mit einem einzigen Bissen verspeisen, wie eine Python, überlegte der Maresciallo. Er hatte mal einen Dokumentarfilm gesehen, in dem eine Riesenschlange ein junges Lama oder Bison verschlungen hatte und dann einen ganzen Monat lang mit der Verdauung beschäftigt gewesen war. Allerdings hatte er weniger Angst davor, verschlungen zu werden, als sich wochenlang im Verdauungstrakt dieses Körpers aufhalten zu müssen.
»Sie unterschätzen die Gefahr des Hustens, Gargiulo. Das sollten Sie nicht. Mein Onkel hatte genau einen solchen Husten, eine schreckliche Krankheit. Wirklich grauenhaft.«
Gargiulos Bedürfnis, mit der Hand von der Hosennaht zum Hosenschlitz zu rutschen und zu kratzen, was gekratzt werden wollte, war so stark, dass diese anfing zu zittern. Doch er blieb eisern.
»Danke, Dottore. Ich werde der Sache nachgehen, versprochen.«
Der Mann mit der Brille musterte ihn zweifelnd, als wüsste er nicht, ob er ihm wirklich glauben sollte.
»Na gut, kommen wir zur Sache. Erzählen Sie mal, was wir hier vor uns haben.«
Gargiulo hatte sich noch immer nicht an die unkonventionelle Arbeitsweise von Staatsanwalt Claudio De Carolis gewöhnt, der den Tatort zunächst wortlos abschritt, als wäre er aus purem Zufall dort gelandet, und erst danach die Fakten zu hinterfragen begann. Er wies mit dem Kinn auf das Feldbett.
»Gravela, Giacomo. Lehrer für italienische Sprache und Literatur, in Rente. Wohnhaft eine Etage tiefer, die im Übrigen die oberste ist, denn wir befinden uns hier auf dem Speicher.«
Der Staatsanwalt spielte den Überraschten.
»Tatsächlich? Ich hätte gedacht, wir befänden uns im Keller.«
Eine Windböe schlug gegen das Dachfenster, sodass der Fensterladen klapperte. Gargiulo fuhr fort.
»Der Speicher ist nicht als Wohnraum ausgewiesen, sondern für alle Mieter da. Deshalb hat auch die Hausmeisterin, Santina Raffone, einen Schlüssel. Sie hat Gravela in diesem Zustand gefunden und uns benachrichtigt. Obwohl die Signora sofort das Fenster aufgerissen hat, stank es extrem nach Qualm.«
De Carolis schaute zu dem alten Holzofen in der Ecke.
»Verstehe. Mich würde interessieren, warum jemand, der eine Etage tiefer wohnt, sich hier oben aufhält. Wollte er vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen?«
»Nein, Dottore, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Auch wenn richtig eingeheizt wird, hat es bei Tagesaußentemperaturen von gerade mal über null hier nicht mehr als vier, fünf Grad. Der Tote trägt außerdem mehrere Schichten Kleidung übereinander, also wird ihm kaum zu warm gewesen sein. Klar, alles ist möglich, aber …«
Der Staatsanwalt musterte den Carabiniere mit schräg gelegtem Kopf. Er sah aus wie jemand, der in Erfahrung bringen will, welchen Grad an Dummheit ein Mensch erreichen kann.
»Gargiulo, Hut ab vor Ihrem logischen Denkvermögen. Und glauben Sie mir, ich bewundere Ihre Art der Analyse, die keine Vermutung ausschließt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber auch ich würde nicht davon ausgehen, dass dieser Gravela, noch dazu in seinem Alter, zum Skifahren hergekommen ist.«
Für den Fall, dass der Staatsanwalt einen Witz gemacht hatte, zog der Maresciallo vorsichtshalber eine Grimasse, die sowohl als Lächeln wie als Zeichen der Zustimmung zu deuten war. Der Versuchung zu antworten, konnte er trotzdem nicht widerstehen.
»Gewiss nicht, Dottore. Hier bei uns schneit es ja sogar bei Temperaturen wie diesen nur sehr selten. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es weiter im Norden tatsächlich ein paar Schneeflocken, aber …«
Je mehr De Carolis’ Kiefermuskel zuckte, desto leiser wurde seine Stimme. Endlich wandte der Staatsanwalt den Blick von ihm ab und schaute hinüber zu der Leiche auf der Pritsche.
»Wir müssen die Todesursache klären. Sie haben gesagt, die Hausmeisterin hat einen Schlüssel, also kommt man ohne Schlüssel von draußen nicht rein – korrekt? Und durch dieses Fensterchen da hinten kann nun wirklich niemand ein- und aussteigen. Gibt es hier irgendwo einen Austritt? Und wenn ja, wie kommt man dahin?«
Der Carabiniere schlug die Hacken zusammen.
»Jawohl, Dottore. Es handelt sich um eine Art Dachbalkon. Man gelangt vom Treppenabsatz dorthin, aber die Tür ist von innen verschlossen. Mit anderen Worten, es sieht nicht so aus, als hätte sich jemand von dort Zutritt verschafft. Es sei denn, es gibt noch weitere Schlüssel neben dem der Hausmeisterin.«
De Carolis zeigte auf den kleinen metallenen Gegenstand auf der leeren Obstkiste, die neben der Pritsche an der Wand stand.
»Und neben dem da, mit dem sich höchstwahrscheinlich Gravela Zutritt zum Speicher verschafft hat. Sie können das gerne überprüfen, aber nicht jetzt. Ich will erst mit dieser Signora Raffone reden und hören, was der Gerichtsmediziner sagt. Sie haben ihm doch Bescheid gesagt, oder?«
Gargiulo schlug erneut die Hacken zusammen. Diesmal deutete er sogar einen militärischen Gruß an, den er jedoch auf halbem Weg abbrach, als ihm bewusst wurde, wie unangebracht die Geste war.
»Jawohl, Dottore. Er ist auf dem Weg, er müsste längst hier sein. Ich lasse die Hausmeisterin rufen. Oder, wenn Sie erlauben, gehe ich sie selbst holen.«
De Carolis gab ein zustimmendes Grunzen von sich.
Wie eine aufgescheuchte Schwalbe, die sich in der Jahreszeit vertan hat, flatterte Gargiulo davon.
4
Wie immer bot Mina der Weg zu ihrer Arbeitsstelle Gelegenheit zu tiefsinnigen Betrachtungen über Leben, Schicksal und die Welt als solche. Dies hatte zwei Gründe.
Zum einen hatte ihr Weg zur Arbeit, was seine Dauer betraf, Ähnlichkeit mit einem Glücksspiel. Sofern die Anschlüsse im Nahverkehr klappten und nur wenig Verkehr auf der Straße herrschte – was in elf Jahren ganze zwei Mal vorgekommen war –, dauerte er eine Viertelstunde. Wenn aber etwas Außergewöhnliches anstand, war Mina bis zu zwei Stunden unterwegs. Dank des kreativen Chaos in der Stadt war die zweite Variante eindeutig die wahrscheinlichere. Deshalb verließ sie das Haus in der Regel eher zu früh als zu spät, weil sie im Büro lieber noch in Ruhe etwas las oder telefonierte, statt atemlos die letzten zweihundert Meter den Hang hochzuhetzen.
Der zweite Grund lag darin, dass diese Einsamkeit am frühen Morgen stattfand und man ihrer Ansicht nach zu dieser Uhrzeit am besten die kommenden Tage, Monate oder gar Jahre planen konnte.
Dem eisigen Wind an der Bushaltestelle versuchte Mina mit dem hochgeschlagenen Kragen ihres unförmigen Mantels und einer bis zu den Augen heruntergezogenen Wollmütze zu trotzen. Vielleicht half das ja, ihre noch immer leicht verschlafenen Gehirnzellen zu reaktivieren. Auf jeden Fall musste sie herausfinden, inwieweit die Umstände ihres Aufwachens Aufschluss über die kommende Woche geben würden.
Mina machte sich keine Illusionen über sich selbst und ihr Dasein. Im Gegenteil, sie hielt sich eher für eine Pessimistin, weil sie immer vom Schlechtesten ausging, wie ihre Freundinnen ihr ständig vorhielten. Was allerdings im krassen Widerspruch zu den Entscheidungen stand, die aus ihr den Menschen gemacht hatten, der sie geworden war.
Wäre sie wirklich Pessimistin gewesen, hätte sie als brillante Studentin, der alle möglichen gut dotierten Positionen offen standen, einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Sie aber hatte die Welt verändern wollen und war im ärmsten Viertel der ganzen Stadt Sozialarbeiterin geworden, bei einem Monatsgehalt von zweitausend Euro, die ihr ebenso unwillig wie unregelmäßig ausgezahlt wurden.
Wäre sie wirklich Pessimistin gewesen, hätte sie ihre Ehe aufrechterhalten, statt am selben Tag, an dem ihr bewusst geworden war, dass sie dieses triste Grau keinen weiteren Monat aushalten würde, die Brocken hinzuwerfen – und das ohne einen Liebhaber, wie ihre Mutter ihr bei jeder Gelegenheit unter die Nase rieb.
Wäre sie wirklich Pessimistin gewesen, hätte sie sich in dem herrschaftlichen Viertel ihrer Jugend eingeigelt, weiterhin Buraco gespielt und Cocktails geschlürft und wäre von einer Zwölf-Meter-Jacht auf die nächste gehüpft, wie ihre Freundinnen, die nicht verstehen konnten, warum der Rest der Stadt, wenn es schon kein Brot zu essen gab, nicht auf Brioches umstieg.
In Wirklichkeit, sagte sie sich mit klappernden Zähnen, während hinter der schönsten Bushaltestelle der Welt auf spektakuläre Weise die Sonne über Meer und Hügeln aufging, in Wirklichkeit bin ich überhaupt keine Pessimistin, liebe Freundinnen und liebe Mama. Ganz im Gegenteil.
Nach einer akzeptablen Verspätung von einer Viertelstunde, die ihr wegen des eisigen Windes aber wie Stunden vorkam, tauchte der Bus auf. Er war schon jetzt überfüllt. Ein schlechtes Zeichen. Trotzdem gelang es ihr, sich noch in das Gefährt zu quetschen, was wiederum ein gutes Zeichen war. Der Tag versprach, vergleichsweise ausgeglichen zu werden.
Mit zweiundvierzig Jahren hätte sie wahrscheinlich längst Bilanz ziehen und die entsprechenden Konsequenzen ergreifen müssen. Beispielsweise hätte sie sich fragen müssen, warum sie noch immer in dem Zimmer ihrer Teenagerjahre lebte, das etwa ein Viertel so groß war wie der Kleiderschrank ihrer ehemaligen Banknachbarin Lulú. Sie hätte sich in Liebesdingen engagieren müssen, wenn sie nicht, wie ihre Mutter ständig unkte, für den Rest ihres Lebens Single bleiben wollte. Vor ihrem geistigen Auge entstand ein so deprimierendes Bild, dass Mina jeden Gedanken an ihre Zukunft sofort unterdrückte.
Mit einer in langjähriger Erfahrung erworbenen Präzision trat sie dem hinter ihr stehenden Unbekannten auf den großen Zeh, der das Gedränge im Bus dazu genutzt hatte, sich an ihrem Hintern zu reiben, und sinnierte darüber, dass aus den beiden großen Problemen, die ihr das Leben schwer machten, mittlerweile drei geworden waren. Und statt einander aufzuheben, wurden sie immer größer und ergänzten sich immer besser.
Sie verließ den Autobus voller Wahnsinniger, um in eine U-Bahn voller Wahnsinniger zu steigen, in der sie zwei weitere große Zehen mit ihrem Absatz bearbeiten musste. Aber das entsprach dem Durchschnitt. Noch war nicht abzusehen, wie der Tag sich entwickeln würde.
Die Probleme … Anders als normale Probleme, die man irgendwie lösen konnte, egal wie kompliziert sie auch waren, ging das bei den Problemen nicht. Sie warfen ihre Schatten auf die lichten Seiten des Lebens und verdunkelten auch diese.
Problem Nr. 1 war Concetta, ihre Mutter. Das erzwungene Zusammenleben, bedingt durch Minas miserables Gehalt als Sozialarbeiterin. Die durch Alter und Unbeweglichkeit noch potenzierte Boshaftigkeit der Frau. Ihre unüberbrückbar unterschiedlichen Wertesysteme … Mina kam in jeder Hinsicht nach ihrem verstorbenen Vater, einem herzensguten Mann und Mediziner, der von Concetta mit heftiger Inbrunst ausschließlich »dieser Idiot von deinem Vater« genannt wurde, weil er dummerweise dazu geneigt hatte, pro bono zu arbeiten.
Problem Nr. 2 war ursächlich dafür, dass sie ihren Ellbogen in einen unbekannten Brustkorb direkt neben sich rammte, nachdem dessen Besitzer ihr ein eher zweifelhaftes Kompliment ins Ohr geraunt hatte.
Mina war eine echte Schönheit.
Doch nicht ihre Schönheit war der Knackpunkt. Schönheit kann eine aristokratische Aura verleihen, sie kann jemanden unnahbar erscheinen lassen oder sogar einschüchternd. In diesem Fall hätte sie wie eine Art Burggraben gewirkt, was Mina sehr zupassgekommen wäre. Doch dummerweise hatte Minas Schönheit eher die Wirkung einer ordentlich gebutterten, dick mit Honig bestrichenen Scheibe Weißbrot, die an einem Sommermorgen draußen auf dem Balkon auf dem Frühstücksteller lag.
Mina war aufregend. Die Zusammenstellung ihrer Gene hatte den Typ Frau aus ihr gemacht, auf den sowohl Lastwagenfahrer wie Ärzte standen, Kellner wie Steuerberater, Laufburschen wie Großherzöge. Sie konnte ihren Körper noch so sehr unter sackartigen Pullovern oder zeltartigen Mänteln verbergen wie an diesem Morgen, und doch bekamen bei ihrem Anblick fast alle Männer Stielaugen, fielen ihnen die Kinnladen herunter, lief ihnen das Wasser im Mund zusammen und wurden ihre Finger lang. Es war wie ein Exorzismus, nur umgekehrt: Kaum näherte sie sich, bemächtigte sich ein Dämon der Männer und verwandelte sie in einen Haufen nervös flimmernder, ausgehungerter Zellen, die nur ein einziges Ziel kannten.
Dieses Phänomen vertiefte nur den Graben zwischen der von ihr angestrebten Lebensweise und derjenigen, die ihre Umwelt ihr aufzwang. Ihre Mutter wollte, dass sie ihre üppigen Formen als Kapital auf dem Heiratsmarkt betrachtete; ihre Freundinnen machten sich einen Spaß daraus, sich auszumalen, welche Chancen sie an Minas Stelle gehabt hätten. Sie selbst indessen wäre nur allzu gerne flach wie ein Bügelbrett gewesen und auch ansonsten eher der androgyne Typ, um gar nicht erst Gelüste aufkommen zu lassen und stattdessen von Anfang an rein freundschaftliche Beziehungen knüpfen zu können. Doch weit gefehlt.
Minas Körper, dem offenbar sogar das fortschreitende Alter nichts anhaben konnte, war der Traum schlechthin von Pornostars und Schönheitschirurgen. Dunkle Augen, so tief wie ein Brunnen, rabenschwarze Haare (bis auf neun, wie es aussah), volle Lippen unter hohen Wangenknochen, lange Beine, glatter Hals, eine leicht gebogene Nase, auf deren Spitze eine Nickelbrille thronte, die wie eine raffinierte Beilage zur Hauptspeise wirkte: einem prächtigen Vorbau – aus der Perspektive seiner Besitzerin Problem Nr. 2 –, der sich selbst mit Körbchengröße E nicht begnügen wollte.
Endlich hatte Mina die Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln hinter sich und nahm mit raschen Schritten die steile Gasse in Angriff, die zur Beratungsstelle führte. Das war der Moment, in dem sich herausstellte, welcher Art dieser Tag tatsächlich sein würde. Denn Mina Settembre, die für sich beanspruchte, ein freier Geist zu sein, unbeeinflusst von religiösen oder philosophischen Strömungen, wie es nur die Absolventen von Klosterschulen sein können, hielt an einem Glauben unerschütterlich fest: dem an den sogenannten Scheißtag. Ein Zeitraum von vierundzwanzig Stunden, in dem getreu nach Murphys Gesetz, demzufolge alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird, ein negatives Erlebnis auf das nächste folgte.
Ausschlaggebend würde das Auftauchen oder eben Nichtauftauchen eines bestimmten Individuums im Treppenhaus der heruntergekommenen Mietskaserne sein, in der sich Minas Büro befand. Es handelte sich um den Möchtegern-Hausmeister Giovanni Trapanese alias Rudy, einen zu kurz geratenen Lustgreis, der sich bei Minas Anblick oder vielmehr dem von Problem Nr. 2 verhielt wie ein portugiesisches Hirtenmädchen angesichts einer Marienerscheinung.
Ihr Verhältnis war wie das von Raub- und Beutetier, bei dem Letzteres fest entschlossen ist zu überleben. Ein direkter Zweikampf wäre sicherlich zu Minas Gunsten ausgegangen, die dem Zwerg körperlich weit überlegen war, doch dazu wollte sie es nun wirklich nicht kommen lassen, sei es wegen des fortgeschrittenen Alters des Mannes, das dieser mit einer ins Bläuliche tendierenden schwarzen Haartönung zu kaschieren versuchte, sei es wegen der ihn umhüllenden Duftwolke, die auf mindestens eine halbe Flasche Aftershave zurückzuführen war. Rudy erfolgreich auszuweichen bedeutete immerhin eine gewisse Chance, dass der Tag sich doch noch zum Besseren wandte. Wenn sie jedoch Rudy in die Arme lief und ihn sich vom Hals halten musste, war dies ein untrügliches Zeichen für einen SchT oder, wenn es sich um einen Montag handelte, sogar für eine SchW.
Vorsichtig schlüpfte Mina durch das Eingangsportal. Keine Spur von Rudy, nicht mal eine olfaktorische. Gut. Sie trat zum Aufzug, der wie so oft kaputt war. Schlecht. Also wandte sie sich zu der frisch geputzten und somit rutschigen Treppe. Schlecht. Bis zum ersten Treppenabsatz begegnete sie keiner Menschenseele. Gut.
Den Blick fest auf die schmalen Stufen gerichtet, um nicht zu stolpern, war Mina schon fast am Ziel angekommen, als beim allerletzten Treppenabsatz die Abfolge unterbrochen wurde.
Das clevere Raubtier hatte seine geringe Körpergröße und die steile Treppe strategisch so zu nutzen gewusst, dass seine Position ihm erlaubte, bei der fingierten zufälligen Begegnung das verzückte Gesicht direkt in Problem Nr. 2 zu versenken.
Nun gab es keinen Zweifel mehr daran, in welche Richtung sich dieser Tag entwickeln würde.
5
Der Aufstieg in den siebten Stock und von dort weiter ins Dachgeschoss hatte dem Gerichtsarzt sichtlich zu schaffen gemacht. Um Atem ringend stützte er sich am Türpfeiler ab und versuchte, eine Begrüßung zu stammeln, doch mehr als ein asthmatisches Keuchen brachte er nicht heraus.
Das Auffälligste an dem spindeldürren Mann mit der Halbglatze und den schmalen Schultern war sein herabhängender Schnurrbart. Ob die hellgelbe Färbung vom Nikotin herrührte oder einfach nur ein fahles Blond war, ließ sich nicht eindeutig feststellen, jedenfalls hatte der Mann die Angewohnheit, auf seinen Schnurrbartenden herumzukauen, sobald er sich gedanklich mit komplexeren Dingen befasste. Maresciallo Gargiulo erinnerte er an eine Figur aus einem ungeliebten Kinderbuch längst vergangener Zeiten, das seine Mutter ihm immer vorgelesen hatte, wenn er etwas essen sollte, das er nicht mochte. Noch dazu fand er die Angewohnheit, an den eigenen Barthaaren zu lutschen, so widerlich, dass er jedes Mal an sich halten musste, den Mann nicht mit einem Genickschuss ins Jenseits zu befördern.
Im Moment jedoch schien der mit halboffenem Mund nach Luft schnappende Dottor Blasi weit davon entfernt, sich an seiner Gesichtsbehaarung zu vergehen. Als er wieder zu Atem gekommen war, sagte der Gerichtsmediziner:
»Guten Morgen in die Runde und danke dafür, dass ihr euch ein mehrstöckiges Gebäude ohne Aufzug ausgesucht habt. Ist so was im dritten Jahrtausend überhaupt noch legitim?«
De Carolis bedachte ihn mit einem genau auf die Witterung abgestimmten kühlen Blick. Wegen des offenen Fensters und dem vor Stunden erkalteten Heizofen lag die Raumtemperatur deutlich unter null.
»Auch schon da, Dottor Blasi? Es fragt sich in der Tat, warum Signor Gravela nicht auf die Idee gekommen ist, im Keller statt auf dem Speicher zu sterben. Nicht nur Sie hätten das für eine bessere Idee gehalten. Aber die Leute sind nun mal merkwürdig, wie wir wissen.«
»Aber so was von merkwürdig! Und dann noch dieser mangelnde Respekt gegenüber einem armen alten Gerichtsmediziner, der keine Treppen mag. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier, nicht wahr? Heutzutage kann man sich ja schon glücklich schätzen, wenn man überhaupt noch einen Job hat. Woran ist er denn gestorben, weiß man das bereits?«
Gargiulo zog den Kopf zwischen den Schultern ein, als würde er jeden Moment ein gewaltiges Donnerwetter erwarten. Der Staatsanwalt musterte den Gerichtsmediziner mit dem Gesichtsausdruck eines Verhaltensforschers beim Anblick eines Krokodils, das sich für einen Tiger hält und einen Affenbrotbaum besteigen will.
»Interessante Frage, Dottore. Genau aus dem Grund haben Gargiulo und ich Sie zu unserer kleinen Party hier eingeladen. Auch weil wir wissen möchten, ob der Herr auf dem Feldbett wirklich tot ist oder nur die Luft anhält, um uns ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Was meinen Sie, würden Sie uns netterweise helfen, dieses Rätsel zu lösen?«
Wenn De Carolis es nicht selbst tun sollte, würde er höchstpersönlich Hand anlegen, dachte Gargiulo, der den auf seinen Schnurrbartenden herumkauenden Blasi inzwischen als den perfekten Kandidaten für den zweiten Todesfall im Dachgeschoss ansah.
»Nein, nein, ich glaube, er ist wirklich tot, Herr Staatsanwalt. Sehen Sie? Er atmet nicht mehr. Klar, man braucht eine gewisse Routine, um das zu erkennen, über die ein Laie natürlich nicht verfügt, aber Sie können mir glauben, unser Mann hier ist tot.«
Schon begannen die Kiefermuskeln des Staatsanwalts zu zucken, und schon begann Gargiulo, sich innerlich auf das Schauspiel vorzubereiten, wie De Carolis den Arzt bei lebendigem Leibe verschlang. Doch zu seiner großen Enttäuschung betrat in dem Moment Signora Santina Raffone das Dachgeschoss, die Hausmeisterin mit dem Nebenberuf der Leichenfinderin. Mit ihrem Dutt und der überschlanken Figur wirkte sie vollkommen alterslos. Ihre kleinen dunklen Augen huschten misstrauisch von einem zum anderen, wobei sie sorgsam vermied, Richtung Pritsche zu schauen.
De Carolis stellte erst sich selbst und dann Gargiulo und Blasi vor. Während Letzterer mit einem Stöhnen vor dem Toten auf die Knie ging, um ganz sicher dessen Tod zu konstatieren, befragte der Staatsanwalt die Frau über die Örtlichkeit und die Leute, die Zutritt zum Dachboden hatten.
»Der Speicher ist für alle da, Dottore. Früher stand hier ein Heizkessel, der aber irgendwann weggeschafft wurde, weil inzwischen alle im Haus ihre eigene Heizung haben. Der Professore hat mich vor ein paar Jahren um einen Schlüssel zu der Tür gebeten, die der Verwalter hat einbauen lassen, damit das Haus keiner von oben betritt.«
De Carolis nickte, als hätte Santina Raffone ihm die gewünschte Antwort geliefert.
»Und wer hat noch einen Schlüssel?«
»Niemand, Dottore. Eigentlich hätte nicht mal der Professore einen haben dürfen, aber er war so ein netter Mann, immer so freundlich. Das kann man wirklich nicht von allen Hausbewohnern sagen, wissen Sie?«
Der Staatsanwalt schwieg, als hinge er seinen Gedanken nach. Schließlich sagte er:
»Wie kommt es, dass Sie ihn gefunden haben? Oder vielmehr: Warum waren Sie überhaupt hier oben? Das ist doch eher nicht der Ort, um dort seine Freizeit zu verbringen.«
Ein kaum merkliches Zucken durchlief den Körper der Frau. Gargiulo spitzte die Ohren.
»Der Professore hat eine kleine Enkelin, Fabiana. Sie ist zehn Jahre alt. Heute Morgen, bevor sie zur Schule ging, hat sie zu mir gesagt: ›Santina, der Nonno hat nicht geantwortet, als ich ihn aufwecken wollte, vielleicht schläft er noch. Kannst du ihn bitte für mich wecken? Sonst mache ich mir Sorgen.‹ Sie redet wie eine Erwachsene, Dottore, sie ist sehr reif für ihr Alter.«
Der Staatsanwalt beugte sich vor, als hätte er nicht richtig gehört. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren.
»Verzeihung, Signora, das verstehe ich nicht. Wohnte der Professore nicht unten in der Wohnung bei seiner Familie? So wurde es mir jedenfalls berichtet.«
Gargiulo stieg die Röte in die Wangen. Die Frau erlöste ihn aus seiner Verlegenheit.
»Doch, doch, Dottore. Das habe ich dem Maresciallo hier auch so gesagt. Der Professore wohnte in der Wohnung von seinem Sohn, zusammen mit der Familie. Aber …« Sie hielt einen Moment inne, als müsste sie sich erst sammeln. »Ich kümmere mich nur meine eigenen Angelegenheiten, Dottore. Ich tue das, was getan werden muss, ansonsten gibt es zwischen mir und den Mietern nichts als Guten Morgen und Guten Abend. Es gibt nicht mehr viele von unserer Sorte, wissen Sie. Die Verwalter lassen überall Sprechanlagen und automatische Türöffner einbauen, und für den Rest stellen sie Putzfirmen ein. Auf diese Weise sparen sie sich die Sozialabgaben, die Anzahl der Wohnungseinbrüche steigt, und die Treppenhäuser starren vor Dreck, weil sich niemand mehr verantwortlich fühlt.«
Gargiulo und De Carolis wechselten einen Blick. Worauf wollte die Frau hinaus?
»Aber ich bin keine Sprechanlage, sondern ein menschliches Wesen, also sehe und höre ich bestimmte Dinge, auch wenn ich mich nur um meine eigenen Angelegenheiten kümmere. Der Professore, nun … manchmal hat er lieber hier oben übernachtet. Sein Sohn hat drei Kinder, zwei fast erwachsene Söhne und das kleine Mädchen, die Wohnung ist so groß, wie sie ist … Vor allem die Signora, die Schwiegertochter des Professore, ist froh, wenn sie ein Zimmer mehr hat. Deshalb hat er mich gefragt … Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist vertraulich.«
Der Staatsanwalt, der eine Kehle gefunden hatte, in der er sich verbeißen konnte, ließ nicht locker.
»Signora, bei mir gibt es nichts Vertrauliches. Aber es gibt so etwas wie Aussageverweigerung – schon mal gehört? Nein? Das heißt, jemand weiß etwas, sagt es aber nicht. Und wenn es dann doch rauskommt, geht dieser Jemand in den Knast. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
Die Frau schluckte. Gargiulo fragte sich, ob auch Frauen einen Adamsapfel hatten.
Schließlich schien Santina Raffone eine Lösung für ihren inneren Konflikt gefunden zu haben.
»Der Professore ist zum Schlafen hergekommen. Bis zum Abendessen war er immer in der Wohnung – auch weil die Kleine so an ihrem Nonno hing und immer mit ihm zusammen sein wollte. Danach ist er hier hochgegangen. Die Signora steckt mir jeden Monat eine Kleinigkeit zu, damit ich es nicht weitersage.«
Der Speicher strahlte tatsächlich fast so etwas wie Gemütlichkeit aus. Es gab eine Lampe, einen Tisch, einen Stuhl und eine Obstkiste als Regal-Ersatz. Sogar ein paar Bücher standen in einer Ecke. De Carolis trat näher und studierte die Titel. Romane, einige Sachbücher. Und ein altes Schulbuch.
Leise stöhnend erhob sich der Gerichtsmediziner aus seiner knienden Haltung. Seine Gelenke knackten.
»Also, ich habe gesehen, was ich sehen musste. Alles Weitere nach der Obduktion.«
De Carolis drehte sich zu ihm um.
»Obduktion? Warum denn das, Dottore? Handelt es sich etwa nicht um einen natürlichen Tod?«