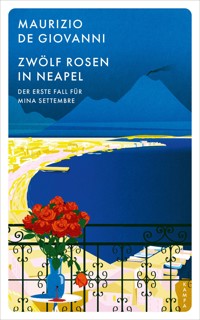
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Gelsomina Settembre, von allen nur Mina genannt, ist Sozialarbeiterin in einem der verkommensten Stadtteile Neapels, den Quartieri Spagnoli. Sie selbst stammt aus besseren Verhältnissen, und so mancher wundert sich darüber, mit welcher Verve sich die »Lady« für die Kranken, Schwachen und Armen einsetzt. Nach dem Eheaus mit Claudio, einem distinguierten Richter, der Mina immer noch hinterhertrauert, ist die 42-Jährige eher widerwillig wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: den tollpatschigen, dafür umso attraktiveren Arzt Domenico, der seine Praxis neben Minas Büro hat. Wenn Domenico nur endlich in die Gänge käme ... Unterdessen ist Minas Ex-Mann Claudio mit einem rätselhaften Fall befasst: Ein Serienmörder macht die Stadt unsicher. Nach jedem seiner scheinbar beliebigen Morde findet man eine Vase mit zwölf Rosen am Tatort, einige verblüht, andere noch frisch. Was Claudio nicht weiß: Mina bekommt jeden Tag eine Rose und hat selbst die Ermittlungen aufgenommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Zwölf Rosen in Neapel
Der erste Fall für Mina Settembre
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth
Kampa
Für Daria,
die mit einem Lächeln dahinfliegt
1
Gelsomina Settembre, genannt Mina, machte einen Waldspaziergang, mitten in der Nacht.
Das glitschige Laub, die tief herabhängenden Äste und der leichte Nordwind, der ihre Haut aussehen ließ wie die eines gerupften Huhns, waren nicht eben angenehm, doch Mina wusste, es gab Schlimmeres, viel Schlimmeres. Also genoss sie den Spaziergang, in dem Wissen, dass alles Schöne irgendwann ein Ende hat – wie ihr im Übrigen auch die ersten paar Takte von I will survive bestätigten, die ihr Unterbewusstsein in Endlosschleife abspielte. Sie wollte das Ende unbedingt hinauszögern, deshalb nahm sie stur ihren Weg zwischen den Bäumen, ihre nackten Füße tappten über die weiche Erde, kein Zweig verhakte sich im flatternden Saum ihres Nachthemds, auf dem das Gesicht von Daisy Duck prangte.
Der Wald in der Nacht, dachte sie, während sie allmählich von der Tiefschlaf- in die REM-Phase hinüberglitt, ist vielleicht doch kein so unwirtlicher Ort. Klar, man weiß nicht, was sich im Dunkeln alles verbirgt, aber auch man selbst wird unsichtbar, und selbst wenn man niemanden überfallen oder keinem harmlosen Pflanzenfresser an die Gurgel will, kann man doch wenigstens versuchen, unbeobachtet seiner Wege zu gehen. Und jemand mit einer Comic-Ente mit rosa Schleife auf der Brust sollte wohl auch besser ungesehen bleiben. Vor allem, wenn das Gesicht der Ente durch die beachtliche Wölbung unter dem Nachthemd völlig deformiert ist.
In der Ferne brach Gloria Gaynor oder wer auch immer an ihrer statt das Intro auf halber Strecke ab. Aus irgendeinem Grund fühlte Mina sich plötzlich bedroht. Im selben Moment fand sie sich am Rand einer Lichtung wieder. Ein quer über den Weg ragender Ast versperrte ihr den Zutritt. Fast wäre sie mit dem Kopf dagegen gestoßen, was dramatische Konsequenzen hätte haben können, denn ein riesiger Nachtvogel, vielleicht ein Waldkauz, vielleicht eine Schleiereule, saß reglos auf dem Ast und starrte sie aus weit aufgerissenen Augen an. Mina stieß einen lautlosen Seufzer aus.
Ihr Unterbewusstsein raunte ihr zu: »Hast du gesehen? Was habe ich dir gesagt? Gloria Gaynor, Daisy Duck, der Wald. Alles klar, oder?«
Ergeben streckte Mina die Waffen und öffnete ihr linkes Auge einen Millimeter weit. Ein sachkundiger und zugleich objektiver Beobachter hätte dies als ein Zucken des Augapfels interpretieren können, wie es in der REM-Phase häufig vorkommt. In Momenten größter Verzweiflung greift man gern nach jedem Strohhalm.
Mit verquollenen Lidern, noch dazu ohne ihre Kontaktlinsen blind wie ein Maulwurf, versuchte Mina zu deuten, was sich ihrem eingeschränkten Blickfeld bot: ein ebenso bekanntes wie gefürchtetes Gesicht, mit einem riesigen Auge in der Mitte, wie das der Nachteule, das sie ausdruckslos fixierte. Jeder andere wäre in einer solchen Situation zu Tode erschrocken aus dem Bett gesprungen. Mina hingegen verhielt sich aus alter Gewohnheit wie ein in die Enge getriebenes Tier, das sich instinktiv tot stellt, und atmete so tief ein und aus, dass ihr Gegenüber sie zwangsläufig für schlafend halten musste. Früher hatte das hin und wieder funktioniert. Zwei-, dreimal immerhin im Lauf von zweiundvierzig Jahren.
Mit maliziöser Genugtuung krächzte das Auge:
»Ah, da sind ja welche. Auf beiden Seiten sogar.«
»Hährm?«, erwiderte Mina, einerseits um Zeit zu gewinnen, andererseits aus dem sehr menschlichen Unvermögen heraus, sich um diese Uhrzeit schon angemessen zu artikulieren.
Sie räusperte sich und versuchte es noch einmal.
»Was?«
Das Auge, das die ganze Zeit nicht einmal geblinzelt hatte, sagte triumphierend:
»Krähenfüße! An beiden Seiten, rechts und links. Richtig schöne Krähenfüße, wie gemalt! Mal ganz zu schweigen von der tiefen Falte zwischen den Augenbrauen und den Anzeichen von Hamsterbäckchen. Deine Haut wird schlaff, keine Frage. In ein paar Monaten oder gar Wochen war’s das mit der blühenden Jugend. Dann siehst du aus wie eine alte Schachtel.«
Mina seufzte und öffnete resigniert die Augen. Der Wecker würde frühestens in einer halben Stunde klingeln, was bedeutete, man hatte sie um den wertvollsten Teil ihres Schlafes gebracht. Zu allem Überfluss hatte sie sich auch noch diese erfreulichen Prognosen über ihre ästhetische Zukunft anhören müssen.
»Guten Morgen, liebe Mama. Ich sehe schon, du bist mit dem rechten Fuß zuerst aufgestanden.«
Sichtlich zufrieden richtete sich die vermeintliche Nachteule in ihrem Rollstuhl auf und vollführte taktschlaggenau zum Intro von I will survive eine elegante Drehung, um die optimale Distanz für ihre Attacke herzustellen.
»Du kannst dir dein ›Guten Morgen‹ in die Haare schmieren«, bemerkte sie mit einem bösen Lächeln. »Hast du immer noch nicht kapiert, dass die Welt von heute – für die wohlgemerkt deine Generation verantwortlich ist und nicht meine, die noch ganz andere Werte und Prinzipien hatte – älteren Frauen kein würdiges Leben bietet? Du müsstest eigentlich besser wissen als ich, dass alles immer mehr den Bach runtergeht. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dich darauf aufmerksam mache.«
Um eine passende Erwiderung ringend, die ihr vermutlich erst in fünf oder sechs Stunden einfallen würde, also viel zu spät, versuchte Mina, in ihrem Bett Haltung anzunehmen.
»Danke, Mama, danke. Was soll ich dazu sagen? Du erinnerst mich an diese Mönche im Mittelalter, die den Leuten auf der Straße ständig erzählt haben, dass sie eines Tages sterben würden. Einfach so, damit sie es auch ja nicht vergessen.«
Ihre Mutter verzog die Lippen zu einem zufriedenen Lächeln. Es war gerade mal halb sieben, doch wie immer waren ihre violett schimmernden Haare bereits perfekt gelegt und ihr Make-up makellos. Mina konnte sich nicht erinnern, sie jemals anders gesehen zu haben. Wäre sie nicht an den Rollstuhl gefesselt, sie hätte sich garantiert aufgemacht, das Familienglück anderer Leute zu ruinieren, davon war Mina fest überzeugt.
»Abgesehen vom Sex natürlich.«
O nein, dachte Mina, bitte nicht dieses Thema. Nicht um diese Uhrzeit.
Sie versuchte, das Bett zu verlassen, doch der Rollstuhl war strategisch so positioniert, dass sie keinerlei Bewegungsfreiheit hatte.
»Die einzige Option für jemanden wie dich – und ich betone, die einzige –, wenn du nicht irgendwann als zahnlose Alte im Armenhaus landen und täglich fade Brühe schlürfen willst, ist Sex. Ehrlich gesagt ist das nicht mal die schlechteste aller Möglichkeiten.«
»Mama, ich bitte dich, fang nicht schon wieder damit an! Ich will nicht mit dir über so was reden – du bist meine Mutter, verdammt noch mal!«
Concetta Settembre verzog das Gesicht.
»Ja, leider. Hätte das Schicksal es doch nur gewollt, dass du nicht nach deinem Vater kommst, diesem armen Irren, Gott hab ihn selig, sondern nach mir, die ich mit beiden Füßen im Leben stehe …«
»Mama, auch ich stehe mit beiden Füßen im Leben. Ich habe einen Job, gehe gerne aus, habe viele Freunde und …«
Eine Salve nach der anderen abfeuernd, begann die Frau im Rollstuhl ihre Sätze an den Fingern abzuzählen:
»Jemand, der praktisch veranlagt ist, denkt an die Zukunft. Jemand, der an die Zukunft denkt, sorgt finanziell vor. Jemand, der finanziell vorsorgt, heiratet gut. Und gut heiraten heißt, sich einen reichen Mann zu suchen, der so schwach auf der Brust ist, dass man ihn langsam, aber sicher in die Knie zwingen kann. Aber von solchen Überlegungen hast du dich ja schon lange verabschiedet, nicht wahr?«
Mina hielt noch immer Ausschau nach einer Lücke, in die sie vorstoßen konnte, um das Bett zu verlassen, doch rational und analytisch, wie Concetta war, durchkreuzte sie ihren Plan, indem sie den Rollstuhl unter rhythmischem Quietschen permanent vor- und zurücksetzte.
»Pass auf, Mama, für mich gehört zu einer echten Beziehung wirklich mehr als … als … nun, als das, was du darunter verstehst. Der Richtige kommt schon noch, wenn es denn so sein soll, abgesehen davon hat man heute als Frau alle Möglichkeiten, ein unabhängiges Leben zu führen, und …«
»So ein Quatsch!«, fuhr Concetta ihr über den Mund. »Heute wie gestern muss eine Frau in erster Linie dafür sorgen, dass der Mann, mit dem sie zusammenlebt, Gefallen an ihr findet. Sonst wird man eine frustrierte alte Jungfer, die einen auf Kerl macht, ohne es zu sein. Guck dir doch deine Freundinnen an: Je nuttiger, desto erfolgreicher. Wobei wir hier nicht vom Job reden, versteht sich.«
Wie eine Meerbarbe auf dem Trockenen schnappte Mina ein paar Mal hektisch nach Luft und ging im Geiste ihre weiblichen Bekannten durch, um eine belastbare Alternative zu diesem mittelalterlichen Frauenbild zu finden.
Concetta lächelte mephistophelisch.
»Du brauchst dir gar keine Mühe zu geben, ich kann dir auf Anhieb die Top Twenty der erfolgreichsten Frauen nennen, und die haben sich durch Sexappeal und nicht durch Hirnschmalz hervorgetan. Womit bewiesen wäre, dass eine Schlampe, die jederzeit die Beine breit macht, eindeutig bessere Chancen im Leben hat als ein Blaustrumpf.«
Mina beschloss, dass es für die Tageszeit nun wirklich genug war. Begleitet von einem schrillen Protestschrei Gloria Gaynors schob sie energisch den Rollstuhl zur Seite, um sich den Weg ins Bad frei zu machen.
»Ich sage das ja nur wegen dir!«, brüllte Concetta ihr hinterher. »Du hast nicht mehr viel Zeit. Genau genommen gar keine mehr, vergiss das nicht! Immerhin warst du schon mal verheiratet, aber in deiner unendlichen Dummheit hast du deinen Mann ja verjagt. Was nicht weiter schlimm wäre, wenn du wenigstens gewisse Talente im horizontalen Fach hättest. Aber dumm sein und keine Schlampe, das geht gar nicht, außerdem …«
Die logischen Schlussfolgerungen ihrer Mutter gnadenlos unterbrechend, knallte Mina die Tür zum Badezimmer hinter sich zu. Doch dort lauerte schon der nächste Feind, der Spiegel.
So verletzend die Verbalattacken ihrer Mutter auch waren, so wenig unterschieden sie sich inhaltlich von Minas eigenen vagen Befürchtungen, was sie sich allerdings nur höchst ungern eingestand. Erstens war sie mit ihren zweiundvierzig Jahren noch immer Single und wohnte in ihrem alten Kinderzimmer. Zweitens hatte sie eine gescheiterte Ehe hinter sich. Und drittens würde ihre soziale Ader, die bei ihrer Berufswahl eine wichtige Rolle gespielt hatte, sie weder auf der Karriereleiter nach oben befördern, noch ihr die finanzielle Unabhängigkeit einbringen, die sie in früheren Gefechten so hochgehalten hatte.
In ihren Selbstgesprächen hatte sie Concetta einen Spitznamen gegeben: »das Problem«. Doch dummerweise war ihre Mutter nicht ihr einziges Problem. Etwa drei Handbreit unter den neu auf den Plan getretenen Krähenfüßen warf Daisy Duck ihr einen prüfenden Blick zu. Sie schielte: Ihr eines Auge war lang gezogen, das andere riesengroß. Und während ihr Schnabel von einem gewaltigen Überbiss zeugte, schien die Schleife auf ihrem gefiederten Schädel wie bei einer Zwanzigerjahre-Frisur nach hinten gekämmt.
Mina schüttelte seufzend den Kopf. Jenes zweite »Problem« hatte zur Folge, dass ihre Mutter hartnäckig an der Hoffnung festhielt, sie eines Tages doch noch in der Kategorie »Schlampe« verorten zu können. Seit ihrer Pubertät hatte es Mina den Dialog mit dem anderen Geschlecht erschwert, da fast alle Männer bei ihrem Anblick erst einmal grinsen mussten und danach große Schwierigkeiten hatten, sich auf ein Gespräch mit ihr zu konzentrieren. Die Frauen hingegen waren meist grün vor Neid oder konnten sich hämische Bemerkungen über die Notwendigkeit von Schönheits-OPs nicht verkneifen. Und jeden Tag, den Gott werden ließ, konfrontierte Problem Nummer 2 sie erneut voller Stolz mit der Frage: »Na, wie willst du mich heute verstecken?«
Denn Mina war die unglückliche, verunsicherte Besitzerin eines ungeheuren Vorbaus, der sich weder mit einem BH in Körbchengröße E begnügen wollte, in den sie ihn seit ihrem sechzehnten Lebensjahr zu pressen versuchte, noch den Gesetzen der Schwerkraft unterworfen schien und beharrlich ihren Wunsch ignorierte, für ihren Charakter und nicht ihr Äußeres geliebt zu werden.
Nicht dass Mina unattraktiv gewesen wäre, im Gegenteil. Ihre drei besten Freundinnen, die sich als Einzige aus ihrem vorigen bürgerlichen Leben mit mühsam ertragenen Jachtclubpartys und Teegesellschaften auf Kreuzfahrtschiffen hinübergerettet hatten, die sich mit sämtlichen erlaubten und nicht erlaubten Mitteln dem Zahn der Zeit zu widersetzen suchten, diese »Mädels« machten ihr die heftigsten Vorwürfe, weil ausgerechnet Mina, die sich keinen Deut um ihr Äußeres scherte, die Schönste von ihnen allen war. Ihre glänzenden schwarzen Haare, die hohen Wangenknochen, die ausdrucksvollen dunklen Augen verdienten mit Sicherheit Aufmerksamkeit – doch Problem Nummer 2 war einfach unschlagbar.
Einmal hatte Mina sich vorsichtig bei einem Arzt nach einer Brustverkleinerung erkundigt, allein der Information halber, da sie im Grunde schreckliche Angst vor chirurgischen Eingriffen hatte und weit davon entfernt war, ein Skalpell an ihren Körper heranzulassen. Der Arzt hatte sie ungläubig angestarrt, ein paarmal geschluckt, seine Brille abgenommen, die Gläser poliert, die Brille wieder aufgesetzt und zu einer Antwort angehoben. Doch seine Stimme hatte sich in einem pubertären Quieken überschlagen, woraufhin er sich geräuspert hatte, um ihr mit hochrotem Kopf zu versichern, dass sein medizinisches Ethos ihm verbiete, Hand an einen gesunden Körperteil zu legen, der einen solchen Eingriff nicht nötig hatte. Anschließend hatte er sie nach ihrer Handynummer gefragt.
Von Krähenfüßen oder Ähnlichem war dort jedenfalls keine Spur, dachte sie, nachdem sie sich Daisy Ducks entledigt hatte, die sofort wieder normale Proportionen annahm. Selbst als Greisin würde Mina wohl kaum jemand abnehmen, dass sie nicht all ihr Geld in Schönheits-OPs gesteckt hatte, um als Busenwunder das Zeitliche zu segnen. Ironie des Schicksals für jemanden, der sein Brot als Sozialarbeiterin im Spanischen Viertel und nicht als Wäschemodel verdiente.
Ihre Gedanken wanderten zu Claudio, ihrem Exmann, und seiner Angewohnheit, beim Anblick ihres nackten Körpers für einen Moment innezuhalten und die Augen zu schließen, als suchte er nach Inspiration, um der Herausforderung gerecht zu werden.
Und sofort flogen ihre vorlauten, unkontrollierbaren Gedanken weiter, während der Spiegel das Traumbild einer jeden Pornodarstellerin zurückwarf, die sich die Zähne putzte, und ließen vor ihren kurzsichtigen Augen das Gesicht eines breitschultrigen blonden Hünen im weißen Kittel aufscheinen.
Wie soll ich mich dir gegenüber bloß verhalten, fragte Mina den Spiegel.
Doch der blieb ihr die Antwort schuldig.
2
Am Ende bist du tatsächlich Anwalt geworden.
Schon merkwürdig: Als wüsste etwas in uns weit im Voraus, wie das Leben so spielt. Als bekäme man bereits zu einer Zeit, in der alles noch wirr und konfus ist, erste Einblicke in eine ferne Zukunft.
Weißt du, ich erinnere mich nicht mehr an alle von euch. Natürlich war ich an jenem Abend dabei. Wir waren alle dabei – voller Hoffnungen und Erwartungen an das Morgen. Ich war dabei, aber meine ganze Aufmerksamkeit galt einer bestimmten Person; du kannst dir vorstellen, wem. Meine Erinnerung ist nur noch bruchstückhaft. Gäbe es ein Zurück, würde in Anbetracht der Ereignisse meine Aufmerksamkeit allerdings euch allen gelten. Ja, hätte ich eine Zeitmaschine und könnte mir einen Moment aussuchen, einen einzigen, den ich noch einmal erleben wollte, dann fiele meine Wahl wohl nicht auf einen jener Momente unseres gemeinsamen Glücks, als wir alle noch im siebten Himmel schwebten. Nein, ich würde genau dorthin zurückkehren wollen, zu jenem Abend, und mir alles ganz genau anschauen, ohne auch nur ein einziges Wort, eine einzige Geste zu verpassen.
Vielleicht wäre ich dann in der Lage zu rekonstruieren, wer für was verantwortlich war und wie viel Schuld auf sich geladen hat. Aber vermutlich wäre das gar nicht nötig, meinst du nicht? Denn wenn eines so sicher ist wie das Amen in der Kirche, dann die Tatsache, dass ihr euch alle schuldig gemacht habt. Alle!
Du bist also Anwalt geworden. Richtig so. Den Akten auf deinem Schreibtisch nach zu urteilen würde ich sogar behaupten, du bist ein guter Anwalt geworden; man sieht sofort, dass es sich um hoch komplexe Dinge handelt. Gesellschaftsrecht, nicht wahr? Du benutzt einen Rotstift, wie ein Grundschullehrer. Du schreibst Bemerkungen an den Rand der Dokumente, unterkringelst zu korrigierende Passagen, fügst Ergänzungen ein. Du machst das wirklich gut. Ich verstehe nicht viel davon, natürlich nicht, woher auch, ich bin ja eher simpel gestrickt. Aber man merkt in der Regel sofort, wenn jemand seinen Job beherrscht, und du tust das ganz offensichtlich.
Mir gefällt das. Eine gewisse Professionalität zu erreichen, Erfolg im Beruf zu haben muss etwas sehr Schönes sein. Du bist ganz bestimmt niemand, den man übersieht; mit deinen Zweitausend-Euro-Anzügen, den Designerkrawatten und strahlend weißen Keramikzähnen bist du ein echter Hingucker. Ich erinnere mich, dass du schon als Junge etwas Besonderes warst. Einer, der sich seiner sicher war, dem die Welt zu Füßen lag.
Du hast diese besondere Art, dich zu konzentrieren, so wie jetzt. Ein wenig in der Hüfte eingeknickt, den sorgfältig ausrasierten Nacken über die Arbeit gebeugt. Interessant. Womit du dich wohl gerade befasst? Wahrscheinlich irgendwas Illegales.
Mal abgesehen von dem, was du getan hast: So ganz korrekt verhältst du dich immer noch nicht, was? Du bist Anwalt, und man weiß doch, dass Anwälte gerne tricksen. Sonst bräuchte man sie schließlich nicht. Sonst gäbe es sie gar nicht.
Deshalb lohnt es sich am Ende vielleicht doch. Womöglich tun wir sogar jemandem einen Gefallen, retten wir einen Unschuldigen, dem du etwas unterschieben willst, um einen anderen, der es sich gerade mit einem Longdrink am Pool gut gehen lässt, vorm Gefängnis zu bewahren, wo er eigentlich hingehört. Fangen wir mit dir an, der du schon damals eine Art Anwalt warst, und ja, das weiß ich sehr wohl noch, der du dich schon damals nicht korrekt verhalten hast. Alles andere als korrekt. Ja, du warst ein toller Typ, keine Frage, aber korrekt ist etwas anderes.
Aber ich will auch das, was ich zu tun gedenke, nicht kleiner machen. Ich brauche keine Rechtfertigung, ich muss mir nicht einreden, ich täte jemandem etwas Gutes – damit wir uns recht verstehen. So redet ihr Juristen doch, oder?
Du beginnst mit deinem Rotstift im Text zu streichen. Eine Zeile, zwei. Du schüttelst sogar den Kopf, wie um dein Missfallen zu betonen; vielleicht hat ja einer deiner Mitarbeiter Mist gebaut und wird morgen früh einen gewaltigen Anschiss von dir kriegen, wer weiß, vielleicht setzt du sogar jemanden vor die Tür.
Ich sehe schon, ich falle in mein altes Muster zurück, dabei muss ich mich gar nicht rechtfertigen. Du wirst lediglich den gerechten Preis für etwas zahlen, das du getan hast, zwar um viele Jahre verzögert, das stimmt, aber trotzdem ist der Preis angemessen. Was du danach Gutes oder Schlechtes vollbracht hast, ist dein Problem und das deines Gewissens; meinetwegen kannst du dich mit dem da oben arrangieren, das geht mich nichts mehr an.
Weißt du, wer ich bin, Herr Rechtsanwalt? Ich bin der Rotstift. Ein Objekt ohne Seele, ohne Schuld, dem niemand Beachtung schenkt, ohne Gewicht in jeder Hinsicht, ein Stift von vielen, der gut zu den anderen passt, dem grünen, dem blauen, dem schwarzen, und solange du ihn dort liegen lässt, tut er auch nichts Besonderes. Aber sobald du ihn zur Hand nimmst, wird er zu einer Tatwaffe; du streichst Wörter durch, tust so, als hätten sie niemals existiert, du korrigierst einen Absatz, und wer weiß, welches Schicksal, welches Leben dadurch einen anderen Lauf nimmt und nie mehr so sein wird wie zuvor.
Eine Fusion, eine Akquisition – es braucht nur eine Unterschrift unter einem Schriftstück, einem Vertrag. Und Dutzende, ja Hunderte von Familien sitzen auf der Straße. Nur damit dein Mandant mit dem Longdrink keine Steuern und Gehälter mehr zahlen muss. So ist es doch, nicht wahr, Herr Rechtsanwalt?
Aber wir haben uns ja vorgenommen, nicht Vergangenheit und Gegenwart in einen Topf zu werfen. Die Gegenwart ist dein Problem, im Gegensatz zur Vergangenheit.
Die Vergangenheit ist mein Problem. Ein Problem, das es zu lösen gilt.
Also, noch ein letzter Kontrollblick. In den anderen Büroräumen ist niemand mehr – was für eine schöne Angewohnheit, bis tief in den Abend hinein zu arbeiten, der Kapitän zu sein, der als Letzter von Bord geht. Alles ist in Ordnung, kein Mucks ist zu hören, die Straße liegt zwölf Stockwerke unter uns. Der Portier ist längst gegangen.
Die Rosen?
Da sind sie, in dieser hübschen Vase. Sie halten sich lange, nicht wahr? Kein Wunder bei dem Preis.
Nun, Herr Rechtsanwalt, es ist Zeit, dass der Rotstift seine Arbeit tut. Ja, die Zeit ist reif.
3
Die lange Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Beratungsstelle nutzte Mina in der Regel, um ihre Gedanken schweifen zu lassen. Sie dachte über sich selbst und ihr Leben nach, stellte Überlegungen an, was der vor ihr liegende Tag mit sich bringen könnte.
Was Fragen zu Religion und Schicksal anging, war sie zwar eher Agnostikerin, zumal ihr das nötige Wissen fehlte, sich eine fundierte Meinung zu bilden, dennoch war ihrer Seele das Konzept der Transzendenz nicht gänzlich fremd. Objektiv betrachtet schien es ihr angesichts ihrer eigenen Erlebnisse und täglichen Beobachtungen allerdings schwierig, an eine göttliche Vorhersehung zu glauben, und auch wenn sie häufig nach Mitteln und Wegen suchte, sich in Gelassenheit zu üben, glaubte sie nur bedingt an die Wirkungskraft fernöstlicher Lehren. Sie war eine praktisch veranlagte Frau, die vor allem ihren Nächsten behilflich sein wollte. Einer Mutter mit sechs vor Hunger weinenden Kindern, in deren Kellerloch die Ratten frei herumliefen, konnte ihrer Ansicht nach auch keine Zen-Meditation helfen.
Genauso wenig glaubte Mina an die Unausweichlichkeit des Schicksals. Für sie war jeder seines Glückes Schmied und konnte der menschliche Wille notfalls auch Berge versetzen. Und doch gab es da etwas Höheres, Übernatürliches, das sie als gegeben hinnahm. Und zwar mit der Resignation und Beharrlichkeit von jemandem, dessen Überzeugung unzählige Male Bestätigung erfahren hatte.
Mina glaubte an den »Scheißtag«.
Irgendeine höhere Macht schien dafür zu sorgen, dass alles, was ihr widerfuhr, stets nach demselben Muster ablief. Sie stellte sich einen Haufen Verschwörer mit entscheidendem Einfluss auf ihr Leben vor, die argwöhnisch um sich blickend mit verhüllten Gesichtern nacheinander an einem geheimen Ort eintrafen, einem Dachboden oder Keller, und dafür sorgten, dass bei ihr alles schieflief. Ein langer Tisch, am Kopfende ihre Mutter, die als Vorsitzende die Versammlung eröffnete – und ab ging die Post. Und zwar reibungslos, denn sobald der Scheißtag (den sie der Einfachheit halber mit dem Akronym »SchT« versehen hatte) einmal begonnen hatte, entfaltete er sich in seiner ganzen Pracht bis zum bitteren Ende wie eine meisterhaft komponierte Symphonie.
Aktuell manifestierte sich der SchT darin, dass sie bei der Wahl ihrer Kleidung einen eklatanten Fehler begangen hatte: Ihr weiter Pullover, der vor allem dazu diente, Problem Nummer 2 zu kaschieren, war eingelaufen, weil Sonia, die moldawische Zugehfrau von Problem Nummer 1, ihren Job wieder mal nur halbherzig erledigt hatte. Wie sehr der Pullover seinen sackartigen Charakter eingebüßt hatte, wurde Mina erst in dem Moment bewusst, als direkt vor ihrer Haustür ein Transporter auf einen Kleinwagen auffuhr, zum Glück ohne schwerwiegende Folgen, doch begleitet von einem Wutausbruch des Unfallopfers, woraufhin der Unfallverursacher, wie um sich zu rechtfertigen, mit dem Finger auf sie, Mina, zeigte.
Darüber hinaus hatte der SchT einen U-Bahn-Ausfall wegen Bauarbeiten und ein für November eindeutig zu mildes Klima anzubieten, sodass Mina viel zu spät zur Arbeit kam und das auch noch nass geschwitzt wie nach einem Workout im Fitnessstudio.
Die Beratungsstelle hatte ihren Sitz in einem heruntergekommenen Gebäude am Ende einer heruntergekommenen Gasse mit ein paar heruntergekommenen Geschäften im Erdgeschoss und einem heruntergekommenen düsteren Foyer, in dessen Ecke sich eine heruntergekommene Hausmeisterloge befand, in der folglich ein heruntergekommener Hausmeister hätte sitzen müssen. Doch ausgerechnet der Amtsinhaber unterbrach die Kette.
Mina blieb vor der Hausmeisterloge stehen und versuchte, die Dunkelheit mit ihren Blicken zu durchdringen. Sie war bereits zu spät dran und konnte sich eine Begegnung mit dem stolzen Besitzer dieser Vorhölle weniger denn je erlauben. Sie fühlte sich wie eine Gazelle in der Wüste, die, um zur Wasserstelle zu gelangen, durch das Revier des Löwen muss.
Niemand war zu sehen. Vielleicht war der Mann in eine Espressobar, ins Wettbüro oder in einen der illegalen Puffs gegangen, von denen es in der Gegend nur so wimmelte. Mit sechs, höchstens acht Schritten konnte sie den Treppenabsatz erreichen, ohne dass ihr Zeitproblem sich noch vergrößern würde. Sie holte einmal tief Atem und enterte das Gebäude mit schnellen Schritten, immer an der Wand entlang.
Doch der SchT konnte es sich nicht leisten, ausgerechnet in einer so wichtigen Angelegenheit zu versagen. Aus einem Kabuff, das Mina bisher nie aufgefallen war, obwohl sie diesen Ort schon seit Ewigkeiten aufsuchte, kam ein Männchen hervorgeschossen, das trotz seiner erhöhten Absätze keine ein Meter sechzig maß und zwischen siebzig und hundertzwanzig Jahre alt sein musste. Sein lebhafter dunkler Blick traf sie aus einem dichten Netz von Falten, die sich Jahrzehnten neckischen Zwinkerns verdanken mussten. Sein perfekt getrimmter Schnauzer war ebenso gefärbt wie die pechschwarze Haartolle.
Giovanni Trapanese, genannt Rudy, wegen seines unumstößlichen Glaubens, das Abbild von Rudolph Valentino in Der Scheich zu sein, nutzte die Chance, dass Mina vor lauter Schreck ihr Tempo verlangsamt hatte, und täuschte einen versehentlichen Zusammenstoß vor. Wieder einmal hatte der Löwe den Kampf gegen die Gazelle gewonnen.
Seine geringe Körpergröße und das zielgenaue Abpassen seines Opfers sorgten dafür, dass sein Aufprall von einem geradezu paradiesischen Airbag abgefedert wurde. Mina verfluchte im Stillen die SchT-Kommission, der Rudy zweifellos angehören musste.
Der Hausmeister war unter den Lüstlingen der Stadt mit Sicherheit der lüsternste. Frauen waren nicht nur das Haupt-, sondern das einzige Gesprächsthema von Trapanese, und Minas Busen bedeutete ihm ähnlich viel wie einem Kunstkritiker mit Stendhal-Syndrom ein echter van Gogh.
Rudy konnte also gar nicht anders, als jeder Frau auf die Brüste zu starren, während sich sein Mund unter dem rabenschwarzen Bärtchen zu einem ekstatischen Lächeln verzog und seine Zunge genüsslich über die Oberlippe fuhr. Und da er zu allem Überfluss auch noch schielte und seine beiden Sehachsen weit auseinanderdrifteten, hatte es den Eindruck, als spräche er zu den beiden Brüsten statt zu ihrer Besitzerin.
»Was für eine reizende Begegnung so früh am Morgen«, sagte er zur rechten Brust.
»Oh, Trapanese, guten Morgen. Ich habe Sie gar nicht gesehen«, würgte Mina hervor.
Der Mann wandte sich an die linke Brust.
»Kein Problem, das verstehe ich. Aber ich habe Sie gesehen, und das genügt.«
Mina blickte vielsagend in Richtung Aufzug.
»Der ist immer noch kaputt, was?«
»Was denken Sie denn, Dottoressa? Der Hausverwalter hat sich aus dem Staub gemacht, der Mann hat ein längeres Vorstrafenregister als ein Serienkiller. Hier bezahlen sie noch nicht mal die Reinigung des Treppenhauses, da steht der Aufzug ganz unten auf der Liste. Ich fürchte, Sie müssen zu Fuß gehen, Dottoressa. Aber ich kann Sie gerne begleiten.«
Das Angebot, das natürlich nicht an Mina, sondern an ihre Brüste gerichtet war, in der freudigen Erwartung, sie beim Treppensteigen auf und ab hüpfen zu sehen, wurde mit einem höflichen Lächeln abgelehnt.
»Und, was gibt’s Neues bei Ihnen oben?«, fragte der Hausmeister, während seine Zunge genießerisch über die Unterlippe leckte, um zuckend im rechten Mundwinkel zu verweilen.
»Nichts Besonderes, alles beim Alten. Die Warteschlange bei Dottor Gammardella ist lang wie immer, die Dottoressa Monticelli glänzt wie immer durch Abwesenheit, und die Putzleute haben wie immer eine Stunde früher Schluss gemacht.«
Mina schüttelte seufzend den Kopf. Auch der SchT war zuverlässig wie immer.
Sie warf einen raschen Blick auf die Uhr. Bereits eine halbe Stunde zu spät!
»Ist schon jemand für mich gekommen?«
Rudy schenkte ihrer linken Brust ein mildes Lächeln.
»Aber sicher, Dottoressa. Die Signora Ammaturo ist da, wie jeden Montag. Diesmal hat sie sogar ihren kleinen Sohn dabei.«
Mina musste zugeben, dass dieser SchT ein echter primus inter pares war. Und mit einem weiteren tiefen Seufzer, gefolgt von Trapaneses Blick, der ihren Hintern streichelte, als wäre er die Hand eines Sittlichkeitsstrolchs in einem übervollen Autobus, begab sie sich in das wie immer unter einer Dunstglocke aus Zwiebeln und Knoblauch liegende Treppenhaus.
4
Hinter dem pompösen Namen »Beratungsstelle West« verbarg sich ein heruntergekommenes Büro im dritten Stock eines Gebäudes, das, wie gesagt, seit einiger Zeit keinen funktionierenden Aufzug mehr besaß. Dort hinzugelangen wurde zusätzlich erschwert durch das letzte Stück Treppe, das auf merkwürdige Weise anders konstruiert war als der Rest.
Dies hatte seinen Grund in der Tatsache, dass die überwiegend im siebzehnten Jahrhundert errichteten Häuser des Spanischen Viertels wie lebendige Organismen waren, die mit den Jahren in alle möglichen Richtungen gewuchert waren. Die Beratungsstelle West – die ebenfalls irgendwann einmal geplante Beratungsstelle Ost hatte es nie in die Realität geschafft – lag in einem nachträglich eingezogenen Zwischengeschoss oberhalb der zweiten Etage, mit dem Ergebnis, dass die zu ihr führende Stiege sehr viel steiler war als die Treppen zu den unteren Stockwerken. Aber auch deren Stufen waren verhältnismäßig hoch – als ob ihren Benutzern von Anfang an ein Dämpfer verpasst werden sollte, damit sie den letzten Absatz nicht als ganz so große Zumutung empfanden.
Der billige Putz war schon lange von den Wänden abgeblättert, und das dank der chronisch durchgebrannten Deckenlampe vorherrschende Dämmerlicht hatte nicht selten für heftige Stürze bei Minas Klienten gesorgt. Schon oft war sie Ohrenzeugin der kreativsten Verwünschungen geworden, wenn sich wieder einmal jemand wie zu Kinderzeiten die Knie aufgeschürft oder den Hintern blaugestoßen hatte.
Zu ihren Klienten zählte eine Reihe Körperbehinderter, was Mina gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit, als sie noch voller Elan gewesen war, in das zuständige Amt geführt hatte, um lautstark dagegen zu protestieren, dass ausgerechnet diejenigen, die ihre Beratung am nötigsten hatten, gar nicht erst in der Lage waren, zu ihr zu gelangen. Die Sachbearbeiterin hatte ihre Brille abgenommen, sie mit einem herablassenden Lächeln gemustert (zumindest war es Mina so vorgekommen, in Wirklichkeit litt die Frau unter den Folgen einer partiellen Gesichtslähmung) und gesagt:
»Seien Sie doch froh, junge Frau! Dann haben Sie nicht so viel Andrang.«
Als die Beamtin merkte, dass Mina wenig Sinn für heitere Späße über ernste Angelegenheiten hatte, beeilte sie sich, den Ton zu wechseln.
»Damit ich Sie richtig verstehe: Soll das eine offizielle Beschwerde sein? Wenn ja, muss ich Ihnen jemanden für eine Besichtigung vorbeischicken. Da sich niemand unnötigen Ärger aufhalsen will, wird der Kollege vermutlich zu dem Schluss kommen, der Ort sei für Ihre Zwecke völlig ungeeignet. Und weil auch wir hier beim Amt uns keinen unnötigen Ärger aufhalsen wollen, werden wir die Beratungsstelle dann wohl schließen müssen. Was bedeutet, dass sie so lange geschlossen bleibt, bis sich irgendwo anders geeignete Räumlichkeiten finden lassen. Und das dürfte kaum realistisch sein. Also, was möchten Sie tun, Dottoressa? Möchten Sie schriftlich Beschwerde einreichen? Sagen Sie es ruhig. Soll ich ein Formular holen, damit wir es zusammen ausfüllen können?«
Such dir eine eilfertige Beamtin mit halbseitiger Gesichtslähmung, und du lernst zu schätzen, was du hast, dachte Mina. Inklusive der gemeingefährlichen Stiege, die sie im Anschluss an diesen Behördengang umso entschiedener in Angriff nahm.
Oben angekommen begegnete ihr gleich an der Eingangstür Dottor Rattazzi, dessen wässerige Augen sie mit liebevollem Blick umfingen. Der siebzigjährige pensionierte Gynäkologe war lange Jahre Ansprechpartner für Tausende von freiwillig und unfreiwillig schwanger gewordenen Frauen gewesen, bis seine Augen so schlecht und seine Hände so zittrig geworden waren, dass er nicht mehr praktizieren konnte.
Er war nicht nur warmherzig und voller Nächstenliebe, sondern auch mit einem großen Faible für weibliche Schönheit gesegnet, und der Anblick von Minas wogendem Busen bereitete ihm sichtlich Freude.
»Ah, da bist du ja«, begrüßte er die nach Luft ringende Sozialarbeiterin. »Ich wollte nur mal hören, wie es euch so geht. Aber ich musste feststellen, dass ich kaum mehr jemanden kenne. Wie die Zeit vergeht, was?«
Mina stützte sich mit der Hand am Türrahmen ab und lächelte ihm zu.
»Schön, dich zu sehen, Stefano. Aber darf ich dich daran erinnern, dass du uns erst am Freitag besucht hast, also vor gerade mal drei Tagen?«
Rattazzi blinzelte.
»Wirklich? Ich dachte, es wäre schon länger her. Wie die Zeit vergeht, was?«
Mina betrachtete ihn sorgenvoll.
»Geht es dir gut? Alles in Ordnung mit dir?«
Der Mann schaute verwirrt um sich, bis sein Blick an der kleinen Menschenansammlung vor der Tür zu seinem ehemaligen Sprechzimmer hängen blieb.
»Jaja, alles gut, ich habe nur noch nie so viele Leute vor der Praxis warten sehen. Zu meiner Zeit waren es zwei oder drei am Tag und das auch nur bei vermehrt auftretenden Infektionskrankheiten. Und jetzt schau dir das an! Wie die Zeit vergeht, was?«
Mina fragte sich, ob der Arzt mittlerweile irgendeiner neuen Glaubensrichtung anhing, die ihn gebetsmühlenartig diesen Satz wiederholen ließ.
»Was soll ich dazu sagen, Stefano? Kann schon sein, dass mal wieder irgendein Virus grassiert.«
Rattazzi schüttelte den Kopf.
»Ich weiß ja, liebe Mina, mit allem, was sexuell übertragbar ist, hast du nichts am Hut. Aber ohne mich in deine Angelegenheiten mischen zu wollen: Eine gesunde Aktivität auf dem Gebiet ist für Frauen deines Alters nur von Vorteil. Als du hier angefangen hast, da hattest du gerade erst geheiratet, oder? Was warst du strahlend, fröhlich, schön! Nicht so wie jetzt, wo du – verzeih mir meine Offenheit – immer ein bisschen … wie soll ich sagen … ein bisschen … Wie die Zeit vergeht, was?«
Kurz überlegte Mina, den Arzt zu fragen, ob er zufälligerweise mit ihrer Mutter gesprochen hatte, doch dann begnügte sie sich mit einem befreienden Atemzug.
»Stefano, wenn sonst nichts mehr ist, gehe ich jetzt in mein Büro, da wartet jemand auf mich, hat Trapanese gesagt.«
Der Arzt lächelte.
»Natürlich, geh du ruhig. Sogar Trapanese erscheint mir weniger abstoßend, seit ich nicht mehr hier arbeite. Früher hatte ich das Gefühl, die Hälfte meines Arbeitstags bestand daraus, irgendwelche Frauen davon abzuhalten, ihn wegen sexueller Belästigung anzuzeigen. Und jetzt fehlt sogar er mir – stell dir das mal vor! Wie die Zeit vergeht, was?«
»Ja, die Zeit … Apropos, ich habe es wirklich eilig, entschuldige, Stefano, ich muss rein. Und wenn ich dir einen Rat geben darf: Komm nicht mehr so oft her, das ist nicht gut für dich.«
Wieder blinzelte der Arzt.
»Meinst du? Na gut, ich versuch’s. Grüß mir bitte den Kollegen und sag ihm, dass er mich jederzeit anrufen kann. Ich habe ihm einen Zettel mit meiner Telefonnummer auf den Schreibtisch gelegt. Sie steht auch auf einem Post-it im Bad und hier im Flur. Und du hast sie ebenfalls, oder? Nicht, dass jemand aus dem Viertel nach mir fragt, und ihr erreicht mich nicht.«
Mina warf einen Blick auf die Warteschlange vor dem Sprechzimmer. Niemand hatte sich zu ihnen umgedreht.
»Ich glaube, er kriegt das ganz gut alleine hin. Aber ich sage es ihm natürlich trotzdem, keine Sorge.«
Sie wandte sich um und ging mit energischen Schritten in Richtung ihres Büros, als Rattazzis bebende Stimme sie innehalten ließ.
»Mina?«
»Was ist denn, Stefano?«
Der Mann schenkte ihr ein unsicheres Lächeln.
»Wie die Zeit vergeht, was?«
5
Minas Büro war das kleinste der drei Zimmer auf der Etage. Der Gynäkologe hatte das größte, da er Platz für den Untersuchungsstuhl und für eine abgetrennte Nische als Umkleidemöglichkeit brauchte. Das dritte, kaum benutzte Zimmer war der unnütze Beweis für die Wichtigkeit von Dottoressa Lucilla Monticelli Salvi, einer vermögenden Psychologin, die im letzten halben Jahr ganze drei Mal in ihrer Praxis aufgetaucht war, was sie sich als Ehefrau eines bekannten Chefarztes problemlos leisten konnte.
Zugegeben, als Psychologin hatte man es im Spanischen Viertel nicht leicht, waren doch die Bedürfnisse der Klientel sehr unterschiedlich und weit gefasst. »Dottoressa, bei allem Respekt«, hatte eine Patientin, die einen Pass von ihr ausgestellt haben wollte, obwohl sie nicht mal einen Personalausweis besaß, unverfroren zu Minas Bürogenossin gesagt, »aber wenn wir hier über unsere Probleme reden wollen, dann gehen wir zum Heiligen Gennaro.«
Der Zulauf war schon immer niedrig gewesen, wie Dottor Rattazzi erzählt hatte. In einem Viertel, in dem täglich ums Überleben gekämpft wurde und in dem nur wenige Gesetze und gar keine Verkehrsregeln galten, es sei denn, es wurden Pakete überbracht oder (besser noch) staatliche Beihilfen, war die Bezeichnung »professionelle Unterstützung« tatsächlich nicht auf Anhieb verständlich. Auch wenn die Beratungsstelle mit der Zeit eine gewisse Akzeptanz erlangt hatte und nachts nicht mehr regelmäßig um ihr halbwegs neuwertiges Mobiliar und sonstige Gebrauchsgegenstände erleichtert wurde, schwebte über der Etage mit der steilen Stiege nach wie vor eine dunkle Wolke des Misstrauens.





























