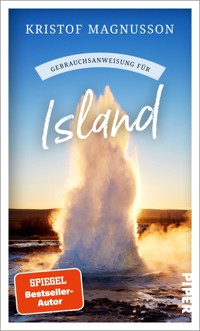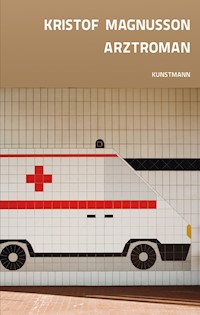7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf Weihnachten in Reykjavik hat sich Larus Ludvigson dieses Jahr richtig gefreut. Er hat ja nichts gegen Weihnachten. Das Problem ist, dass Weihnachten oft etwas gegen ihn hat. Es fängt damit an, dass Larus laut isländischem Melderegister tot ist und deswegen keine Videos ausleihen kann. Und endet damit, als Dagur sich in ihn verliebt und kurz darauf mit seinem Defender in eine Raststätte rast. Selbstmord? Larus hat damit nichts zu tun, kommt aber einem Geheimnis auf die Spur und verwickelt sich in eine Familiengeschichte, die ihn mit seiner isländischen Herkunft auf eine Weise konfrontiert, die er sich nie hätte träumen lassen. Mit großer Leichtigkeit, subtilem Humor und hinreißenden Dialogen erzählt Magnusson eine wilde Geschichte aus dem Großstadtleben am Polarkreis. Fast eine Familiensaga, spannend wie ein Krimi und nebenbei das Portrait einer Generation, die ihr "Zuhause" erst noch finden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
KRISTOF MAGNUSSON
ZUHAUSE
Roman
Verlag Antje Kunstmann
MeinenEltern
»Die Last unserer Erinnerungen macht uns träge.«Hans Erich Nossack
INHALT
TEIL EINS
Träume, Trabanten
Dunkler Nachmittag
Zwei Fische
Musterhafte Herzen
Die Ankunft, die Wahrheit, der Abend, die Nacht
TEIL ZWEI
Alberne Strapazen
Albernste Strapazen
Fuchs im Schnee
Zuhause I
Viele nasse Vögel
Dagur Defender
Pizza Hut
Zuhause II
Ein Licht, das nie verlöscht
TEIL DREI
Notaufnahme I
Vorbei
»Unfroh ist der Mann, / der den Leichnam trägt / des Verwandten / weg vom Haus.«
Zuhause III
Wir Menschen von Mýrar
Stein, Schere, Papier
Die tausendjährige Familie
Dreizehenmöwen
Jede Schnepfe lobt ihren Sumpf
Replantationen
Notaufnahme II
TEIL VIER
Für immer
Elísabet Lovísa
Das Leben der Elísabet Lovísa
Eine neue Dekade
Heute
Rache
»Fort denn nun eile, nach Osten gewandt«
Hamburg (Jesus liebt dich)
Danke
TEIL EINS
TRÄUME, TRABANTEN
Erst der schwarze Nordatlantik, dann schwarze Steinbrocken, eine schmale Rasenspur, dann die vierspurige schwarze Sæbraut, auf der der Berufsverkehr aus der Innenstadt von Reykjavík in die Trabantenstädte floss. Kaffee las ich vor dem Drive-in-Supermarkt am Rande der Schnellstraße auf Fahnen, die fast unbewegt in dem Orkan standen, der vom zugefrorenen Hochland über den Wal-Fjord in die Stadt fegte. Drinnen gab es ein paar Tische, an denen man auch essen konnte, was fast nie jemand tat. Ein einziger Taxifahrer saß da, vom Neonlicht ausgeleuchtet. Er kaute einen frittierten Teigring und sah an dem in den Flaschen erstarrten Ketchup und der aus dem Serviettenspender halb heraushängenden Serviette vorbei über die schwarze Schnellstraße, den Rasen, die schwarzen Steine hinaus in die Richtung, aus der der Sturm kam. Vor der Eingangstür klammerte sich ein zerzaustes Zierbäumchen an seinen Betonfuß. Es war der Freitag vor dem ersten Advent. Langsam begann ich mir einzugestehen, dass auch dieses Jahr, das bisher schönste in meinem Leben, zu Ende gehen würde.
Wir waren direkt vom Flughafen hierher gefahren. Wie schon so oft saßen wir in Matildas altem Saab auf dem Parkplatz vor dem Drive-in-Supermarkt und sahen zu, wie die Innenstadt kurz vor den Sieben-Uhr-Nachrichten ausblutete. Der Schneeregen hatte das Isolierband aufgeweicht, das ein Loch im Dach verkleben sollte, und die Kälte kroch ins Auto, verwischte die Grenze zwischen Atemluft und Zigarettenrauch. Die kurzatmige Heizung keuchte mit dem einen noch funktionierenden Lautsprecher um die Wette, aus dem Ian Curtis von Joy Division gelegentlich ein Wort stammelte, ›Dance‹ zum Beispiel oder ›Radio‹. Zwanzig Jahre war es her, dass er sich in seinem Wohnzimmer erhängt hatte. Damals waren Matilda und ich gerade Freunde geworden.
Matilda.
Matilda und ich sind zusammen zur Grundschule gegangen. Ich war der einzige Junge, der sich nicht für Fußball interessierte, und sie das einzige Mädchen, das nicht Mutter-Vater-Kind-und-Pferd spielen wollte. Deshalb spielten wir zusammen Taxifahrer und Fahrgast, Koch und Kellner, Popstar und Fan. Ich war der Taxifahrer, der Kellner, der Fan.
Heute war Matilda eine Art wandelnder Expo-Pavillon. Für das isländische Fremdenverkehrsamt zeigte sie Journalisten die Insel, wusste immer, wo der nächste Wasserfall war, und konnte von dem einen oder anderen Björk-Vorfall im Reykjavíker Nachtleben berichten. Alles, was die Menschen im Ausland über Island wussten, wussten sie von Matilda. Ein einfacher Beruf war das nicht.
Matilda sah aus wie immer. Ihr schwarz gefärbtes Haar berührte eben die Schultern, der vom schwefligen isländischen Wasser gelb gewordene Silberohrring war noch immer an seiner Stelle, und sie trug die graue Daunenjacke, die sie sich vor zehn Jahren gekauft und an die sie einen Fellkragen angenäht hatte, um das Gefühl zu bekommen, dass sie wirklich ihr gehöre. Wie eh und je füllte sie ihre Zigaretten von Benson & Hedges aus der goldenen in die schönere silberne Packung um. Und doch verwirrte mich etwas. Unter der vertrauten Oberfläche glaubte ich etwas Unbekanntes, beängstigend Neues zu spüren. Als habe sie, ohne äußerlich etwas an sich zu verändern, einfach beschlossen, anders auszusehen.
Wir hatten uns jeder einen Traum gekauft, mit Schokolade überzogene Lakritzstangen, die es im Angebot mit einem Hotdog und einem Kaffee für 399 isländische Kronen gab. Die durch den Sturm aufgepeitschte Gischt hatte sich mit dem Nebel zu einer trüben Wolke verwirbelt, die zwischen der Dunkelheit der Berge und den Lichtern der Stadt hängen blieb. Das Einzige, was noch deutlich erschien, war die sterile Neonwelt hinter den großen Fenstern des Drive-in-Supermarktes – Insel der Klarheit in einer unscharf gewordenen Welt. Unter dem Plakat Isländer essen SS-Würstchen fuhren Autos an die Verkaufsfenster heran, aus denen weiße Arme dreieckige Sandwichboxen und gedeckelte Kaffeebecher reichten, während die Motoren weiterliefen.
»Wann kommt Milan?«, fragte sie.
»Morgen.«
»Schön«, sagte sie. »Dann kann Weihnachten ja kommen.«
»Genau. Weihnachten kann kommen«, sagte ich und nahm einen Schluck Kaffee. Mit der Wärme breitete sich Vorfreude in mir aus. Wie jedes Jahr bemühte ich mich, den Dezember mit einer milden, fast gleichgültigen Gelassenheit auf mich zukommen zu lassen. Dieses Jahr war ich sogar mehr denn je davon überzeugt, dass es schön werden würde. Ich überlegte noch eine Weile, was wohl dieses Weihnachten schief gehen könnte, doch mir fiel nichts ein. Alles war in bester Ordnung. Warum auch nicht? Ich hatte nichts gegen Weihnachten. Das Problem war, dass Weihnachten oft etwas gegen mich hatte. Vielleicht freute ich mich deswegen so sehr darüber, dass wir ausgemacht hatten, gemeinsam zu feiern, Milan und ich, Matilda und Svend.
Svend.
Auf Svend war ich besonders stolz. Er war aus Schweden zu Besuch, als ich ihn damals in einem Café kennen lernte, sofort Matilda anrief und sagte: »Komm her. Ich sitze hier mit dem hübschesten, charmantesten und sympathischsten Informatiker der Welt.« Zehn Minuten später war Matilda da, zwei Tage später bewarb Svend sich um einen Job in Reykjavík. Er hatte für Matilda seine Dozentenstelle an der Universität in Göteborg aufgegeben. Das war vor zwei Jahren.
Der hehre, ganz und gar vollkommene Svend. Trotz seines Hangs zu Lachsfischerei und Geländewagen teilte er unsere Neigung zu dekorativer Melancholie an endlosen Nachmittagen.
Nicht nur bei Svend, auch bei Radjif und Tomas, Matildas früheren Freunden, hatte ich meine Finger im Spiel gehabt: Radjif war sehr lange her. Er war das Adoptivkind eines Kollegen meines Vaters und Torwart beim TSV Tornesch, in dessen Handballmannschaft ich mich meine D- und C-Jugendjahre hindurch bemüht hatte, das Tor zu treffen. Als Matilda mich einen Sommer in Tornesch bei Hamburg besuchte, hatte sie fast nur Augen für Radjif. Dennoch war ich es, der dafür sorgen musste, dass Radjif und Matilda sich schließlich alleine mit ein paar Decken und zwei Flaschen Saurer Apfel am Elbstrand wiederfanden, während ich in das Kino an der Kieler Straße ging.
Einige Jahre später dann Tomas. Er kam, wie auch Svend, aus Schweden und versuchte zwei Jahre lang, die schwedische Wodkamarke Polar auf dem isländischen Markt zu etablieren. Da er Wodkaproben im Reykjavíker Nachtleben ausschenkte, war es nur eine Frage der Zeit, bis er Matilda kennen lernen würde. Doch auch mit Tomas und Matilda wäre es ohne mich nicht weitergegangen: So leicht es Matilda fiel, Männer kennen zu lernen, so schwer fiel es ihr, sich zu verlieben. Obwohl sie gern flirtete, bestand jederzeit die Gefahr, dass sie plötzlich in eine Art grüblerische Leichenstarre verfiel. Sie konnte nichts dagegen tun, ihr fielen die Männer der ganzen anderen Frauen ein, die alle irgendwie Autos fuhren und Brillen hatten, zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig waren und sich am Wochenende betranken; die alle ihre Vorzüge hatten und ihre Fehler. Darüber dachte sie so lange nach, bis es ihr vollkommen egal erschien, mit wem sie sich einlassen sollte, und dann konnte sie es auch gleich lassen. Was Matilda fehlte, waren Kriterien.
Um so glücklicher war ich darüber, dass die dritte von mir vermittelte Liebe nun gehalten hatte. Svend hatte sogar sein Segelboot von Göteborg nach Reykjavík überführt. Seit ich Matilda kannte, träumte sie von einem Segelboot. Im vergangenen Sommer waren wir oft zu dritt auf die Faxa-Bucht hinausgesegelt.
Matilda riss die Verpackung des Traums auf und sagte:
»Ich habe mit Svend Schluss gemacht.«
»Was soll denn das?«
»Woher soll ich wissen, was das soll?«
»Als wir vor drei Wochen telefoniert haben, hast du noch gesagt, es sei schön.«
»Na und?«
»Ihr wolltet euch ein Landhaus kaufen, in Småland.«
»Ja. Mit Kamin. Pff.«
Ich sah sie an, sie sah hinaus, in die gleiche Richtung wie der Taxifahrer. Dann kurbelte Matilda das Fenster herunter, so weit die verbeulte Fahrertür es zuließ. Kaffeeschlürfende, Asche in den Sturm schnippende Verachtung. Mehr hatte sie nicht übrig für den hehren, vollkommenen, von mir handgecasteten Svend. Einen Moment lang überlegte ich, ob Matilda eine neurotische, glücksunfähige Diva sei, der man es nie recht machen könne. Doch dieser Gedanke tat mir weh, woraufhin ich mich noch mehr ärgerte, denn es war ihre Schuld, dass ich nun schlecht über sie dachte.
»Es war eben einfach nur schön. Genau wie er. Er war so schön und intelligent … «
»… und sympathisch«, sagte ich.
»Das auch noch! Und dauernd dieses Segeln.«
»Segeln ist doch … schön.«
»Pff!«
»Du hast dir immer jemanden gewünscht, der segeln kann.«
»Das ist es ja gerade. Er kann segeln, hat Stil und ist trotzdem kein Snob. Er hat Geld und ist trotzdem nett; aus guter Familie, aber kein Spießer; lieb und trotzdem cool; kann immer trinken, muss aber nicht. Er ist alles, was ich mir immer gewünscht habe. Alles gleichzeitig!«
Ich schwieg. Der arme hehre, ganz und gar vollkommene Svend.
»Und daneben dann ich!«, fuhr Matilda fort. »Wie ein beflecktes Detail, das man vergessen hat, aus der sauberen, schönen Prince-Denmark-Werbung rauszuschneiden.«
»Du hast mit ihm Schluss gemacht, weil du nicht in eine Prince-Denmark-Werbung passt?«
»Ich habe Schluss gemacht, weil er reinpasst.«
»Das kannst du doch nicht ernst meinen.« Ich wusste, dass sie das sehr ernst meinte.
»Svend ist noch nicht einmal Däne«, sagte ich dann.
»Schwede. Noch schlimmer. Bei denen ist alles immer so … perfekt.«
»Er war ja auch perfekt für dich.«
»Er war nicht perfekt für mich, er war einfach nur perfekt. Das ist ein Unterschied.«
»Sei nicht albern.«
»Was regst du dich eigentlich so auf? Ich kann doch Schluss machen, mit wem ich will.«
»Nicht mit Svend!«, sagte ich und ärgerte mich über den Nachdruck, den ich gerade diesem Satz verliehen hatte. Es hätte bessere Sätze dafür gegeben.
»Du hättest mir zumindest vorher Bescheid sagen können. Immerhin habe ich euch zusammengebracht.«
»Ach das ist es! Dir tut es überhaupt nicht leid, dass ich wieder allein bin. Du bist nur beleidigt, weil du ihn ausgesucht hast. Dabei hast du das nur gemacht, weil du es nicht aushalten konntest, dass ich allein war und du verliebt.«
»Und du hast dich natürlich nur aus Höflichkeit mir gegenüber in Svend verliebt.«
»Du musstest mich eben unter die Haube bringen.«
»Ich wollte dich noch nie unter die Haube bringen.«
»Und was war das damals mit diesem flaumbärtigen Handball-Inder, der dachte, die Smiths seien eine Baseballmannschaft aus Boston? Der nie die Trainingsjacke ausziehen wollte, auf der sein Name stand? Wie hieß er noch gleich?«
»Das weißt du ganz genau.«
»Nein, ich weiß es nicht mehr.« Sie wusste genau, dass Radjif Radjif hieß. Immerhin stand es auf seiner Trainingsjacke. Sie tat das nur, um mich zu ärgern.
»Das ärgert mich überhaupt nicht«, sagte ich.
»Natürlich. Ich laufe den ganzen Tag herum und denke, hmm, was könnte ich tun, um dich zu ärgern. Na klar! Unglück in mein Liebesleben bringen.« Matilda kurbelte die Fensterscheibe wieder hinauf, da die Sturmböen immer stärker wurden.
»Du gibst den Männern keine faire Chance. Denk nur an Tomas.«
»Fang nicht wieder von diesem schwedischen Alkoholiker an.«
»Tomas war kein Alkoholiker, sondern Wodkapromoter.«
»Er ist mir mit zwei Promille in die Seite gefahren, nachdem ich ihn abserviert habe.«
»Das ist eine unübersichtliche Situation gewesen.«
»Nachts um zwei im Kreisverkehr an der Hringbraut?«
»Außerdem tat es ihm leid.«
»Das Einzige, was ihm daran leid tat, war, dass ich ein schwedisches Auto hatte.«
»Aber Svend war anders.«
»Ja. So anders, dass es gar nicht auszuhalten war. Ich habe mich neben ihm nicht ausgehalten. Eine merkwürdige Frau mit einem merkwürdigen Job in einer merkwürdigen Daunenjacke aus einem merkwürdigen Land. Ich hatte das Gefühl, er wollte sein Leben durch mich ironisch brechen, weil sonst alles zu perfekt gewesen wäre.«
»Was ist daran schlimm, wenn etwas mal perfekt ist? Du wehrst dich so sehr dagegen, das ist ja … neurotisch.«
»Wenn du nicht so scheißglücklich wärst, könntest du gar nicht so reden.«
»So ein Quatsch.«
»Wenn du verliebt bist, muss ich auch jemanden haben. Als wären wir eine verdammte Elefantenherde, wo sich alle zur gleichen Zeit paaren müssen, damit der Nachwuchs nicht das ganze Jahr über die Herde aufhält.«
Matilda wusste, dass ich für Tiermetaphern sehr empfänglich war. Ich dachte an Elefanten, deren stoisches Vegetationszertrampeln und Bäumezerrupfen sich in eine jähe Paarungsorgie verwandelte, die nach ein paar Stunden ebenso schnell vorbei war, wie sie begonnen hatte. Matilda hatte Recht. Auch mir war aufgefallen, dass sich unsere Beziehungszyklen angeglichen hatten. Nur dass sich bei uns statt Nachwuchs meist Ernüchterung einstellte.
»Wenn dich dann wieder jemand sitzen lässt, bist du froh, dass ich auch wieder allein bin.«
»Mich lässt diesmal keiner sitzen!«, sagte ich, vielleicht etwas zu triumphierend.
»Dich lässt diesmal keiner sitzen. Herzlichen Glückwunsch! Freu dich doch. Und erklär mir, warum ich mich deswegen nicht trennen darf.«
»Wer sagt das?«
»Du. Eben gerade.«
Es überraschte mich, dass sie Recht hatte. Eigentlich hatte ich doch Recht. Ganz abgesehen davon ärgerte es mich, dass Matilda, obwohl sie Recht hatte, nicht einfach mal ihrem Glück eine Chance geben konnte. Aber so was kann man ja nicht sagen.
»Warum konntest du deinem Glück nicht einfach mal eine Chance geben?«
»Das darf ich ja wohl selber entscheiden!«
»Man weiß selber nie, was Glück ist.«
»Dann sag du es doch. Sag, was für mich Glück ist.«
»Schon gut, schon gut!«, sagte ich. Dann fragte ich endlich, was ich schon die ganze Zeit fragen wollte:
»Kann Svend trotzdem mit uns Weihnachten feiern?«
»Er ist sofort nach Göteborg zurück.«
»Aber sein Segelboot.«
»Pff.«
»Wir wollten doch zusammen Weihnachten feiern. Nur wir vier.« Das war die Idee. Nun war unsere ohnehin sehr überschaubare Familie der weihnachtlichen Wahlverwandschaften bereits am Freitag vor dem ersten Advent um eine Person geschrumpft.
»Entschuldige, dass ich nicht in deinen Weihnachtsplan passe. Ich bin halt nicht so perfekt.«
Ich beschloss, trotz des Orkans türenschlagend das Auto zu verlassen, wenn Matilda noch einmal das Wort perfekt in den Mund nehmen sollte. Warum hasste sie es so sehr? Das war ein Wort wie jedes andere, es konnte nichts dafür, dass es um die meisten Menschen so schlecht stand.
»Was findest du an perfekt bloß so schlimm?«
»Perfekte Menschen sind keine Menschen.«
»Das ist so kindisch.«
»Nein, das ist erwachsen.«
»Was ist denn an Trotz erwachsen?«
»Das ist kein Trotz, das ist Desillusionierung.«
»Ach, und das ist gut?«
»Das ist nicht gut. Aber erwachsen.«
»Außerdem war Svend gar nicht perfekt. Er liebt dich bestimmt immer noch.«
»Kann sein.«
»Dann hast du ja geschafft, was du wolltest. Du hast es nicht ausgehalten, dass es ihm so gut ging mit dir.« Du gehst zu weit, dachte ich mir. »Er hat seine Träume um dich herum gebaut, und du lässt ihn hierher ziehen, hierher segeln sogar! Dann spielst du ihm zwei Jahre lang ein Glück vor, das du überhaupt nicht in der Lage bist zu empfinden, und schickst ihn danach wieder weg, weil dir einfällt, dass du lieber desillusioniert sein willst, weil das so wunderbar erwachsen ist, und freust dich, dass du einen glücklichen Menschen traurig gemacht hast!«
»Und du buchst plötzlich deinen Flug um, kommst einen Tag eher, nur um mir das zu sagen?«
Matilda wusste genau, warum ich einen Tag vor Milan gekommen war. Um bei ihr zu sein. Ich freute mich auf ihre große Wohnung, in der alles so leer war und still, im achten Stock, mit Blick auf das Meer und das Laugar-Tal, den Sportplatz und das Schwimmbad mit der mächtigen Betontribüne. Ich beschloss, ihr nicht zu antworten.
»Kann ich einen Schluck?«, fragte sie nach einer Weile.
»Du hast selber.«
»Ich möchte aber einen Schluck von dir.« Ich gab ihr von meinem Kaffee und wollte gerade sagen, dass es mir leid tat, dass es mit Svend nicht geklappt hatte, da sagte sie:
»Tut mir leid, dass es mit Svend nicht geklappt hat.«
»Wollen wir uns heute Abend bei dir treffen?«, fragte ich.
»Nein, ich …«, Matilda wich meinem Blick schon wieder aus.
»Ich war so lange nicht mehr in deiner Wohnung«, sagte ich.
»Lieber bei dir.«
Ich wollte nicht mehr streiten. Selbst wegen Weihnachten war ich ihr nicht mehr böse. Wir konnten auch zu dritt feiern. Matilda, Milan und ich.
Milan.
Milan hatte noch in Hamburg zu tun. Das Universitätskrankenhaus Eppendorf richtete eine internationale Traumatagung aus, bei der er als Assistent des Pressesprechers der psychiatrischen Klinik dabei sein musste. Er war gerade mit dem Studium fertig geworden, und dies war sein erster Job. Danach würde er nach Island kommen. Matilda kannte Milan schon aus Deutschland und mochte ihn mindestens so sehr, wie ich Svend mochte. Sie liebte es, dass er genau wie sie niemals wendete, wenn er sich mit dem Auto verfuhr, wie er ›Abruzzen‹ sagte, wenn er nieste, und wie er sich freuen konnte über eine einzelne Textzeile in einem Lied; sie liebte das fast so sehr, wie ich es liebte, wenn er morgens so verloren in die Welt sah, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen.
Matilda hatte das Fenster zugedreht und machte die Musik lauter. So this is permanent, love’s shattered pride. What once was innocent, turned on it’s side. Aus den Schneeflocken auf ihrer Wange waren kleine Flecken geworden. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals einen Menschen so genau betrachtet zu haben. Das war nicht mehr die Matilda, die ich kannte, obwohl sie noch dieselbe graue Daunenjacke trug. Ich betrachtete sie so lange, bis ich erkannte, was anders geworden war. Ihr Blick erschien mir härter; wo sie früher verletzlich gewirkt hatte, wirkte sie nun verletzt. Zum ersten Mal fand ich, dass Matilda sehr nordisch aussah, und zum ersten Mal bedeutete dieses Wort für mich so etwas wie trist. Meine Matilda war auf dem Weg, eine einsame Gestalt aus einem Film von Aki Kaurismäki zu werden, ein vom vielen Kaffee blass gewordenes Orakel der Polarnacht. Sie musste hier weg.
»Was guckst du mich so an?«
»Nichts.«
Der Sturm jagte Schnee und Eisregen inzwischen fast waagerecht über den Parkplatz. Das Auto zitterte bei jeder Bö wie der Spinning Racer auf dem Hamburger Dom, der vibrierte, kurz bevor er anfing, sich rasend in Bewegung zu setzen. Matilda zog sich tiefer in ihre Daunenjacke zurück, deren Außenhaut bei jeder Bewegung leise knisterte.
»Willkommen zu Hause, Lárus.«
Lárus.
Das bin ich.
DUNKLER NACHMITTAG
Den dunklen Nachmittag verbrachte ich in einer Videothek, um einen Film auszuleihen, den ich am Abend mit Matilda angucken wollte. Ich stellte es mir schön vor, mit einem Film zu beginnen, um uns bewusst zu machen, dass wir einen ganzen Monat Zeit hatten, um miteinander zu reden. Ein etwa achtzehnjähriger Junge stand zwischen Kartoffelchipstüten und Schokoriegeln an der Kasse. Er griff die leere Hülle des Films, den ich ausgesucht hatte, und zielte mit dem Scanner darauf, bis es piepte.
»Deine Personenkennzahl?«
»171175-2599.«
Er tippte die Zahlen ein und zögerte.
»Noch mal, bitte.«
»171175-2599.«
»Wie heißt du?«
»Lárus.«
Er sah wieder auf den Monitor. Ich dachte mir nichts dabei, dachte nur daran, wie praktisch es sei, dass man hier ein Video ausleihen konnte, indem man nur seine Personenkennzahl sagen musste, die sich aus dem Geburtsdatum und einer vierstelligen Zahl zusammensetzte. Der Junge tippte mit der rechten Hand in seinen Rechner, sah auf den Bildschirm, der sich in seinen Brillengläsern unter der Schirmmütze spiegelte.
»Lárus Lúðvígsson?«, fragte er.
»Ja.«
»Du bist tot.«
»Was?«
»Du bist im Einwohnerverzeichnis als tot eingetragen.«
»Aber ich bin Lárus.«
»Ich kann einem Toten kein Video ausleihen.«
»Wann bin ich denn gestorben?«
»Das steht hier nicht.«
»Ist ja auch egal. Ich bin nämlich nicht tot.«
»Das glaube ich dir gerne. Du kannst das Video natürlich trotzdem haben, dann musst du dich nur registrieren lassen. Das kostet fünftausend Kronen Pfand.«
Ich verließ die Videothek, um eine Zigarette zu rauchen. Es war nicht so wichtig mit dem Film. Irgendwann in den nächsten Tagen würde ich zum Einwohnermeldeamt gehen und mich beschweren. Vorerst beschloss ich jedoch, nicht weiter darüber nachzudenken, zumal der staatliche Alkoholladen bald schließen würde.
ZWEI FISCHE
Das Foto, das vor mehr als zwanzig Jahren den Beginn unserer Freundschaft markierte, entstand auf der Walfangstation am Wal-Fjord. Matilda und ich waren mit meinem Onkel Ágúst in seinem durchgerosteten Opel Rekord hingefahren, bei dem ich einmal die Fußmatte anhob und direkt auf die Schotterstraße sehen konnte. Dem Wal hatten sie eine Kette um die Schwanzflosse gelegt und ihn auf die Rampe gezogen. Ich hatte mir das Armband meiner Kleinbildkamera um das eine Handgelenk geschlungen und hielt mir mit der anderen Hand die Jacke vor die Nase, gegen den tranigen Gestank aus dem Schornstein. Matilda hatte mit ihrer Kleinbildkamera ein Foto von mir gemacht, wie ich die Männer in Ölzeug fotografierte, die auf dem toten Wal herumliefen. Die Männer schnitten ihm mit Messern, deren Klingen größer waren als ihre gelben Gummistiefel, in Bahnen die fettgepolsterte Haut von den Knochen – rot und weiß wie Zahnpasta. Viele der Erwachsenen sagten damals im Scherz, dass wir wohl später einmal heiraten würden. Matilda und ich dachten das auch.
Am nächsten Tag hatte ich ein Foto von Matilda gemacht, wie sie im Streichelzoo von Reykjavík einen Nerz fotografierte. In den nächsten Jahren folgten viele weitere Bilder: Matilda auf Mallorca beim Minigolfspielen, ich auf Mallorca, wo mich ein rothaariger Isländer und ein dicker Finne im Pool hin und her warfen, Weihnachtsbilder, Ferienhaus-Trinkbilder, Heiße-Quelle-Trinkbilder, Reykjavík-Trinkbilder, Hamburg-Trinkbilder. Doch die Unbefangenheit der ersten beiden Fotos, dieser kindlich verwackelten Studien über das Verhältnis von Betrachter und betrachtetem Objekt, wurde nie wieder erreicht.
Die Bilder, die uns gemeinsam zeigten, waren am schlimmsten. Einer von uns hatte immer den Mund aufgerissen, die Augen zugekniffen oder sprach gerade ein Ü. Vielleicht lag es daran, dass wir uns irgendwie ähnlich sahen: irgendwie blond, irgendwie mittelgroß, irgendwie blauäugig. Das war mehr Irgendwie als ein einziges Bild verkraften konnte. Aus diesem Grund begannen wir mit zwölf oder dreizehn, alle Bilder, die uns gemeinsam zeigten, zu vernichten. Es war die Zeit, in der uns langsam klar wurde, dass das mit dem Heiraten wohl doch keine so gute Idee war.
Ein Jahr, nachdem Matilda das Foto von mir gemacht hatte, auf dem ich das Foto von den Männern auf dem toten Wal machte, gingen mein Vater, meine Schwester und ich nach Deutschland. Mein Vater zog einer Deutschen namens Elke hinterher, die er im Sommer im Goethe-Institut von Reykjavík kennen gelernt hatte und die Bibliothekarin in Hamburg war. Damals fehlten in Norddeutschland gerade Tierärzte, und man freute sich geradezu über ihn. So wurde Elke meine zweite Mutter und Tornesch bei Hamburg meine Heimat, in der ich mit neun mein erstes Gewitter erlebte sowie verwundert feststellte, dass es Sandkisten gab, in denen der Sand nicht schwarz war. In der Nähe von Tornesch bei Hamburg kam ich in eine Grundschule aus rotem Backsteinklinker, wo mir eine Praktikantin von der Pädagogischen Hochschule erzählte, dass es bald keine Wale mehr gäbe, wenn Island so weitermachte. Wenig später beobachtete ich diese Praktikantin vor der Eisdiele an der Hamburger Straße mit einer anderen Frau bei dem ersten Zungenkuss, den ich in meinem Leben sah, und kurz danach wurde der Walfang verboten.
Vor dem Fenster der Wohnung, die mein Vater gekauft hatte, damit wir jederzeit auf Island sein konnten, lagen die Walfangboote Hvalur 6, 7, 8 und 9, die seit dem Verbot den Hafen nicht mehr verlassen hatten. Ihre schwarzen Rümpfe waren in der Dunkelheit kaum vom Wasser zu unterscheiden, und an den Masten hingen Körbe für einen Ausguck wie bei Piratenschiffen. Nun rosteten sie schon seit fast fünfzehn Jahren auf ihren Liegeplätzen vor sich hin, während gegenüber ein Schiff mit Panoramafenstern für Walbeobachtungen an- und ablegte.
Vor den Walfängern stand der Trawler Tryggvi Jónsson im Trockendock und wurde blau gestrichen. Zwischen den Lagerschuppen und dem Betongebäude, in dem sich das Restaurant Zwei Fische befand, wirkte das Schiff deplaziert, wie von einer Flutwelle abgeworfen. Die Ampel dort, wo die Straße zur Mole auf die Hauptstraße traf, wurde grün, und ich wunderte mich einen Moment lang, warum der Trawler Tryggvi Jónsson nicht losfuhr. Während der letzten Zigarette waren drei Autos vorbeigefahren; es war zu spät für den Abend- und zu früh für den Nachtverkehr. Ich sah, wie ein Cabrio in den grauen Matsch am Straßenrand fuhr und noch einige Meter rutschte, bevor es zum Stehen kam. Matilda stieg so schwungvoll aus, als hätte sie noch den Impuls der beschwingten Autofahrt in sich, und stolperte direkt in meinen Hauseingang.
»Das ist wieder so eine Lárus-Idee!«, sagte Matilda kurze Zeit später, während sie an der Plastiklasche des Dreiliter-Weißweinzapfkartons aus dem staatlichen Alkoholladen herumzog, bis ein müdes Rinnsal ihr Glas füllte. Dann setzte sie sich in den Sessel, den ich eigens dafür gekauft hatte, damit sie darin sitzen konnte, links neben mir und meinem dunkelblauen Sofa.
»Wie meinst du das?«
»Na ja, absurd eben.«
»Was ist daran so absurd, dass ich für das Fernsehen arbeite?«, fragte ich.
Matilda leerte ihr Weinglas in einem Zug und warf mir einen Kuss zu.
»Die haben halt einen meiner Filme gekauft«, sagte ich.
»Du willst also Tierfilmer bleiben?«
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich kein Tierfilmer bin.« Ich hatte ihr das wirklich schon oft erklärt, aber sie wollte es immer wieder hören.
»Du filmst doch Tiere.«
»Ja. Vögel.«
»Dann bist du ein Tierfilmer.«
»Tierfilmer sind die, die sich wochenlang einen Busch auf den Kopf setzen und hoffen, irgendwelche Kolibris bei der Paarung zu erwischen. Ich filme Vögel in Städten. Urbane Vögel.«
Sie guckte, als hätte sie das lustigste Lied ihrer Lieblings-CD auf repeat gestellt.
»Und davon hat mir jetzt das norwegische Fernsehen einen abgekauft. Meditativen Realismus nennen die das.«
»Dokumental-Film«, sagte Matilda amüsiert, und ich musste lächeln. Sie konnte mir schon immer gut den Wind aus den Segeln nehmen. Das hatte sie von ihrem Vater. Der war beim Straßenbauamt von Reykjavík für die Geschwindigkeitsbegrenzungen zuständig, setzte Eisenrohre in den Asphalt und ließ Betonschwellen vor Kindergärten sowie Blindenheimen gießen. Er war auf einem Bauernhof am Ende einer langen holprigen Schotterpiste im Südland groß geworden, und problemlos befahrbare Straßen schienen ihm noch immer suspekt zu sein.
»So meine ich das gar nicht«, sagte sie dann – ich musste sie enttäuschter angesehen haben, als mir bewusst war.
»Was hast du eigentlich für ein Video ausgeliehen?«
»Ja, also, sie wollten mir keins ausleihen.«
»Warum nicht?«
»Weil ich im Einwohnerverzeichnis als tot eingetragen bin.«
»Was?«
»Ja. Tot.«
Matilda lachte.
»Ich bin tot, und du lachst.«
»Das ist halt irgendein blöder Computerfehler«, sagte sie. »Du nimmst das doch nicht ernst, oder?« Sie zuckte mit den Achseln.
»Nein«, sagte ich, »natürlich nicht.«
»Doch«, sagte sie. »Du nimmst das ernst.« Und lachte wieder.
»Warum sollte ich?«
»Dann ist ja gut. Übrigens, ich habe gekündigt.«
»Was?«
»Ich will keine Journalisten mehr durch Island führen. Ich möchte ein Restaurant aufmachen.«
»Du?«
»Ja.«
»Du in der Küche? Ich kenne Leute, die mehr Kinder bei sich zu Hause zur Welt gebracht haben, als du dir dort Mahlzeiten gekocht hast.«
»Es wird nur Suppen geben.«
»Suppen.«
»Schnell, einfach und gesund. Die Leute wollen das.«
»Und warum willst du das?«
»Weil es was ganz Einfaches ist.«
»Seit wann willst du es denn einfach?«
»Weißt du …« Sie stand auf und zapfte uns neuen Wein, als habe sie der Mut verlassen, weiterzureden. Ich sah zu, wie sie erst ihr, dann mein Glas so weit füllte, bis sie fast überliefen. Und schwieg. Nachdem sie, unsere Weingläser unter mehrmaligem Abtrinken balancierend, wieder in ihrem Sessel angekommen war, blieb ihr nichts anderes übrig, als das Gespräch dort wieder aufzunehmen, wo sie es hatte abbrechen lassen.
»… vielleicht habe ich mich nicht genug auf Svend eingelassen.« Es war einer von diesen stillen, triumphalen Momenten, in denen ich gern die Fähigkeit besessen hätte, nur die linke Augenbraue heben zu können.
»Vielleicht kann ich mich nicht auf andere Menschen einlassen.«
»Was sollen denn da die Suppen helfen?«
»Vielleicht einfach mal was anderes machen. Was Einfaches.« ›Einfach‹ und ›vielleicht‹ waren Worte, die normalerweise nicht zu Matildas Wortschatz gehörten. Alles war für sie immer klar. Und nichts einfach.
»Ich habe Angst davor, dass das eine Trennung wird, nach der alles so weiter geht wie bisher. Vielleicht sollte man nach jeder Trennung Dinge an sich verändern. Mehr darauf hören, was man wirklich will.«
»Aber Suppen?«
»Genauso wenig wie es in deinen Vögel-Filmen um die Vögel geht, geht es bei mir um die Suppen. Es geht um die Menschen. Ich möchte ein Restaurant. Mit richtigen Gästen. Für die ich kochen und zu denen ich nett sein kann.«
»Du kannst doch auch zu deinen Journalisten nett sein.«
»Da bin ich nur abstrakt nett. Schreibe E-Mails, telefoniere, fahre irgendwohin, erzähle immer dieselben Geysir-Geschichten und gebe mit der hohen Internetanschlussdichte unseres Volkes an. Ich trinke seit Jahren im Schnitt zweimal die Woche Schwarzer Tod in der Blauen Lagune, das kann doch so nicht weiter gehen! Immer, wenn ein Artikel erscheint, denke ich, das hätten die ohne mich genauso schreiben können. In meinem Restaurant wäre das anders. Die Leute kommen hungrig, und wenn sie gehen, haben sie eine Suppe gegessen. Eine von meinen Suppen. Die es ohne mich nicht gegeben hätte.«
Ich verstand sie überhaupt nicht, und genau dadurch fing ich an zu verstehen: Sie wollte wirklich alles anders machen. Matilda schwieg und sagte dann fast hektisch:
»Ich glaube, man verliert die Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzulassen, wenn man so lange alleine wohnt.«
Nun war ich es, der sein Weinglas in einem Zug leerte. In Matildas Stimme lag etwas Hoffnungsloses, das ich von ihr nicht kannte, und dass sie in diesem Ton ausgerechnet vom Alleinewohnen sprach, erschreckte mich. Als wir uns als Jugendliche unser erwachsenes Leben vorstellten, hatten wir uns ausgemalt, wie schön es sein würde, endlich unsere eigenen Wohnungen zu haben, jeder für sich. Sobald wie möglich machten wir diesen Traum wahr, Matilda im achten Stock am Laugar-Tal und ich in Hamburg in einem seine Renovierung erwartenden Vorkriegsklinkerbau auf der Veddel, einer Insel, die weder zum Nord- noch zum Südufer der Elbe gehört. Die erhebende und gleichzeitig verunsichernde Freiheit genossen wir wie einen Rausch, der auch nach den Jahren und den mit ihnen verbundenen Geschichten weiter wirkte. Doch etwas in ihrer Stimme ließ mich an eine Abmachung denken, die wir vor vielen Jahren trafen und die ich inzwischen fast vergessen hatte: Bevor wir beginnen würden, uns selbst Botschaften auf den beschlagenen Badezimmerspiegel zu schreiben und uns nachmittags beim Bäcker über den Klang der eigenen Stimme zu wundern, würden wir zusammenziehen. Sie und auch ich konnten jederzeit den anderen darum bitten, wenn wir es allein nicht mehr aushielten. Ich hatte nie daran gedacht, dieses Versprechen einzulösen, und es mit vielen anderen Gin-Launen in einer schwer zugänglichen Region meines Gedächtnisses abgelegt. Nun hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sie daran dachte. Ich sah mich in meiner Wohnung um. Das einzige wirkliche Möbelstück war das blaue Sofa, auf dem ich saß. Von ihm aus betrachtete ich den Deckenfluter an der gegenüber liegenden Wand, den Glastisch mit meinem Obststillleben und Matilda in ihrem Sessel. Plötzlich stand dieses dumme Versprechen, wenn schon nicht zwischen uns, so doch zumindest hier im Raum, mitten in meinem Wohnzimmer.
MUSTERHAFTE HERZEN
Als der Zapfkarton leer war, gingen wir aus. Wir ließen uns, den Nordwestorkan im Rücken, runter in die Stadt treiben und taten das, was alle taten: Wir gingen auf den Laugavegur, die oft verregnete, immer zu enge und irgendwie auch zu lange Hauptstraße Islands.
Es war kurz nach eins. Eine Autoschlange schob sich langsam stadteinwärts, in Richtung Nacht, in Richtung Leben. Wir gingen an einem von Techno-Bässen geschüttelten Geländewagen vorbei, in dem ein einzelner Mann saß. Er hatte das Fenster heruntergekurbelt und ließ eine Hand heraushängen, in der er eine Dose Cola hielt. Dahinter war ein glänzender Golf, dessen Heckklappe offen stand. Aus seinem Inneren drangen die Beats der Reykjavíker Hip-Hop-Helden XXX Rottweiler Hundar. Unbeeindruckt davon, dass die Heckklappe im Sturm zitterte, saßen zwei Jungs im Kofferraum und redeten gleichzeitig auf ein Mädchen ein, das zwischen ihnen saß. Sie tranken Bier aus Dosen, ihre Beine berührten fast die Straße. Das Mädchen sprang heraus, rannte auf ein anderes Mädchen zu, das gerade im 22 verschwinden wollte, und rief den Jungs zu: «Das ist meine Cousine. Meine Cousine Hulda.«
Weil viele Autofahrer Fußgänger trafen, die sie zumindest hupend begrüßen mussten, wenn sie nicht sogar anhielten, um sich grölend über das Ziel der bevorstehenden Nachtvergnügung zu verständigen, kam der Verkehr vollkommen zum Erliegen.
Auf den Parallelstraßen wäre man viel schneller vorangekommen, und doch fuhren alle den Laugavegur hinab. Alle halfen mit, wenigstens freitags und sonnabends einen Verkehrsstau zu erzeugen, wie er sich in Reykjavík sonst selbst im dichtesten Berufsverkehr nicht einstellen wollte. An den Wochenenden zwischen ein und sechs Uhr wirkte die Stadt so großstädtisch wie nie. Alle stürzten sich in das Nachtleben, diese kollektive Auflehnung gegen den Winter, die Dunkelheit, Langeweile, Pizzabringdienste, Chat-Rooms und Pay-TV.
Wir ließen eine Ginflasche kreisen, wobei – ein richtiger Kreis war es nicht. Eher eine Gerade, auf der die Flasche hin- und herpendelte, zwischen Matilda und mir. Dabei freute ich mich nicht nur auf die Nacht, sondern auch auf den nächsten Morgen. Es kam immer so, dass wir, wenn wir überall gewesen waren, bei Matilda weitertranken, bis der Erste von uns auf einer ihrer Fensterbänke einschlief, die leer waren und breit wie Betten. Nirgendwo schlief ich so gut wie dort, Reykjavík mit seinen erleuchteten Hügeln und der schwarzen Bucht unter mir. Und das Aufwachen in der übersäuerten Einsamkeit des nächsten Tages war niemals schrecklich, weil wir weder allein aufwachten noch in dem Bett eines unbekannten, im aufkommenden Tageslicht hässlicher werdenden Menschen.
Wir waren auf dem Weg ins kaffi gógó. Dort waren wir das erste Mal vor vierzehn Jahren gewesen, als wir gerade angefangen hatten, in uns mehr zu sehen als den Jungen und das Mädchen mit den Kleinbildkameras. Wir hatten unsere Freundschaft aus den Kinder- und Lebertranpillentagen herübergerettet in ein Erwachsenengefühl, das seit einiger Zeit wie ein dem Schlamm Nibelheims entstiegenes Monster in uns herumtorkelte. Wir hatten uns vorgenommen, zum ersten Mal in der Innenstadt betrunken zu werden. Wir wollten endlich Kontakt aufnehmen mit dem erwachsenen Leben, das aus Freundschaften zu Barkeepern, Türstehern und Tresenmädchen zu bestehen schien. Wir wollten dazugehören, zu den hart gesottenen Twens, geheimnisvollen Fischerburschen und trägerlosen Björk-Nachahmerinnen, die an der Bar im kaffi gógó ihre Nierenknuffe setzten und im Obergeschoss auf den Sofas knutschten. Matilda hatte ihre Mutter gebeten, zum Schwarzen Schwan am Busbahnhof Hlemmur zu gehen und französische Zigaretten in roten Schachteln zu kaufen. Zusätzlich hatte ich aus Hamburg zwei Zigarettenpackungen mitgebracht, von deren Steuermarken wir eine Eins und eine Zwei ausschnitten und über die Fünf der 1975 auf unseren Ausweisen klebten. So kamen wir an dem Türsteher vorbei. Drinnen verlangte ich mit einem Nuscheln, das zumindest damals für mich der kettenrauchenden Nonchalance eines Godard-Schauspielers ebenbürtig war, einen Aschenbecher und kaufte Bier. Der erwartete Kampf an der Bar blieb dabei aus, denn bis auf uns war noch keiner da. Wir setzten uns im Obergeschoss auf die Fensterbank unter dem Straßenschild aus Amsterdam und schauten lange in den regennassen Hinterhof mit den Lüftungsschächten. Als sich das gógó langsam füllte, entpuppte sich die Fensterbank als Logenplatz, um zuzusehen, wie um uns herum alles aus dem Ruder lief. Eine Frau in hohen Stiefeln schlug ihrem Freund weinend ins Gesicht. Ich unterhielt mich mit einer betrunkenen Krankenschwesterschülerin, die sich mühsam an der Handtasche unter ihrem Arm festhielt und mich zweimal grinsend fragte: »Deine Freundin ist nicht deine Freundin, oder?« Als die Krankenschwesterschülerin mich küssen wollte, ging Matilda aufs Klo, und als ich die Krankenschwesterschülerin nicht küssen wollte, sagte diese: »Denk dran, ich werde Krankenschwester. Irgendwann wird dein Leben einmal in meiner Hand sein.«
Am Anfang dieses ersten Abends im Reykjavíker Nachtleben war ich fest entschlossen, mich im kaffi gógó zu bewegen wie ein The Clash hörender Nordengländer mit einer Narbe in der Augenbraue und einer Rule Britania-Tätowierung auf dem mächtigen Bizeps. Als ich jedoch zum dritten Mal die Treppe hinabging, um für Matilda und mich ein viertes Bier zu holen, wurden meine Beine plötzlich leicht. Mir war Barbra Streisand eingefallen, und während ich langsam, Schritt für Schritt, die Treppe hinunterstieg, sang ich leise vor mich hin: There’s no business like show business.
Wie jeder Stammgast hatte ich eine Theorie, warum das kaffi gógó nie aus der Mode kam: Es war der einzige Club mit einer Dramaturgie. Im gógó musste man keine Fragen stellen und keine Entscheidungen treffen: Das gógó könnte mindestens bis sechs Uhr offen bleiben wie die meisten anderen Clubs, machte aber um vier Uhr fünfzehn dicht. Punkt vier Uhr fünfzehn. Weil das alle wussten, achteten sie darauf, um zwei in bester Stimmung zu sein und sich um halb vier vor der Bar in erbitterte Kämpfe um ein letztes Getränk zu verwickeln. Wenn dann genau um vier, mitten im Lied, die Musik abbrach und das Licht anging, konnte man sich noch eine Viertelstunde an die Reste der Nacht klammern. In den anderen Läden, die bis sechs offen hatten, zerfaserte die Nacht. Dort waren einige bereits um Mitternacht betrunken, während die anderen blöd guckten, und wenn die, die um Mitternacht noch blöd geguckt hatten, um drei betrunken waren, waren die anderen, bereits um Mitternacht Betrunkenen, schon gar nicht mehr wach.
Immer schneller ging ich mit Matilda den Laugavegur hinunter. Dies war die Zeit, zu der sich vor dem kaffi gógó oft eine Schlange bildete, und ich wollte auf keinen Fall warten. Matilda bemerkte den Rauch zuerst. Ich hatte ihn für eine verirrte Wolke gehalten, bis ich den beißenden Geruch wahrnahm und das Flackern des Blaulichts sah. Als wir an die Polizeiabsperrung herangingen, sahen wir, dass eines der alten Häuser auf dem Laugavegur in Flammen stand.
Matilda sagte:
»Da wohnt doch Dagur.«
»Wer?«
»Na, Daggi!«
Aus den Dachfenstern des mit Wellblech gedeckten Hauses, deren Scheiben schon gesprungen waren, quollen im Wechsel schwarze und graue Schwaden hervor. Durch die Stellen, an denen die Wellblechbahnen auf dem Dach zusammengenagelt waren, kroch ebenfalls Rauch, in ordentlichen Linien. Vor dem Haus war ein Gewirr aus gelbem Absperrband, Schläuchen und Drehleitern entstanden. Wie ein Vorhang aus Gaze legte sich feine Löschwassergischt um die Feuerwehrautos. Wir tauchten unter der Absperrung hindurch und gingen auf einen roten Bus zu, in dessen Fenster ein Schild hing, auf dem »Feuerwehr Reykjavík « stand und dass hier die geretteten Bewohner betreut würden. Der Bus war leer.
Ein Polizist in einem schwarzen Schneeanzug, der mit den Reflektorstreifen an Armen und Beinen aussah wie ein übergroßes Schulkind, scheuchte uns hinter die Absperrung zurück.
»Hat sich jemand verletzt?«, fragte Matilda den Polizisten. Er hielt eine Tasse in der Hand, aus der Dampf aufstieg.
»Wir wissen noch nichts Genaues.«
»Ein Freund von mir wohnt da drin. Sind denn alle raus?«
»Das können wir noch nicht sagen.«
Wir stellten uns auf den Parkplatz, der dem brennenden Haus direkt gegenüberlag. Ein gelber, fast quaderförmiger Wasserwerfer der Flughafenfeuerwehr rangierte sich in Position, um die Brandschutzwand zu dem Haus mit dem Schuhgeschäft zu bespritzen. Alle Feuerwehren aus Südwestisland schienen ausgerückt zu sein. Die ankommenden Feuerwehrmänner entluden hastig ihre silbern glänzenden Atemschutzgeräte. Sie trugen Gummistiefel, die aussahen wie Köpfe von riesigen Gelbwangenschildkröten. Es war kalt und merkwürdigerweise auch still. Nur das Rattern der Dieselmotoren war zu hören; gelegentlich heulte ein Elektromotor auf und eine Drehleiter schob sich in die Höhe. Da erschien der dichte schwarze Rauch, der auf der Rückseite des Hauses aufstieg, plötzlich in einem roten Feuerschein. Wenig später flackerte es in den Fenstern des obersten Stockwerks auf. Das Feuer schien an dem Wasser vorbei zu brennen, die Flammen standen unbeeindruckt wie Ausstellungsstücke in den Fenstern, auf die die Feuerwehrmänner auf den Leitern mit Hochdruck zielten. Auch als der ganze Dachstuhl innerhalb von Minuten in Flammen stand, blieb das Feuer absolut still.
Das inzwischen knöchelhoch auf dem Laugavegur stehende Löschwasser trug Hotdog-Tütchen, Colabecher und Zigarettenkippen davon. Eine Gruppe junger Männer in Jeans und beigebraunen Wolljacken stand neben uns auf dem Parkplatz herum, auch sie tranken Bier. Einer trat gegen einen der prallen Schläuche und sagte: »Wow.« Ich sah mich um. Hinter mir standen inzwischen mindestens hundert Schaulustige: hauptsächlich Ausgänger, aber auch einige der Pfandflaschen sammelnden Rentner und Asiaten, die sich sonst durch nichts von ihrer Mülleimerrunde abhalten ließen. Neben uns stand ein grauhaariger Mann in einem Fleecepullover, der starr in das Feuer blickte. Wenn ich ein Brandstifter wäre, dachte ich, hätte ich mich auch genau hierhin gestellt, denn aus dieser Perspektive sah man alles: die Flammen, die Feuerwehrmänner und die Polizisten, die von einem Leuchtstreifenbein auf das andere sprangen, um sich zu wärmen. Matilda sprach laut in ihr Telefon:
»Daggi, endlich! Dein Haus brennt, Mann. Ich weiß auch nicht. Okay, bye!«
»Was hat er gesagt?«, fragte ich.
»Was soll er schon gesagt haben«, sagte Matilda. »Scheiße, hat er gesagt. Zum Teufel. Und fokk.«
Dagur.
Ich erinnerte mich nur dunkel an Dagur. Wahrscheinlich hätte ich ihn wie die meisten meiner Grundschulkameraden vollkommen vergessen, wäre er nicht der Sohn von Kjartan Benediktsson, Kjartan dem Reichen, gewesen. Kjartans Familie gehörte die Mýrar hf, die das isländische Wirtschaftsleben dominierte und aufgrund ihres weit verzweigten Firmennetzwerks von vielen ›der Krake‹ genannt wurde. Die Mýrar hf war der größte Lebensmittelproduzent des Landes, der größte Importeur von Autos, Benzin und Elektrogeräten, ein bedeutender Exporteur von Fisch, besaß Baufirmen, Reisebüros, mehrere Verlage und einen Fernsehsender. Schon in der Grundschule wusste jeder von Dagurs besonderer Herkunft, und er litt sehr darunter: Im Unterschied zu seiner jüngeren Schwester, die den Ruhm ihrer Familie täglich mit Herrinnenschritt zur Schule trug, schlich sich Dagur, meist ein paar Minuten zu spät, mit hängendem Kopf ins Klassenzimmer. Er erweckte immerfort den Eindruck, dass er sich für die Stellung seiner Familie schämte, was dazu führte, dass die gesamte Schülerschaft auf ihm herumhackte, während niemand gegen seine Schwester auch nur ein Wort sagte.
Seit unserer Grundschulzeit hatte ich Dagur nicht mehr gesehen. Trotzdem erkannte ich ihn sofort, als ich ihn nun zu seinem brennenden Haus rennen sah. Dagur war nicht besonders groß geworden; seine langen Haare waren zu blonden Dreadlocks verfilzt, die wild auf- und absprangen. Er hielt mit beiden Händen seine weite Jeans fest und trug einen Pullover mit der Aufschrift Vöfluvagninn. Das erklärte, warum er so schnell hier war, denn der Waffelwagen, an dem tagsüber Kinder und nachts betrunkene Kinder Waffeln mit Eis kauften, stand keine zwei Minuten entfernt auf dem Lækjatorg. Matilda wollte ihm etwas zurufen, doch er würdigte uns keines Blickes, zerriss wie ein Langstreckenläufer beim Zieleinlauf das gelbe Absperrband, schubste einen Feuerwehrmann aus dem Weg und griff sich ein Atemschutzgerät. Ein Polizist kam angerannt, doch da war Dagur schon in dem Haus verschwunden.
Kurze Zeit später erschien er in einem Fenster im ersten Stock. Ein dicker Aktenordner flog heraus und verfehlte nur knapp den Kopf eines Feuerwehrmanns. Bald standen die Einsatzkräfte in einem Regen von Videokassetten und Kleidungsstücken. Sogar CDs warf Dagur aus dem Fenster, deren Hüllen beim Aufprall aufplatzten und ihren glänzenden Inhalt freigaben. Es war ein kurzer, heftiger Regen, dann war Dagur, ebenso plötzlich wie er in dem Fenster aufgetaucht war, wieder verschwunden. Unter den Schaulustigen um uns herum waren die Gespräche verstummt.
Dagur tauchte in demselben Fenster wieder auf. Er hatte eine Kiste auf das Fensterbrett gestellt, die nur wenig kleiner war als ein Mineralwasserkasten. Sie schwankte hin und her, Dagur sah unschlüssig herunter. Die Feuerwehrleute riefen etwas zu ihm hinauf, das ich nicht verstand. Da rannte ich an dem Polizisten vorbei, der einen Moment zu spät reagierte, um mich festhalten zu können, rannte bis unter das Fenster und streckte die Arme aus. Dagur ließ die Kiste los, die in der Luft eine halbe Drehung vollführte, bevor ich sie auffing. Ich knickte in den Knien ein und verlor fast das Gleichgewicht. Eine Sekunde lang dachte ich, ich hätte mir die Arme gebrochen, so stark war der Schmerz. Als ich wieder hinaufsah, war Dagur fort. Der Feuerwehrmann auf der Drehleiter über mir spritzte in ein Fenster, dann in ein anderes. Ein Polizist packte mich an einem der schmerzenden Arme. Ich sah ihn an, als er mich plötzlich losließ und herumfuhr. Die Menge der Schaulustigen klatschte, johlte, pfiff – Dagur stand vor dem Haus! Er schmiss die Atemschutzmontur von sich wie ein Rockstar seine Gitarre und begann, seine Sachen zusammenzusuchen. Die Menge jubelte weiter, der Polizist schrie etwas von Einsatzbehinderung und Nötigung, doch Dagur hörte nicht zu. Schon nicht mehr ganz so laut rief der Polizist, dass er ihn eigentlich verhaften müsse, doch da hatte Dagur seine CDs, Kleidungsstücke, Aktenordner und Videokassetten bereits aufgehoben und zog sich hinter die Absperrung zurück. Ich folgte ihm.
»Ja, ja«, sagte er.
»Wichtige Sachen, was?«, fragte ich. Dagur nickte und hustete. Ich stellte die Kiste vor ihm ab und wollte sie öffnen, da schob Dagur mich so unsanft zu Seite, dass ich ihn erstaunt ansah.
»Kennst du Lárus noch?«, fragte Matilda.
»Nein.«
»Er war mit uns in der Grundschule und ist dann nach Deutschland.«
»So was«, sagte er und sah mich an. »Lalli.« Er wischte seine rußverschmierten Hände an der Jeans ab.
»Lárus«, sagte ich.
»Lalli. Lalli skaggi!«
»Lárus!«, sagte ich erneut.
»Lalli skaggi«, wiederholte Dagur, und Matilda konnte das Grinsen, das ich ihr streng verboten hatte, nicht unterdrücken. Ich hatte gehofft, dass alle die ›Lalli skaggi‹-Episode meines Lebens vergessen hatten, ja, ich hatte sogar selber versucht, die ›Lalli skaggi‹-Episode meines Lebens zu vergessen. Fast hatte ich schon gedacht, es wäre mir gelungen, aber ich erinnerte mich natürlich ganz genau.
Es war so, dass ich, nachdem ich eingeschult wurde, vorgab, gehbehindert zu sein. Morgens hüpfte ich noch gleichmäßigen Schritts die Betontreppe am Eingang unseres Hauses herunter, doch sobald das Fenster zur Küche außer Sicht war, in der meine Mutter stundenlang Sachen hin- und herräumte und in der es trotzdem immer unordentlich war, fing ich an zu humpeln. Irgendwie schien das zur Schule zu passen. Mich verwirrten die vielen anderen Kinder. Einige ärgerten mich, riefen ›Lalli skaggi‹, ›Lalli, der Schiefe‹, was wiederum Jónína, die Lehrerin, ärgerte, die mich in Schutz nahm, was wiederum Valdimar ›Valli‹ Hermansson und Böddi Jónsson dazu verführte, mich nach der Schule noch mehr zu ärgern. Bald kloppte ich mich fast regelmäßig mit den beiden. Ich hatte nie eine Chance, konnte aber auch nicht weglaufen, weil ich ja humpelte. Ich kam nicht auf die Idee, von meiner vorgespielten Behinderung zu lassen, denn da ich die anderen Kinder nicht mochte, erschien es mir nur logisch, dass sie mich ärgerten und ich mich mit ihnen schlug. Einige andere bemitleideten mich – das war auch gut. Hauptsache, jeder wusste, wer ich war.