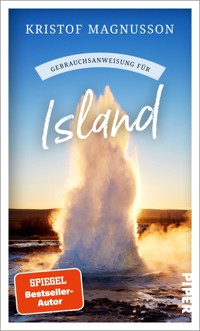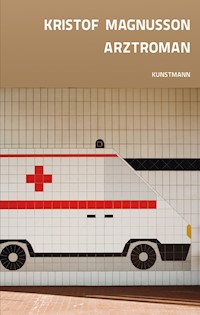Kristof Magnusson über Pet Shop Boys, queere Vorbilder und musikalischen Mainstream E-Book
Kristof Magnusson
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: KiWi Musikbibliothek
- Sprache: Deutsch
Go West! Ein autobiografischer Blick auf eine Band, die mühelos und widerspruchsfrei ganz unterschiedliche Gruppen von Fans miteinander vereint: von Intellektuellen, die sie als ambitionierte Konzeptkünstler bewundern, über Familien bis hin zur schwulen Partyszene. Kristof Magnusson nahm zum ersten Mal Popmusik im späten Grundschulalter wahr – und da waren die Pet Shop Boys für ihn der Inbegriff der Popmusik schlechthin. Später prägten sie seine musikalische Sozialisation in den Teenagerjahren und begleiteten seine Anfänge als Autor während der Studienzeit. Die Rolle der Pet Shop Boys als queere Identifikationsfiguren hat sich zwar im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert, doch immer wieder war Magnusson beeindruckt davon, wie es der Band gelang, eingängige Charthits zu produzieren und dabei gleichzeitig clever und subversiv zu bleiben. So schließt sich ein Kreis, wenn Magnusson seinen Helden unvermittelt in der Berliner Eckkneipe »Oase« begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kristof Magnusson
PET SHOP BOYS
Kristof Magnusson über Pet Shop Boys, queere Vorbilder und musikalischen Mainstream
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Kristof Magnusson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Kristof Magnusson
Kristof Magnusson, 1976 in Hamburg als Sohn deutsch-isländischer Eltern geboren, Ausbildung zum Kirchenmusiker, Zivildienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. in New York City in der Sozialarbeit mit Holocaustüberlebenden und Obdachlosen. Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der Universität Reykjavík. Schreibt Bücher und Theaterstücke wie zum Beispiel die Komödie »Männerhort« und den Roman »Das war ich nicht«. Übersetzt aus dem Isländischen. Engagiert sich für Literatur in Einfacher Sprache, unterrichtet gelegentlich an Unis und kuratiert Literaturveranstaltungen. Zuletzt erschien von ihm der Roman »Ein Mann der Kunst« im Verlag Antje Kunstmann (2020).
www.kristofmagnusson.de
www.instagram.com/kristofmagnusson/
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein autobiografischer Blick auf eine Band, die mühelos und widerspruchsfrei ganz unterschiedliche Gruppen von Fans miteinander vereint: von Intellektuellen, die sie als ambitionierte Konzeptkünstler bewundern, über Familien bis hin zur schwulen Partyszene.
Kristof Magnusson nahm zum ersten Mal Popmusik im späten Grundschulalter wahr – und da waren die Pet Shop Boys für ihn der Inbegriff der Popmusik schlechthin. Später prägten sie seine musikalische Sozialisation in den Teenagerjahren und begleiteten seine Anfänge als Autor während der Studienzeit. Die Rolle der Pet Shop Boys als queere Identifikationsfiguren hat sich zwar im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert, doch immer wieder war Magnusson beeindruckt davon, wie es der Band gelang, eingängige Charthits zu produzieren und dabei gleichzeitig clever und subversiv zu bleiben. So schließt sich ein Kreis, wenn Magnusson seinen Helden unvermittelt in der Berliner Eckkneipe »Oase« begegnet.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: FAVORITBÜRO, München
ISBN978-3-462-30327-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
We’ve got no future …
Hamburg
New York, Leipzig, Reykjavík
Berlin
Meinen Freund Martin Hossbach …
Noch mehr Lesespaß
»We’ve got no future, we’ve got no past – Here today, built to last – In every city, in every nation – From Lake Geneva to the Finland station«
Es ist Ende Juni des Jahres 2009. Die Pandemonium-Tour der Pet Shop Boys macht Station im ausverkauften Tempodrom in Berlin. Wir sind mit einer kleinen Gruppe von Freunden und Bekannten hier. Ich, mein Lebensgefährte Gunnar, mein alter Schulfreund Martin, seine Frau Felicitas und noch ein paar andere.
Die Veranstaltung hat mehr Volksfestcharakter, als es den wahren Ästheten unter den Pet-Shop-Boys-Fans lieb sein kann: Auf der unbestuhlten Fläche in der Mitte der zeltartigen Konzerthalle wuseln Tausende Menschen umher, suchen nach geeigneten Plätzen, den Toiletten, bahnen sich mit Bier und Brezeln den Weg zu ihren Leuten.
Die bestuhlten Ränge weiter hinten sind bevölkert mit älteren Ehepaaren, oftmals in Begleitung ihrer Kinder. Die Männer tragen karierte Hemden, die sie in helle Bundfaltenhosen gesteckt haben, und gelgepolsterte Joggingschuhe. Bei den Frauen manifestiert sich eine gewisse Achtzigerjahre-Nostalgie in den Frisuren, manche von ihnen tragen Stirnbänder und übergroße Ohrringe, die so aussehen, als wären sie nach langer Zeit genau für diesen Anlass wieder einmal herausgekramt worden.
Für viele dieser Menschen ist das Pet-Shop-Boys-Konzert ein Familienausflug und gleichzeitig ein trip down memory lane. Letzteres gilt auch für uns. Auch wir wünschen uns einen emotionalen Flashback, hoffen darauf, dass sie heute Abend genau die Lieder spielen werden, die wir in den Achtzigerjahren mit dem Kassettenrekorder aus dem Radio aufgenommen haben.
Doch längst nicht alle sind hier, um sich nostalgischen Gefühlen hinzugeben. Um uns herum, am hinteren Rand der unbestuhlten Mitte, stehen einige Leute, die ich zumindest vom Sehen her kenne: Autorenkollegen, Journalistinnen verschiedener Berliner Medien, fast die ganze Redaktion der damals noch existierenden Musikzeitschrift Spex, eine Bekannte von mir, die an der Humboldt-Uni über Marcel Proust forscht; Leute, die ich schon mal auf Theaterpremieren und Ausstellungseröffnungen gesehen habe. Wenn ich ihre Gespräche belausche, schnappe ich immer wieder Wörter wie »konzeptuell«, »minimalistisch« und »performativ« auf. Wir stehen eindeutig in der Kulturbetrieb-Ecke. Auch dieses Milieu zieht es zu einem Konzert der Pet Shop Boys: Intellektuelle, die die Pet Shop Boys immer auch als künstlerisch ambitionierte Konzeptband wahrgenommen haben. Wäre ich damals zu den älteren Ehepaaren auf den bestuhlten Rängen gegangen und hätte sie gefragt, ob sie auch so begeistert davon seien, dass die Pet Shop Boys nicht nur eine Band, sondern ein Gesamtkunstwerk sind, hätte es wahrscheinlich viele ratlose Blicke gegeben.
Weiter vorne, in Richtung der Bühne, sieht es wieder ganz anders aus. Hier könnte man meinen, man wäre im Berghain oder zumindest in der Panorama-Bar gelandet: Leicht bekleidete junge bärtige Männer mit vielen Tattoos, vielen Piercings und sehr kurzen Haaren. Bei dieser Kohorte von Konzertgängern handelt es sich eindeutig um Partyschwule, für die die Pet Shop Boys weder Konzeptkunst noch Nostalgie-Trigger sind. Für diese Generation der internationalen Homo-Hipster sind die Pet Shop Boys schlicht Säulenheilige der schwulen Subkultur und haben diesen Status auch Jahrzehnte nach ihrer ersten Platte nicht eingebüßt. Die Beständigkeit der Band verleiht der eigenen queeren Identität beinahe so etwas wie eine historische Legitimation.
Dann erlischt das Licht im Saal. Die Bühne erstrahlt in leuchtendem Blau, Rot und Grün. Disconebel wabert von links und rechts in Richtung Bühnenmitte, wo ein Pult mit Synthesizern aufgebaut ist sowie ein einsames Standmikrofon. Neil Tennant und Chris Lowe tauchen aus dem Disconebel auf, nähern sich langsamen Schrittes dem vorderen Bühnenrand. Ohne Begrüßung und ohne ankündigende Worte erklingt ein elektronischer Beat – die Show beginnt. Alle klatschen. Sind gemeinsam dabei. Mir fällt kein anderes Phänomen der Musikwelt ein, das so unterschiedliche Gruppen von Fans so mühelos und widerspruchsfrei miteinander vereint wie die Pet Shop Boys.
Hamburg
»Everything I’ve ever done«
Die Geschichte beginnt – wie soll es anders sein – in den 1980er-Jahren. Der Ort ist Hamburg. Der Stadtteil heißt Schnelsen. Von hier sind es nur ein paar Hundert Meter zur Stadtgrenze in Richtung Schleswig-Holstein; 1989 wird hier die erste Hamburger Filiale von IKEA eröffnen, doch so weit sind wir noch nicht.
Bisher war die größte Attraktion dieses nordwestlichsten Zipfels der Freien und Hansestadt ein Sportklub am Königskinderweg, in dem ich mich oft mit Freunden zum Squash-Spielen traf, eine Sportart, die für mich so sehr mit den westdeutschen Achtzigerjahren verbunden ist wie das Schulterpolster und die Dauerwelle. Es gab damals in Hamburg-Schnelsen keinen stylisheren Ort als dieses, wie man damals sagte, Squashcenter. Überall war Neon, Messing, es gab farbenfrohe Cocktails – auf Wunsch sogar ohne Alkohol! Im ganzen Stadtteil war dies definitiv der Ort, an dem man sich am meisten Mühe gegeben hatte, den Zeitgeist der 80er-Jahre zu treffen. Ich kann zwar nicht mehr genau rekonstruieren, warum, aber ich erinnere mich noch genau daran, dass ich oft lange Zeit im Eingangsbereich der Sportanlage saß und auf meine Freunde wartete.
Anders als im Hause meiner Eltern, wo das Fernsehprogramm auf öffentlich-rechtliche Sender begrenzt war, lief auf dem Fernseher, der hier an die Wand gedübelt war, Kabelfernsehen. Die große Vielfalt von Kanälen, die man dadurch bekam, schien hier allerdings niemanden zu interessieren. Hier – und auch auf den anderen vielen Fernsehern, die in diesem Squashcenter in fast jedem Raum, sogar im Ruheraum der Sauna, zu finden waren – lief immer nur ein Sender, und zwar MTV. MTV hielt ich damals für so etwas wie den Yeti oder das Ungeheuer von Loch Ness. Es wurde gemunkelt, dass es so etwas gäbe, aber niemand hatte es jemals zu Gesicht bekommen. Ich kannte nur die öffentlich-rechtliche Musiksendung Formel Eins, mit Peter Illmann, Ingolf Lück und Stefanie Tücking. Dass MTV hier tatsächlich existierte, hatte etwas von einer Initiation. In einem Squashcenter eröffnete sich mir etwas völlig Unbekanntes, vollkommen Neues. Wenigstens hier stimmte einmal dieser dämliche Spruch: Hamburg – das Tor zur Welt.
In meiner Erinnerung liefen damals, egal, ob wir am Königskinderweg gerade squashten, uns umzogen oder Eis aßen, immer und überall die Pet Shop Boys. Deren Lieder West End Girls und Suburbia konnte ich mitsingen, bevor ich die englischen Texte verstand. Und wenn ich damals das Wort Pop hörte, hatte ich sofort die Synthesizer-Akkorde im Ohr, mit denen das Elvis-Cover Always On My Mind beginnt: Pop – das waren für mich die Pet Shop Boys. Die Lieder kannte ich schon, bevor ich anfing, mit meinen Freunden in den Squashklub zu gehen – ein Musikvideo hingegen sah ich dort zum ersten Mal. Und auch hier erinnere ich mich nur an die Videos der Pet Shop Boys, die Videos zu It’s a Sin und Always On My Mind. Das Video zu Always On My Mind habe ich noch als völlig harmlos wahrgenommen, ohne daran zu denken, dass es da irgendwie um queere Inhalte oder Filmkunst gehen könnte. Die vielen lustigen, scheinbar unzusammenhängenden Filmausschnitte passten noch in das Spaß-Bild, das ich von den Pet Shop Boys hatte, in die kindliche Begeisterung für einprägsame Melodien und Klangfarben, die ich allein schon deswegen faszinierend fand, weil sie nicht so klangen wie das Geklampfe von Simon & Garfunkel auf dem elterlichen Plattenteller. Dass die Filmausschnitte, aus denen das Video zu Always On My Mind besteht, aus dem Kinofilm It Couldn’t Happen Here stammen, bei dem es sich um amtliche surrealistische Filmkunst handelt, habe ich erst viel später herausgefunden.
Dann sah ich das Video von It’s a Sin, und nichts war mehr wie zuvor. Das Video spielt in einer mittelalterlich anmutenden Szenerie. Neil Tennant und Chris Lowe sind in einer Burg gefangen und müssen vor erbarmungslosen Priestern und Mönchen der Spanischen Inquisition auf die Knie fallen. Ein Scheiterhaufen wird entzündet, die Botschaft des Videos ist eindeutig. Und wer es bis dahin noch nicht geschnallt hatte, konnte es sich über den Songtext erschließen: »For everything I long to do – No matter when or where or who – Has one thing in common too – It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin. Everything I’ve ever done – Everything I ever do – Every place I’ve ever been – Everywhere I’m going to – It’s a sin.«
Aus der Perspektive eines Erwachsenen von heute ist die Angelegenheit so klar wie Kloßbrühe: Ein schwuler junger Mann verzweifelt daran, dass seine Sexualität und Lebensweise von der Umwelt verurteilt werden. Im Lied selbst richtet sich das Gesungene an einen »father«, wobei nicht ganz klar wird, ob damit der leibliche Vater des Protagonisten gemeint ist oder ob es sich um die Anrede eines Geistlichen handelt. Im Video hingehen macht Regisseur Derek Jarman aus dieser Doppeldeutigkeit ein ziemlich eindeutiges Statement. Die christliche Ikonografie ist derart übertrieben, dass sie den ganzen Song umdeutet. Beim Video geht es nicht nur um das persönliche Einzelschicksal eines schwulen Mannes in den 1980er-Jahren in Großbritannien, es geht um das gesamte verkorkste Verhältnis der katholischen Kirche zu Sexualität im Allgemeinen und Homosexualität im Speziellen. Das wusste ich damals noch nicht, dennoch wurde mir irgendwie klar, dass hier ganz existenzielle Fragen verhandelt werden.
Ohne dass in dem Video explizit schwule Darstellungen enthalten sind, kam die Botschaft bei mir an. Dass das Ganze auf eine theatralische und auch irgendwie lustige Weise rüberkam, machte die Pet Shop Boys für mich rätselhafter, obwohl ich gleichzeitig intuitiv das Gefühl hatte, etwas verstanden zu haben. Ich hatte damals nur ein sehr unbestimmtes Gefühl davon, dass die Welt um mich herum für andere Leute vorformatiert war. Jegliche Kultur um mich herum war darauf angelegt, im weitesten Sinne eine Boy-meets-Girl-Geschichte zu reproduzieren. Für diejenigen, die nicht dazugehörten, gab es scheinbar keinen Platz. Als junger Teenager hätte ich niemals die komplexe Machtstruktur einer heteronormativen Gesellschaft wahrnehmen können, fühlte aber bereits sehr genau, was in mir Angst und Unbehagen hervorrief – und wo ich mich sicher fühlte. Von daher war alleine die Abwesenheit eindeutig heterosexuell codierter Bilder und Geschichten in den Videos und Songs der Pet Shop Boys für mich eine Wohltat.
Wie sehr mir die Texte der Pet Shop Boys gefielen, merkte ich besonders im Vergleich zu – deutlich dämlicheren – Lyrics anderer Bands. Als ich etwas später zum ersten Mal Who’s Gonna Ride Your Wild Horses von U2 auf MTV sah, fragte ich mich umgehend, wessen Pferde da überhaupt gemeint seien, was dieser Bono eigentlich mit Pferden am Hut habe und noch viel mehr: was dieser ganze Kram mit mir zu tun haben solle. Bei den Texten der Pet Shop Boys stellte ich mir diese Fragen nie. Schon damals, im Squashcenter, verschafften mir diese Texte ein regelrechtes literarisches Erweckungserlebnis. Als dort einmal Rent lief, fragte ich mich sofort: Was genau meint Neil Tennant, wenn er singt: »I love you, you pay my rent«? Handelt es sich dabei um den jüngeren Liebhaber eines älteren Mannes oder um den Rentboy eines reichen Kunden? Ist es einfach nur ein sehr fortschrittliches Geschlechterverhältnis einer Heterobeziehung oder singt Tennant aus der Erzählperspektive einer Frau? Als ich diese Entdeckung machte, kam ich mir selbst ungeheuer subversiv vor und verspürte sofort eine große Nähe zu dem Songtexter – immerhin musste er den Text ja so geschrieben haben, dass solche Leute wie ich ihn entziffern können. Für mich war das ein erster Schritt auf dem Weg zu einem besonderen, bewussten Umgang mit Text – und daher sicher ein Wegbereiter für meine spätere Berufswahl.
Meine erste Gedichtinterpretation machte ich also nicht im Deutschunterricht, sondern vor dem Fernseher des Squashcenters am Königskinderweg in Hamburg-Schnelsen. Und weil es in Hamburg war und weil sich diese Geschichte in den späten 1980er-Jahren sowie den frühen 1990er-Jahren ereignete, möchte ich an dieser Stelle der Vollständigkeit halber auf einen Umstand hinweisen: Ja, das Squashcenter im Königskinderweg in Hamburg-Schnelsen hatte eine Sauna. Und ja, manchmal, wenn ich in diese Sauna ging, dann saß da Dieter Bohlen drin.
Bevor wir aber die 1980er-Jahre hinter uns lassen und uns genauer den 1990ern zuwenden, möchte ich noch auf einen Song der Pet Shop Boys hinweisen, den ich damals liebte und der mich auch noch heute in Erinnerungen schwelgen lässt. Mir kommt es so vor, als würde Heart nicht genug gewürdigt werden. Vielleicht liegt es daran, dass der Titel so wenig aussagekräftig ist. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass das Lied Heart heißt. Ich dachte immer, es hieße womöglich My Heart Starts Missing a Beat, Missing a Beat oder Every Time. In dem kurzen Refrain steckt so viel verdichteter Sound – in Gesang und Backing-Track –, dass es nur weniger Takte bedarf, um das Lebensgefühl eines ganzen Jahrzehnts aufscheinen zu lassen. »My heart starts missing a beat, My heart starts missing a beat. Every time, Ohhh-oh, oh, every time.« Die betonte Wiederholung von »beat« ist natürlich kein Zufall, denn musikalisch geht es da richtig zur Sache. Heart hat einen ballernden Hi-NRG-Sound, wie etwa You Spin Me Round oder You Make Me Feel, und sollte eigentlich auch in einem Atemzug mit diesen Hi-NRG-Schmankerln genannt werden. Hätten die Pet Shop Boys an dieser Stelle ihre Karriere beendet, würde man sich heute sicher an sie als große Helden der Hi-NRG-Welle erinnern. Aber stattdessen ging es danach ja erst richtig los.
Im Musikvideo zu Heart