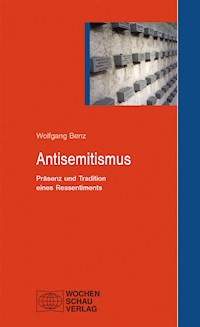16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bleibt 80, 100 Jahre nach dem Ende des Holocaust? Was 1945 begann, wird nicht mit dem Tod der Zeitzeugen enden: die Erinnerungskultur. Aber der Ort des Holocaust in der Geschichte wird sich zunehmend verändern, von Generation zu Generation und je mehr Zuwanderer ins Land kommen. Eine Verpflichtung für die deutsche Politik wird gleichwohl bleiben. Wolfgang Benz schildert das Entstehen der deutschen Erinnerungskultur. Er setzt sich mit Ritualisierung und Bürokratisierung des Gedenkens auseinander und warnt vor selbstgefälliger Zufriedenheit. Er weist der jungen Generation einen Weg, die Last des Nationalsozialismus zu tragen, ohne sich erdrücken zu lassen. Denn klar ist: Das Verbrechen war gigantisch und singulär. Aber nicht jede politische Verpflichtung ist damit zu begründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Als Beobachter und Akteur der Szene des Erinnerns und Gedenkens, habe ich die Amnesie der Nachkriegszeit, die Schlussstrich-Mentalität der 1960er Jahre, die Betroffenheit durch den TV-Vierteiler ›Holocaust‹, die Aufwallungen des Historikerstreits und der Wehrmachtsausstellung, wechselnde Neurosen im kollektiven Gedächtnisbetrieb erfahren und mich dazu positioniert. Was bewirken die – notwendigen – Gedenktage mit ihrem jeweiligen politischen Ritual am 27. Januar, am 9. November, am Volkstrauertag, zum 8. Mai, zum 20. Juli? Die Stilblüten der Political Correctness sind Zeichen des Übereifers, ebenso das Beschwören postkolonialen Furors bei jeder Gelegenheit.
Denn darum geht es: Aufklärung über das böse Erbe, das nicht ausgeschlagen werden kann. Einsicht zu vermitteln in die Verbrechen des Nationalsozialismus, um deren Wiederholung zu verhindern.
Das ›Nie wieder‹ des politischen Appells muss begleitet sein von der Einsicht in Ursachen und Folgen menschenfeindlicher Ideologie. Mit welchen Methoden der Didaktik, der KI oder der Erzählung auch immer künftigen Generationen das notwendige Wissen vermittelt wird, ist sekundär. Aber nichts befreit vom Erbe, das nur durch Wissen darüber erträglich ist.« Wolfgang Benz
Wolfgang Benz
Zukunft der Erinnerung
Das deutsche Erbe und die kommende Generation
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Streit um das Erinnern
Woran erinnern?
Koloniale Vergangenheit
Neuer Historikerstreit?
Die DDR erinnern
Erforschen, erinnern, gedenken
2. Niederlage oder Befreiung? Das Ende des »Dritten Reiches« im Gedächtnis der Deutschen
3. Widerstand als Legitimation der beiden deutschen Nachkriegsstaaten
4. Verweigerte Emotion: Judenfeindschaft nach dem Holocaust
5. Amnesie
6. »Stolz, deutsch zu sein«: Aufbegehren gegen die Geschichte
7. Philosemitismus: Staatsräson, Herzenssache, Pflicht?
8. Blinder Eifer: Erinnerungsverbote aus Solidarität mit Israel
9. Ungeliebte, vergessene, verleugnete Opfer
Die Tragödie der Cap Arcona
Deserteure – Das Unrecht nationalsozialistischer Militärjustiz
Homosexuelle
Als »Zigeuner« verfolgt, als Sinti und Roma missachtet
Ein Denkmal für Jehovas Zeugen?
Verweigerte Erinnerung an Opfer der »Euthanasie« und Zwangssterilisation
Gemeinschaftsfremde und Kriminelle
10. Erinnerungsorte: Das singuläre Verbrechen in der Nachbarschaft
11. Zeitzeugen: Balanceakt zwischen Empathie und Wissenschaft
12. Denkmalsetzungen: Ankerplätze im kulturellen Gedächtnis der Nation
13. Wege in die Zukunft
Literaturverzeichnis
Vorwort
Der israelische Philosoph Avishai Margalit unterscheidet geteilte Erinnerung von gemeinsamer Erinnerung. Das gemeinsame Erinnern gilt einem Ereignis, an dem Individuen teilgenommen haben, die sich als Gruppe daran erinnern. Die geteilte Erinnerung stiftet Gemeinschaft, ist deren Erbe, umgreift Generationen und begründet eine gemeinsame Ethik. Aleida Assmann spricht vom kulturellen Gedächtnis, die Erinnerungsgemeinschaft pflegt es in der Erinnerungskultur mit den rationalen Methoden der Geschichtswissenschaft und den emotionalen Möglichkeiten gesellschaftlicher Selbstvergewisserung durch Denkmale und Rituale, mit Sprachregelungen und Stolpersteinen, durch Zeitzeugen, in Gedenkstätten, durch die Bewahrung von Überresten in Museen und an authentischen Orten.
Dieses Buch will keinen Beitrag zur Theorie über das öffentliche Gedächtnis leisten. Es ist auch weder Handreichung zur Gedenkarbeit noch Plädoyer für die Erweiterung des Erinnerungsraums. Thema ist der Umgang mit der Erblast aus der Zeit nationalsozialistischer Herrschaft, den Verbrechen unter menschenfeindlicher Ideologie, die die deutsche Gesellschaft nach der Katastrophe verstummen ließ. Die Mithandelnden und Mitlebenden schwiegen lange, die einen aus Trotz und Furcht vor Strafe, die anderen erklärten sich als Mehrheit unbeteiligt, weil sie nicht gemordet, nur gejubelt oder sich auch nur geduckt hatten, als Widerstand noch möglich gewesen wäre.
Der Amnesie, die mit der Metapher »Unfähigkeit zu trauern« psychoanalytisch zutreffend diagnostiziert war, folgte das Aufbegehren einer Generation von Studierenden 1968 und, ein Jahrzehnt später, das Erweckungserlebnis durch die Fernsehserie Holocaust. In den 1980er-Jahren begann das, was als »Erinnerungskultur« vielen den Grund zum Stolz des mündigen Bürgers auf den Umgang mit verstörender Vergangenheit bietet. Andere, wie die intellektuell und moralisch anspruchslose Gefolgschaft einer rechtsradikalen Partei, wollen die Demokratie zerstören und zerren dazu aus der Klamottenkiste die abgelegten Phrasen von »Blut und Boden«, von »Volk und Nation«, vom »Stolz, deutsch zu sein«.
Rechtsextreme Gruppierungen, Alt- und Neonazis hat es seit dem Zusammenbruch des Hitlerregimes immer gegeben (nicht nur in der BRD, wo sie sich organisieren durften, auch in der DDR, wo die Obrigkeit deren Existenz verleugnete), aber sie blieben Sekten, waren Minderheiten und Außenseiter. Die rechtsextremen Parteien und Bünde, geführt von Demagogen, die den Nationalsozialismus verharmlosen und dessen Verbrechen leugnen, entstanden, verschwanden, gründeten sich neu. Sie waren unappetitlich, aber belanglos. Die Partei, die sich »Alternative für Deutschland« nennt, öffentlich völkisch-nationalistischen Fremdenhass predigt, insgeheim zur Destruktion der Demokratie im Staat und in der Gesellschaft verabredet ist und so schamlos Geschichtsklitterung betreibt, dass man ihr Idol Höcke einen Faschisten nennen darf, ist erfolgreich, auch wegen der Denunziation des Erinnerns an die Verbrechen des »Dritten Reiches«. Die Akzeptanz der AfD, die sich in Wählerstimmen ausdrückt, zeigt, welcher Bedarf an Aufklärung besteht.
Das »Dritte Reich« ist nicht das einzige Thema im kollektiven Gedächtnis der deutschen Nation. Die Diktatur der SED spielt für die davon Betroffenen sogar die größte Rolle. Das Feld der Erinnerung an die DDR ist gut bestellt, allerdings herrscht oft lautstark-fröhlicher Dilettantismus, der an Erinnerungsorten und in Sammlungen auf den Unterhaltungswert der Alltagskultur oder den Schrecken des Gewaltregimes setzt, nicht auf Erkenntnis und Einsicht in das Wesen des Staates und seiner Gesellschaft. Die DDR ist im erinnerungspolitischen Schaugeschäft zu sehr als Objekt der Nostalgie und zugleich als schaurige Attraktion des Fremdenverkehrs präsent. Sammler zeigen ihre Schätze an vielen Orten von Usedom im Norden bis Pforzheim am Rand des Schwarzwalds weit außerhalb des einstigen Territoriums der DDR. In den Dokumentationen, Museen, Informations- und Erlebniszentren dominieren bestimmte Aspekte. Faszinosa sind die Verkehrsmittel, mit denen man sich in der DDR bewegte, dann Gebrauchsgegenstände, die in beängstigenden Quantitäten in Räumlichkeiten mit dem Eingangsschild »Museum« dargeboten werden, beliebt sind Inszenierungen der Wohnkultur des DDR-Bürgers. Thematisiert wird andernorts die Erfahrung des Eingeschlossenseins und der deutschen Teilung in vielen Grenzmuseen und der Gedenkstätte zur Berliner Mauer. Zentral ist die Erinnerung an die Überwachung und den staatlichen Terror durch das Ministerium für Staatssicherheit. Zu oft folgen ohne weitere Reflexion die Präsentationen zur Geschichte des untergegangenen Staates der Totalitarismustheorie, die der DDR durch die Gleichsetzung mit der Hitlerdiktatur von allem Anfang an die Legitimation bestreitet. Möglicherweise ist es noch zu früh für eine Geschichte der DDR, die als vorurteilsfreie, nicht durch Erfahrung oder Ideologie belastete Gesamtdarstellung Akzeptanz beanspruchen kann. Der Interessierte wird deshalb mit der Fraktionierung in isolierte Themenfelder – Alltag, Verkehr, Militär, Staatssicherheit, Grenzregime – wohl noch länger leben müssen.
Zu den Versäumnissen der Wende gehört, dass es kein DDR-Museum in öffentlicher Obhut gibt. Das Deutsche Historische Museum in Berlin ist der zuständige Ort, aber die 40 Jahre DDR-Geschichte haben im Gesamtkonzept des Hauses naturgemäß nur marginale Bedeutung. Ein Museum fehlt, das die Lebenswelt der DDR mit allen Facetten zeigt, das nicht nur als Touristenattraktion Besuchern aus dem Westen deren Klischees bestätigt, das die ehemaligen Bürger des Staates nicht denunziert. Es wäre die notwendige Ergänzung zu den Gedenkstätten im Stasi-Gefängnis, im DDR-Zuchthaus oder im Jugendwerkhof, die an das Unrecht erinnern.
Im Unterschied zum Vorgängerregime der Bundesrepublik und der DDR, das als gemeinsames Erbe zu erinnern ist, war die Deutsche Demokratische Republik nur ein kleines Kapitel der deutschen Geschichte, zwar von längerer Dauer als das »Dritte Reich«, aber angesichts der unvorstellbaren Verbrechen des Hitlerstaats nicht mit diesem gleichzusetzen. Das Erbe der DDR lastet auch nicht in gleicher Weise auf allen deutschen Bürgern, weder so zeitlich unbegrenzt wie der Judenmord noch so von Scham besetzt wegen des Jubels um den »Führer«, der alle ins Verderben führte. In diesem Buch ist deshalb das gemeinsame Erinnern an die nationalsozialistische Vergangenheit das dominierende Thema.
Zu Recht wird gefordert – spät genug –, die koloniale Vergangenheit in die nationale Erinnerung einzubeziehen. Die Zeit, in der das deutsche Kaiserreich Kolonialmacht war, endete im Ersten Weltkrieg. Sie hat Spuren hinterlassen in Afrika und in der Südsee, die an Demütigung, Ausbeutung, Missachtung erinnern. Die einstigen Kolonialherren und ihre Nachkommen haben das lange Zeit vergessen. Auch wenn dieser Aspekt einer ruhmlosen Vergangenheit allmählich ins öffentliche Bewusstsein einkehrt, ist er nicht gleichbedeutend mit den Exzessen nationalsozialistischer Herrschaft. Er muss nicht zwingend als Vorstufe kolonialen Anspruchs und kolonialer Herrschaft unter NS-Ideologie verstanden werden und auch nicht als Etüde zum Völkermord der Schoah. Die Erinnerung an das »Dritte Reich« ist nicht symmetrisch mit der Vergangenheit der DDR und der kolonialen Geschichte. Das Erinnern an den Hitlerstaat gehört zum Wesenskern der Demokratie.
Dieses Buch ist aus der Erfahrung des Historikers geschrieben, dessen Karriere als studentische Hilfskraft im Archiv des Münchner Instituts für Zeitgeschichte mit der Auswertung der Akten des NS-Regimes über den Judenmord begann. Ich habe die Strafprozesse wegen der NS-Gewaltverbrechen verfolgt und als junger Wissenschaftler Täter und Opfer interviewt, mich schließlich der Erforschung des Antisemitismus gewidmet.
Zur akademischen Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus kam das Engagement auf den Foren der Erinnerung: Die deutschen KZ-Gedenkstätten wurden in Ost und West um das Jahr 1965 eingerichtet. Mehr oder weniger kärglich ausgestattet in der Bundesrepublik, politisch instrumentalisiert in der DDR, blieben sie weitgehend den ehemaligen Insassen überlassen, die ehrenamtlich Besucher führten, Hinterlassenschaft archivierten, Gegenstände retteten, Erinnerung bewahrten. Politiker aller Ebenen sahen missgelaunt die Besucherströme aus dem Ausland nach Dachau pilgern.
In Neuengamme, dem Hamburger KZ, wurde nach Jahrzehnten des Provisoriums eine Kommission berufen, die sich Gedanken machen sollte über die künftige Gestalt des KZ-Geländes, das mit zwei Justizvollzugsanstalten überbaut war. Ich gehörte der Kommission an und lauschte bei der konstituierenden Sitzung einem konservativen Politiker, der uns beschwor, diesen Ort vor »Gedenkstättengeschäftigkeit« zu bewahren, denn er sei ein »Hain der Toten«. Auf meine unschuldige Frage, was man dann mit den (damals noch) zahlreichen Überlebenden machen solle – die Ära der Zeitzeugen hatte noch nicht begonnen –, schwieg er verärgert.
Mit Barbara Distel, der langjährigen Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, gründete ich, nach dem Vorbild der Hefte von Auschwitz, die Zeitschrift Dachauer Hefte, die 25 Jahre lang, beginnend 1985, mit großem Erfolg, beträchtlicher Auflage und internationaler Resonanz, wissenschaftliche Studien zur NS-Verfolgungsgeschichte zusammen mit Texten von Zeugen öffentlich machte. Das Entstehen der Erinnerungskultur habe ich in den Beiräten der KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg, Sachsenhausen und Ravensbrück verfolgt, die Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz durfte ich ein wenig mitgestalten, und dem Beirat der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas gehöre ich als Sprecher von Anbeginn an. Auch mit anderen Gedenkorten bin ich seit Jahrzehnten verbunden. Angeführt ist dies, um anzudeuten, dass meine Kritik an Fehlentwicklungen und Defiziten der Erinnerungskultur den Hintergrund von Engagement und Erfahrung hat.
Denn das spät begonnene Zeitalter öffentlichen Erinnerns an die NS-Zeit hat mit der Professionalisierung des Gedenkens auch zur Ritualisierung und dank der staatlichen Fürsorge, die lange vermisst wurde, zur Bürokratisierung geführt. Historismus durch plagiierende Rekonstruktion untergegangener Bauwerke vereint großbürgerliche Honoratioren, Mäzene und Politiker zu vermeintlich sinnstiftendem Tun wie dem Wiederaufbau des Turms der Potsdamer Garnisonkirche. Abstrakter Ästhetizismus, der sich in unsichtbaren Zeichen selbst genug ist, und als Gegenpol wuchernder Kitsch in Denkmalsetzungen sind Versuche der Visualisierung des Gedenkens, die kritische Betrachtung verdienen.
Die Aufklärung über das schlimmste Kapitel deutscher Geschichte bedarf immer wieder neuer Formen. Ebenso das öffentliche Erinnern und Gedenken. Jede Generation muss die Möglichkeit haben, die notwendige Kenntnis der Geschichte auf ihre Weise zu erwerben. Es ist keineswegs nur Aufgabe der Schule, die entweder gerügt wird, weil sie zu wenig Geschichtsunterricht bietet oder denunziert, weil sie angeblich die ganze deutsche Vergangenheit auf das »Dritte Reich« reduziert und nichts von der stolzen deutschen Geschichte vermittelt. Die Gefolgschaft des ehemaligen Geschichtslehrers Höcke und seiner Parteigenossen in der AfD verkündet solchen Unsinn, weil sie mit der Absage an die Demokratie auch die Erinnerung an die Gräueltaten unter nationalsozialistischer Ideologie austilgen will. Das böse Erbe bleibt jedoch, es geht weiter an kommende Generationen, die damit umgehen müssen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bleibt ein Auftrag für die gesamte Gesellschaft. Voraussetzung ist das Wissen über das Geschehene und seine Folgen. Aufklärung ist die einzige Möglichkeit, Kenntnis zu erlangen und damit umzugehen. Der Nutzen besteht in der Gesellschafts-, Staats- und Lebensform Demokratie, die Frieden, Recht und Freiheit garantiert.
1.Streit um das Erinnern
Woran erinnern?
Mit der Einheit Deutschlands ging eine Neugestaltung der Erinnerungslandschaft einher. KZ-Gedenkstätten gab es in der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren. Ihre finanzielle Alimentation war Sache der Bundesländer, den Inhalt überließ man lange Zeit den Opfern, die als ehemalige Häftlinge die Zeitzeugenschaft an den Stätten ihrer Verfolgung übernahmen. Damit wurden die Gedenkstätten zu Lernorten. In der DDR hatten die KZ-Gedenkstätten, wie in der BRD spät eingerichtet, politische Funktion zur Legitimierung der SED-Herrschaft. Dazu waren sie materiell und personell besser ausgestattet, aber die Professionalisierung bedeutete auch Ideologisierung im Zeichen eines staatlich gelenkten Verständnisses von Antifaschismus.
In die Neubestellung des Feldes der Erinnerung, zu der die Gründung der Gedenkstätten an die SED-Diktatur in ehemaligen Haftanstalten der sowjetischen Besatzungsmacht, Gefängnissen der Staatssicherheit und »Speziallagern« gehörte, schaltete sich die Bundesregierung ein und errichtete neue administrative Strukturen der Förderung. Die Behörde des/der »Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien« (BKM) im Bundeskanzleramt wurde planende Instanz und Schaltstelle der neuen Erinnerungskultur. 1999 legte der damalige Staatsminister für Kultur und Medien eine »Gedenkstättenkonzeption des Bundes« vor, die 2008 fortgeschrieben wurde. Dort wird das Ziel begründet, nämlich historisches Bewusstsein der Bürger zu fördern und dadurch Demokratie zu stiften: »Das Verständnis der eigenen Geschichte trägt zur Identitätsbildung jeder Nation bei. Dazu gehören für uns Deutsche die Lehren, welche die Gründergeneration der Bundesrepublik Deutschland aus der verbrecherischen Herrschaft des Nationalsozialismus gezogen hat: Die unveräußerliche Achtung der Menschenwürde, das Bewusstsein für die Bedeutung der Freiheit und die Wertebindung des Grundgesetzes sind tragende Prinzipien unserer demokratischen Ordnung.«
Die Verpflichtung gegenüber der Geschichte des Nationalsozialismus wird erweitert durch die Erinnerung an die mit der Wende 1989/90 überwundene SED-Herrschaft: »Zum historischen Erbe des wiedervereinten Deutschland zählt seit 1990 auch die kommunistische Diktatur in der ehemaligen SBZ/DDR. Der auf dem Grundgesetz fußende antitotalitäre Konsens verbindet heute die demokratischen Parteien im Wissen um den menschenverachtenden Charakter dieser Diktatur. Darauf beruht unsere gemeinsame Verantwortung, das Gedenken an das menschliche Leid der Opfer wachzuhalten. Geschichte muss konsequent aufgearbeitet werden. Jeder Generation müssen die Lehren aus diesen Kapiteln unserer Geschichte immer wieder neu vermittelt werden.«[1]
Die durch das Gedenken an das Unrecht, das unter DDR-Diktatur geschehen war, erweiterte Agenda brachte nicht nur neue Gedenkstätten zu diesem Thema, auch Topoi wie Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im »Dritten Reich« fanden in Erinnerungsorten Gestalt. Zeitgeschichte wurde öffentlich, fand Publikum, setzte Historiker und Historikerinnen ins Brot. Auch Pädagogen und andere Fachleute, die Konzepte erstellen, Projekte ersinnen, Besucher informieren, Schüler aufklären, zum Erinnern und Gedenken professionell anleiten. Der aufblühenden Bürokratie, die auf staatlicher Seite fördert, lenkt und Erinnerung repräsentiert, stehen Netzwerke gegenüber, in denen sich die diversen Sparten des operativen Geschäftes der Gedenkstätten organisieren. Museologen, Restauratoren, Architekten, Archäologen sorgen mit Experten der Kunstgeschichte, der Didaktik, der Zeitgeschichte für die Eigenständigkeit der Erinnerungskultur, entwickeln Methoden und fachsprachliche Begriffe.[2] Und es sind auch nicht mehr nur die Opfer, über die an den Erinnerungsorten Informationen zu erlangen sind. Die »Topographie des Terrors« in Berlin auf dem Gelände der einstigen Gestapozentrale ist ein herausgehobener Tatort der Geschichte. Auch die KZ-Gedenkstätten verweisen auf die Täter, die längst dem mythischen Nebel entrissen sind, in dem sie verschwanden, als es in der Frühzeit des Erinnerns nur um die Opfer ging.
Im Frühjahr 2024 entstand Unruhe im geordneten Terrain der Erinnerungskultur. Die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth sorgte mit einem Papier, das »eine breite erinnerungskulturelle Diskussion« anstoßen sollte, für helle Aufregung. Die ideell in zwei Lagern angesiedelten Gedenkstättenmandatare waren unisono empört über den Entwurf des »Rahmenkonzepts Erinnerungskultur«. Im Namen sämtlicher Vertreter der »Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten«, der »Arbeitsgemeinschaft Gedenkstätten zur Diktatur in SBZ und DDR«, der »Ständigen Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum«, dem »Verband der Gedenkstätten in Deutschland«, der »Konferenz der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« wurde das Papier als »geschichts-revisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen« verurteilt und der im Konzept erkennbare Abschied vom Konsens verworfen, »dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht relativiert und das SED-Unrecht nicht bagatellisiert werden dürfen«. Vermisst wurde in Claudia Roths »Rahmenkonzept« auch die Reaktion auf die »aktuellen antidemokratischen Entwicklungen in Deutschland und Europa«, die eine verstärkte Auseinandersetzung mit den Ursachen totalitärer Herrschaftsformen erfordern.
Das Dokument, das dem Auge der Öffentlichkeit bald wieder entzogen wurde, nachdem es im Februar 2024 auf der Webseite der BKM zu sehen war, ist ein typischer Fall der Abstinenz der bekennenden Politik und der die Bekenntnisse ausführenden Bürokratie gegenüber der Expertise von Fachleuten. Dafür wimmeln die Phrasen. So erhebt sich »eine Folie der Verantwortung aus der deutschen Gesellschaft«, gefordert werden an anderer Stelle »plurale Perspektiven«, die im »dauerhaften Dialog mit der Zivilgesellschaft ihre stete Fortentwicklung verfolgen«. Höhepunkt: »Besonders im Zug identitätspolitischer Kämpfe hat eine lebendige Erinnerungskultur das Potenzial, das Empathiegefälle und das Risiko einer Opferkonkurrenz auf allen Seiten aufzulösen. Es ermöglicht ein Denken in Solidarität, denn Schmerz ist auch immer politisch.« Die Presse kommentierte das Erinnerungspapier mit Hohn und Spott, zitierte genüsslich Einschätzungen von Gedenkstättenmitarbeitern, die anonym bleiben wollten, die das Elaborat eine »intellektuelle Beleidigung« und eine »umfassende Katastrophe« nannten. Es ging nicht nur um das Gedenkkonzept, vielmehr wurde (in konservativen Blättern) politische Animosität gegen die Staatsministerin zelebriert. Aus der Schweiz war auch das Mantra vom »deutschen Selbsthass« zu vernehmen.
Das Erinnerungskonzept der BKM ist unbrauchbar, weil es Dimensionen verzerrt, Staatsverbrechen neben den Terrorismus fehlgeleiteter Individuen stellt, politische Wünsche mit historischen Fakten mischt. Der BKM-Katalog ist ein erinnerungspolitischer Gemischtwarenladen, der allen etwas bieten will und deshalb ohne Konturen bleibt. Denn neben der NS-Zeit und dem Holocaust sowie der DDR-Geschichte sollen nicht nur die Kolonialverbrechen, sondern auch die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft und die Geschichte der Demokratie als Säulen der deutschen Erinnerungskultur thematisiert und gefördert werden. Den Verbrechen durch staatliche Gewalt, derer am authentischen Ort gedacht werden muss, will die Neukonzeption die terroristischen Exzesse von Rassisten und Rechtsextremen wie die NSU-Morde, die Anschläge in Halle und Hanau usw. in gleicher Größenordnung erinnerungspolitisch zugesellen und damit die Staatsverbrechen nolens volens relativieren.
Bei aller berechtigten Kritik führte Claudia Roth in ihrer Antwort auf die Schelte aus berufenem Mund auch einen unbedingt richtigen Gesichtspunkt an: »Die Lebenswirklichkeit in Deutschland ist durch Migration und Einwanderung geprägt, auf die die Gedenkstätten ebenso wie auf andere Herausforderungen der diversen Gesellschaft bereits mit vielen Angeboten reagiert haben. Noch stärker müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie die Erinnerung an die Schoah und die Lehren aus der Geschichte in und für eine Einwanderungsgesellschaft vermittelt werden können.«[3] Das »Rahmenkonzept« wurde zurückgezogen, nach einem »runden Tisch« im Mai 2024 herrscht Stille.
Das missglückte Konzept war nicht der Anlass, dieses Buch zu schreiben, obwohl im Folgenden Probleme thematisiert sind, die auch dort eine Rolle spielen. Etwa das Geschichtsverständnis in der Einwanderergesellschaft oder die Erinnerung an koloniale Herrschaft. Im Zentrum steht aber, im Gegensatz zur beliebigen Vielfalt politisch erwünschter Erinnerung, das Erbe aus nationalsozialistischer Zeit.
Koloniale Vergangenheit
Dass die Kolonialherrschaft mit ihren Folgen endlich öffentliche Aufmerksamkeit findet und deren Aufarbeitung problematisiert wird, ist nur zu begrüßen. Als Historiker, der sich forschend und lehrend dem Holocaust gewidmet hat, aber auch den Antisemitismus durch vergleichende Ressentimentforschung zu erklären versuchte und dafür den Zorn der Verfechter eindimensionalen Beharrens auf dem Primat der Judenfeindschaft erlebte, ist mir auch die Geschichte kolonialer Gewalt ein Anliegen. Freilich teile ich weder die Aufregung derer, die mit postkolonialer Theorie Auschwitz erklären wollen, noch den Eifer jener, die einen kausalen Zusammenhang zwischen dem deutschen Völkermord in Afrika und dem Holocaust konstruieren.
Die Herrschafts- und Wirtschaftsform des Kolonialismus, die im 19. Jahrhundert als imperialistische Ausbeutung Afrikas und Asiens durch die europäischen Staaten Großbritannien und Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien und zuletzt Deutschland ihren Höhepunkt erreichte, war zutiefst von der Ideologie des Rassismus geprägt.[1] Kolonialismus gründete sich auf das Bewusstsein der »rassischen« Überlegenheit der Europäer als »Weiße«, die das Recht beanspruchten, Menschen angeblich minderen Wertes zu beherrschen, ihrer Ressourcen zu berauben und bei Verstößen gegen die ihnen auferlegten Regeln und Strukturen nach Belieben zu bestrafen. Gerechtfertigt und dargestellt wurde die koloniale politische Praxis als Mission der Zivilisierung und der Kulturvermittlung. Der angebliche Zivilisierungsauftrag schloss körperliche Gewalt (»väterliche Züchtigung« bei Vergehen gegen die von der Kolonialherrschaft verfügte Ordnung) und Brechung von Widerstand bis zum Völkermord (an den Herero in Südwestafrika 1904, im Maji-Maji-Aufstand in Ostafrika 1905/06) ein – zwei schreckliche Höhepunkte der kurzen deutschen Kolonialgeschichte.
Die Zerstörung indigener, politischer und sozialer Strukturen, von Tradition und Kultur galt als Voraussetzung eines notwendigen Kulturtransfers. Die Ausbeutung der »unterentwickelten« Regionen der Erde wurde auch als Transfer der christlichen Heilsbotschaft durch die überlegenere weiße »Rasse« gerechtfertigt und die Kolonialisierung als Hilfe zur Entwicklung stilisiert.
Carl Peters und Adolf Lüderitz, die deutschen Kaufleute, die als Vortrupp der Kolonisation in Afrika mit Eingeborenen Handel trieben und ihnen zu dubiosen Bedingungen Land abkauften, das später als deutsches Staatsgebiet deklariert wurde, verkörpern als Entdecker und Pioniere den Anfang des deutschen Kolonialismus in Afrika. Die Verbrechen an den Völkern der Herero und Nama in Südwestafrika sind ungesühnt. Für die Landnahme gab es keine Entschädigung. Das Bewusstsein für das Unrecht und seine Folgen steht, mehr als ein Jahrhundert nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft, erst in den Anfängen.[2]
Als Postkolonialismus wird das Fortwirken der ökonomischen und politischen Dominanz der ehemaligen Kolonialherrschaften bezeichnet. Insofern ist Deutschland keine postkoloniale Nation. Die Debatte über Restitutionsleistungen und den Umgang mit der jeweiligen Kolonialgeschichte kam erst lange nach dem formalen Ende der Abhängigkeit und den afrikanischen Staatsgründungen seit den 1960er-Jahren in Gang. Auf der politischen und moralischen Agenda, die endlich umgesetzt werden muss, stehen drei Komplexe aus dem Erbe des Kolonialismus. Erstens die offizielle Bitte der deutschen Regierung an die Adresse der Regierung Namibias um Vergebung für den Völkermord an den Herero und Nama. Zweitens der Umgang mit Kunstschätzen und anderen Kulturzeugnissen, die zur Kolonialzeit geraubt und in die Museen Europas verschleppt wurden. Drittens die Entwicklung von solidarischen Umgangsformen und daraus resultierenden seriösen Antworten auf die ökonomischen, sozialen und politischen Probleme des Kontinents Afrika: Armut und Fluchtbewegungen, wozu die Ausbeutung zur Kolonialzeit den Grund gelegt hat. Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, ein prominenter Bürgerrechtler der DDR, zog im Herbst 2018 Kritik auf sich, als er in einem Zeitungsinterview Ahnungslosigkeit angesichts des kolonialen Erbes erkennen ließ und sich Parolen der einstigen Kolonialpropaganda (»Zivilisationsmission«) zu eigen machte. Er drückte aus, was viele immer noch empfinden.
Über den Umgang mit Kulturgut kolonialer Herkunft ist eine Debatte in Gang gekommen. Das riesige aus Afrika stammende Dinosaurierskelett im Berliner Naturkundemuseum ist eine weltweite Attraktion. Aber wem gehört es wirklich? Wie geht man mit Ritualobjekten um, die in europäischen Museen profaniert und ausgestellt sind? Besonders sensibel sind menschliche Überreste, die aus Kolonialraub stammen.
Die deutsche Kolonialgeschichte in Afrika, Ostasien und der Südsee ist die Erzählung darüber, was Ausbeuter in kommerzieller und christlicher Absicht im staatlichen Auftrag verübt haben: die Schandtaten des Carl Peters, der Völker um ihr Land betrog, die Verbrechen des »grimmigen Herrn Theodor von Gunzert«, der als Bezirksamtmann im Namen der Reichskolonialverwaltung am Victoriasee prunkte und prasste, »Eingeborene« auspeitschen und aufhängen ließ. Es geht um die Untaten des Jesko von Puttkamer als Gouverneur von Kamerun und anderer Psychopathen, die ihre sadistischen Neigungen und Machtfantasien in unvorstellbaren Strafexzessen, in Ausrottungsorgien gegen Afrikaner auslebten, sich dazu auf den Auftrag und die Räson des deutschen Kaiserreiches berufen konnten.
Sie fühlten sich als Herrenmenschen und trieben in der kurzen Zeit deutscher Kolonialherrschaft eine genozidale Kolonialpolitik mit langen Folgen. Sie wirkten zusammen mit den Betreibern von Monokulturen und arglistig agierenden Kaufleuten (denen in der Heimat dafür Denkmale gesetzt wurden), mit christlichen Missionaren und Wissenschaftlern (die wie der Nobelpreisträger Robert Koch im Kaiserlichen Gouvernements-Krankenhaus Daressalaam mit dubiosen Methoden experimentierten). Das gereichte dem glücklicheren Teil der Menschheit zu Heil und Segen, jedenfalls zu materiellem Gewinn.[3]
Die kriminelle Geschichte der deutschen Kolonialherrschaft und seiner lange währenden Folgen ist selbstverständlich ein wichtiges Kapitel der deutschen Erinnerungskultur. Geforscht wird seit Langem darüber, für das öffentliche Gedächtnis entdeckt worden ist es erst vor Kurzem. Die Gräuel der Kolonialzeit müssen jedoch nicht (wie die späte Erkenntnis, dass sie verübt wurden, zu lehren scheint) als Vorgeschichte des Holocaust verstanden werden. Der Völkermord am Waterberg 1904 in Deutsch-Südwestafrika war ein Verbrechen sui generis, er war nicht der Probelauf für Auschwitz und er relativiert weder die Singularität des Judenmords noch wird er selbst verharmlost, wenn er als genozidaler Exzess deutschen Herrenmenschentums betrachtet und verstanden wird.
Die Erscheinungen des Kolonialismus sind wie die mentalen Folgen der Überheblichkeit derer, die sie gebilligt haben, im Alltagsrassismus unserer Tage lebendig und Bestandteil unbewussten Erinnerns. Die Notwendigkeit, das auch zu erinnern und im kollektiven öffentlichen Gedächtnis zu verankern, ist evident.[4] Damit sind nicht Sprachregelungen gemeint wie die Empörung über das »N-Wort« oder das Postulat, klassische Figuren der Literatur wie Huckleberry Finn oder Pippi Langstrumpf zu zensieren, gar die Bücher, in denen sie vorkommen, zu verbieten. Stattdessen ist Entschädigung für angerichteten Schaden geboten, Schuldbekenntnis durch Repräsentanten der Nation, Respekt gegenüber Menschen, die Nachkommen einstiger Untertanen der Kolonialherrschaft sind.
Neuer Historikerstreit?
Mit einer Polemik gegen die deutsche Erinnerungskultur entfachte der aus Australien stammende, in New York lehrende, weltgewandte und umtriebige Historiker Dirk Moses eine Debatte über die Singularität des Holocaust und erneuerte das akademische Postulat, den Judenmord im Rahmen der Geschichte der Kolonialherrschaft zu kontextualisieren.[1] Moses sieht die deutsche Erinnerungskultur als eine quasi religiöse Bewegung mit einem »Erlösungsnarrativ«, das er in fünf Glaubenssätzen als »Katechismus der Deutschen« zusammenfasst:
die Einzigartigkeit des Holocaust steht nicht zur Debatte
die Erinnerung an den Zivilisationsbruch des Judenmords bildet das moralische Fundament der deutschen Nation
das Ideologem Antisemitismus ist ein deutsches Phänomen
Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson
Antizionismus ist eine Form des Antisemitismus.
Der von Moses aufgestellte »Katechismus der Deutschen« ist schlüssig formuliert, aber drei der fünf »deutschen Überzeugungen«, auf denen die Erinnerungskultur seiner Meinung nach beruht, treffen nicht zu. Erstens: Die beiden deutschen Nachkriegsstaaten, die 1949 gegründet wurden, sind auf anderen ideologischen Fundamenten errichtet worden als auf der Erinnerung an die Schoah. Zweitens: Antisemitismus ist kein genuin deutsches (oder Deutschland charakterisierendes) Phänomen. Eine der unlösbaren Fragen an den Holocaust besteht ja gerade darin, dass Judenfeindschaft in vielen Nationen stärker ausgeprägt war und gelebt wurde als in Deutschland. Der Judenmord ist aber im aufgeklärten Deutschen Reich geplant, in dessen Namen von gebildeten Menschen verübt worden. Drittens: Die Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus entspringt den Interessen israelischer Politik und wird entsprechend propagiert. Diese Entwicklung, der die offizielle deutsche Politik folgt, begann in den 1990er-Jahren.
Seine steilen Thesen würzte der Historiker Moses mit zutreffenden Argumenten gegen den Übereifer von »Glaubenswächtern« und »Hohepriestern«, die eine notwendige Debatte nur »als Inquisition führen, Häretiker denunzieren und den Katechismus herunterbeten« wollten.[2] Das traf zu in der Causa Achille Mbembe. Gegen den afrikanischen Philosophen des Postkolonialismus zog der »Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus« zu Felde. Er unterstellte ihm Sympathien für die Bewegung BDS, was nicht nur dem Inhaber des monströsen Titels »Antisemitismusbeauftragter« Beweis genug zum Antisemitismusverdacht war. Die politische Boykottbewegung BDS wurde vom Deutschen Bundestag aufs Korn genommen und 2019 mit einer Resolution unter dem Titel »Antisemitismus bekämpfen« bestraft, obwohl sie in Deutschland keinen Einfluss hat, ihr Ziel auch nicht die Verbreitung von Judenfeindschaft ist, sondern eine Zwei-Staaten-Lösung des Palästina-Konflikts, und zwar eine politische Lösung ohne Gewalt.
Das Pamphlet »Katechismus der Deutschen«, mit dem ein streitlustiger Historiker die Aufmerksamkeit auf die Verbrechensgeschichte des Kolonialismus lenken und die Disziplin vergleichender Genozidforschung voranbringen wollte, hat Entrüstung ausgelöst. Das Feuilleton und die Granden der Geschichtswissenschaft haben Moses in die Schranken gewiesen.[3]
Die Attacke von Dirk Moses löste keinen neuen »Historikerstreit« aus, das Publikum hat wenig Notiz genommen, nur die Aktivisten des Postkolonialismus fühlten sich gestärkt. Tatsache bleibt: Vergleichende Genozidforschung ist legitim (wenn auch von vielen Nachkommen der Holocaustopfer nicht gerne gesehen und von Erinnerungsaktivisten als vermeintliche Minderung der Einzigartigkeit des Judenmords verpönt). Tatsache ist, dass sich die deutsche Gesellschaft auch künftig von anderen Nationen dadurch unterscheidet, dass sie zum erheblichen Teil aus Nachkommen der Täter besteht und deshalb im Umgang mit dem Judenmord keine Unbefangenheit einklagen kann. (Zur deutschen Erinnerungsgemeinschaft gehören aber auch die Nachkommen der Widerstand Leistenden und diejenigen, die nach der Katastrophe zugewandert sind.) Der Vorwurf, akademische Forschung und öffentliches Erinnern in Deutschland seien provinziell, da zu sehr auf die deutsche Geschichte bezogen, geht in die Irre.
In den USA und im globalen Süden bestehen andere Voraussetzungen theoretischer Gelehrsamkeit und praktizierten Erinnerns an genozidale Verbrechen.[4] Auf dem afrikanischen Kontinent ist die postkoloniale Perspektive auf die Probleme eigener und fremder Vergangenheit und Gegenwart vorrangig. Im Land der Täter ist die Beschäftigung mit dem Zivilisationsbruch Holocaust jedoch das erste Gebot. Denn unsere Väter und Mütter waren die Akteure und unsere Enkel und deren Nachkommen bleiben die Erben.
Die DDR erinnern
Erinnerung an die DDR ist notwendig. Erinnerungsorte entlang der einstigen Grenze zur Bundesrepublik und an der Berliner Mauer sind Touristenattraktionen. An den Stätten des Wirkens der Staatssicherheit, die in der Berliner Zentrale, in 15 Bezirksverwaltungen, 209 Kreis- und sieben Objektdienststellen andersdenkende Bürger zu Feinden machte und sie mit Terror verfolgte, sind Dokumentationen und Museen errichtet worden. Es gibt in großer Zahl museale Einrichtungen, meist in privater Trägerschaft, die den Alltag in der DDR thematisieren. Sammlerfleiß trug Gerätschaften, Mobiliar, Fahrzeuge zusammen; militärische Objekte können an anderer Stelle bestaunt werden. Die Sammlungen setzen, wie Opas Heimatmuseum, auf den Wiedererkennungswert einer versunkenen Welt. Gedenkstätten haben eine andere Aufgabe. Sie sind Ausdruck der Erinnerungspolitik und damit der politischen Kultur. Sie sind öffentlich und haben gleichzeitig emotionale und museale, d.h. aufklärende Funktion.
In den meisten musealen Inszenierungen erscheint die DDR, je nach Intention, als Gefängnis, als militärischer Technikpark, als Konsumstrecke armer Leute, als Landschaft seltsamen Verkehrsgeschehens mit fossilem Gerät, als untergegangene Lebenswelt, an die nostalgische Annäherung leichtfällt. Reflektierter Umgang mit den Gründungsmythen und Rechtfertigungsstrategien, mit Ideologie und Zielen der Deutschen Demokratischen Republik als Gegenentwurf zur Bundesrepublik Deutschland findet in den musealen Anstrengungen und Einrichtungen eher nicht statt. Ansatzweise ist dies sicherlich im Deutschen Historischen Museum Berlin der Fall, aber die Position, aus der die DDR im Vergleich zur BRD betrachtet wird (und das gilt auch für das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig), ist die der Überlegenheit des Weststaats gegenüber der a priori zum Scheitern verurteilten »Ostzone«.
Die Reduktion der DDR zum Schurkenstaat entspricht zwar verbreiteter Überzeugung, blendet aber die Frage nach Alternativen in der Situation der Nachkriegsjahre nach dem Untergang des NS-Staats aus. Wenn die DDR von allem Anfang an illegitim war, erübrigt sich die Frage nach ihrer politischen Existenz, wenn die Bürger des Staates DDR nur als Opfer einer Diktatur wahrgenommen werden, muss man nicht weiter nach Lebensentwürfen, Hoffnungen, Enttäuschungen in der Gesellschaft fragen. Die politische Geschichte der DDR wie ihre Sozialgeschichte müssen unbefangenen Blickes erst noch geschrieben werden. Das lehrt der Besuch der Museen und Dokumentationsstellen, der Sammlungen von Relikten und der Pflegestätten der Nostalgie. Eine seriöse Aufarbeitung der DDR-Geschichte jenseits schwarzer Pädagogik in Stasi-Gefängnissen und kommerziell vermarkteter Nostalgie steht immer noch in den Anfängen.
Gewiss, Aspekte wie das Grenzregime, die Überwachung der Bürger, die Erziehung zum »neuen Menschen«, Terror und Zwang der SED-Diktatur sind Arbeitsfelder erinnerungspolitischer Kompetenz in Gedenkstätten vor Ort und Institutionen öffentlichen Gedenkens, der Reflexion und Zuwendung an die Opfer des SED-Regimes. Aber die Erinnerung an die Errungenschaften des Staates DDR und seiner Gesellschaft fehlt vielen, die sich weder als Sklaven unter einer Diktatur fühlten noch als Gehilfen des Regimes wahrgenommen werden wollen. Die späte Verdrossenheit nach der Wende, die enttäuschte Bürger in den »neuen Bundesländern« zu Demagogen und rechten Positionen treibt, die vor der Wende als faschistisch gebrandmarkt waren, ist eine Folge der Siegermentalität, die im besten Fall nur Herablassung gegenüber der DDR kannte. Die Überzeugung, die DDR sei nur ein illegitimes Unrechtsregime gewesen, ihre Bewohner folglich in der Mehrzahl entweder Bösewichte oder deren Opfer, hat das Bild in der Geschichte geprägt. Vorgeformt war dieses Bild im Kalten Krieg und Nachdenklichkeit herrschte nicht in der Euphorie der Wendezeit, der die Wendekrise folgte. Damit ist das Unrecht des Regimes, die Diktatur der SED nicht banalisiert.
Ein kardinaler Fehler war der eilige Kahlschlag der Erinnerungskultur der DDR und die Beseitigung ihrer Spuren, etwa im Museum für deutsche Geschichte im Zeughaus Berlin oder dem Ort der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 in Karlshorst, ganz zu schweigen vom Abriss des Palastes der Republik. Ein Fehler war auch, dass kein DDR-Museum in öffentlicher Regie entstand, dass stattdessen eine kommerzielle Einrichtung unter diesem Namen Berlin-Touristen mit der Inszenierung stereotyper Bilder des Lebens in der DDR unterhält. Noch drastischer geht es am Checkpoint Charlie zur Sache, wo Aufklärung über die weltgeschichtliche Dramatik der Konfrontation der beiden Supermächte USA und UdSSR geboten wäre.
Es ist schwer, die Versäumnisse des Kahlschlags zu beheben. Notwendig ist es jedenfalls, die DDR aus einer ausschließlich negativ wahrnehmbaren Erinnerungslandschaft zu befreien. Den ehemaligen DDR-Bürgern und ihren Nachkommen muss ein Geschichtsbild vermittelt werden, das wahrheitsgetreu Licht und Schatten zeigt und individuelle Identifikation ermöglicht, also auch die positiven Charakteristika der DDR-Existenz zeigt: Wohlfahrt und Gemeinschaftsgefühl, Geborgenheit und gesicherten Lebensstandard. Anstatt nur die Unterschiede zwischen der freiheitlichen Demokratie des Westens und der gelenkten sozialistischen Gesellschaft zu betonen, muss eine in die Zukunft weisende Erinnerungskultur die positiven Aspekte der Geschichte der DDR zur Geltung bringen. Das ist für den gesellschaftlichen Frieden aller Bürger der Bundesrepublik wichtig. Dafür ist noch viel zu tun. Im Westen braucht es mehr Interesse für die Geschichte der DDR und ihre Folgen. Im Osten müssen tradierte Feindbilder entkräftet werden, denen zufolge der Faschismus des Hitlerregimes im Adenauerregime fortgesetzt worden, in der DDR hingegen spurlos verschwunden sei. Und die Tatsache, dass die DDR kein Rechtsstaat war, muss akzeptiert werden auch von jenen, die wegen dieser Feststellung in Empörung geraten.
Erforschen, erinnern, gedenken
Aufgabe der Historiker war es lange Zeit, den Leugnern des Judenmords mit faktischen Beweisen entgegenzutreten, die Marginalisierung der Dimension durch »Revisionisten« zu verhindern, dann – im »Historikerstreit« – die Originalität und Einzigartigkeit seiner Ursache gegen die These Ernst Noltes zu beweisen, nach der der Judenmord ein Reflex auf Stalins »ursprünglichere« Verbrechen gewesen sei. Es folgten Daniel Goldhagens Mutmaßungen über einen speziellen deutschen »eliminatorischen Antisemitismus«[1] und Norman Finkelsteins Pamphlet über die »Holocaustindustrie«, die enthusiastischen Beifall im Publikum und energische Zurückweisung durch Historiker erregten.[2]
Das Leid, das Menschen bei welcher Gelegenheit auch immer angetan wurde, ist nicht hierarchisiert, wenn man die Schoah als Zivilisationsbruch zum Maßstab genozidalen Geschehens davor oder danach macht. Im öffentlichen Gedächtnis der Nation der Täternachkommen hat der Judenmord allerdings einen Platz, der die Erben der Tat besonders verpflichtet. Das Erbe teilen die Bürger der alten Bundesrepublik mit den Bürgern der untergegangenen DDR. Der Judenmord unter