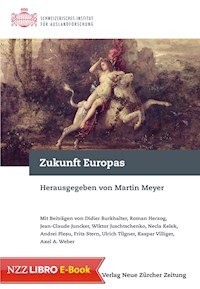
Zukunft Europas E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sozialwissenschaftliche Studien
- Sprache: Deutsch
Europa befindet sich zurzeit in einer Krise, die nicht nur das System der Europäischen Union und die Zukunft des Euros belastet, sondern auch Fragen nach der Identität und dem Selbstverständnis des Alten Kontinents in den Brennpunkt rückt. Im Gefolge der Erschütterungen der letzten Jahre ist insbesondere die Staatsverschuldung vieler Länder besorgniserregend geworden. Rezepte und Strategien sind zwar auf dem Tisch, können aber nicht den gewünschten Erfolg verbuchen. Die Einheit in der Vielfalt erweist sich als Hypothek, übergreifende Politik reibt sich an gegensätzlichen Interessen. Zehn international renommierte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur behandeln Themen wie die Ungleichgewichte in der Wirtschaftspolitik, die Freiheit im Islam, die Neuordnung Europas, die Schweiz in Europa, die Vorteile der Neutralität, die Entzauberung Amerikas. Mit Beiträgen von Didier Burkhalter, Roman Herzog, Jean-Claude Juncker, Wiktor Jusch tschenko, Necla Kelek, Andrei Pl e ¸su, Fritz Stern, Ulrich Tilgner, Kaspar Villiger, Axel A. Weber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE STUDIEN DES SCHWEIZERISCHEN INSTITUTS FÜR AUSLANDFORSCHUNG
BAND 38 (NEUE FOLGE)
Begründet von Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich A. Lutz (†)
www.siaf.ch
Zukunft Europas
Herausgegeben von Martin Meyer
Beiträge von: Didier Burkhalter, Roman Herzog, Jean-Claude Juncker, Wiktor Juschtschenko, Necla Kelek, Andrej Ple¸su, Fritz Stern, Ulrich Tilgner, Kaspar Villiger, Axel A. Weber
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2012 (ISBN 978-3-03823-749-5)
Umschlagabbildung: Moreau, The Rape of Europa, ca. 1869, Oil on panel
© Getty Images
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf andern Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-496-4
www.nzz-libro.ch
Inhalt
Vorwort
AXEL A. WEBERGlobale Ungleichgewichte: Herausforderung für die Wirtschaftspolitik
FRITZ STERNEntzaubertes Amerika?
ULRICH TILGNERPlädoyer für Neutralität
WIKTOR JUSCHTSCHENKODie Ukraine und die Weltwirtschaftskrise
NECLA KELEKÜber die Freiheit im Islam
DIDIER BURKHALTERDie Schweiz – das liberalste Land in Europa
JEAN-CLAUDE JUNCKEREuropa – wie weiter?
KASPAR VILLIGERDie Schweiz in Europa – Chancen und Risiken
ROMAN HERZOGNeuordnung Europas? Wechsel der Aufgabe, Reform der Institutionen?
ANDREJ PLEȘUHat Osteuropa etwas anzubieten?
Autoren und Herausgeber
Vorwort
«Zukunft Europas» – ein Titel, der mannigfaltige Assoziationen weckt, insbesondere seit der grossen Finanz- und Wirtschaftskrise, die ab 2008 den Globus erschüttert hat und deren Folgen noch längst nicht ausgestanden sind. Wohin geht Europa? Wohin wird es getrieben? Welche ökonomischen, gesellschaftlichen Strategien prägen zurzeit den politischen Alten Kontinent? Wie steht es um dessen Alter? Welche Innovationskraft steht zu Gebote? Wie spielen Wettbewerb und Leistungsbewusstsein angesichts globaler Konkurrenz? Was macht das Besondere und Spezifische aus, auf dem sich in europäischem Geist erfolgreich auch für die Zukunft wieder aufbauen liesse?
Mit solchen Fragen sind wir heute konfrontiert, ohne dass rasche und bequeme Antworten bereits parat wären. Im Gegenteil: Seitdem das volle Ausmass an Staatsverschuldung in sehr vielen Ländern Europas offenbar geworden ist, hat sich die Problemlage noch verschärft. Die Europäische Union ist nicht mehr die unantastbare Institution, die unter keinen Umständen zerbrechen könnte, und für die Einheitswährung des Euro gilt dasselbe: Sie ist keineswegs unverrückbar ins Metall geprägt.
Die Vortragszyklen des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung vom Frühjahr- und vom Wintersemester 2011, gehalten an der Universität Zürich, kreisten teils ausdrücklich, teils von der Peripherie her um dieses Thema. Es fehlte auch nicht an dramatischen Einlagen: Dass Präsident Jean-Claude Juncker sein Referat vom 25. Oktober in der Aula, in der 1946 Churchill die legendären Worte «Let Europe arise!» gesprochen hatte, entgegen vieler Erwartungen doch abhielt, obwohl schon am nächsten Morgen wieder ein Krisenmarathon in Brüssel anberaumt war, ist ihm mehr als hoch anzurechnen und wird in die Geschichte des SIAF als ein Akt der Treue eines langjährigen Freundes unseres Instituts eingehen.
Zum Zeitpunkt der Publikation dieses Jahrbuchs sehen wir etwas weiter. Der eingeschwärzte Pessimismus des vergangenen Jahres scheint sich zugunsten einer Einschätzung zu lichten, die wieder auch positive Signale sieht. Aber europäische Grundprobleme bleiben uns auch jenseits der Staatsverschuldungsfallen erhalten. Sie haben mit der Demografie, mit den Asymmetrien wirtschaftlicher Ungleichgewichte, mit der langfristigen Finanzierbarkeit des Sozialstaates und natürlich auch mit Mentalitäten und sogenannten kulturellen Differenzen zu tun. Vor allem aber ist Europa weder eine Insel noch ein Olymp des Selbstvertrauens. Nachbarn rund um das Mittelmeer oder auch weiter nach Osten definieren die Spannungsfelder mit, auf welchen sich Europa zu bewähren hat. Die Konkurrenz des Namens Asien prüft europäische Kompetenzen, wie überhaupt die Schwellenländer im Prozess der Globalisierung zu immer wichtigeren Mitspielern werden.
Selbstredend ist das Verhältnis der Schweiz zu Europa – und vice versa – ein Dauerthema. Für eine gegenseitig produktive Zukunft wäre zu wünschen, dass sich die polemischen Nebentöne legen und man in gegenseitigem Respekt wieder dazu gelangt, Wettbewerbs- und Standortvorteile beider Seiten zu nutzen. Mit Blick auf Europa und insbesondere auf die Europäische Union sind wohl gewisse Reformen, die der Effizienz und einer Obergrenze der öffentlichen Verschuldung dienen, nicht von der Hand zu weisen. Das Spektrum der Referate wird ergänzt etwa um die wichtige Frage nach der Freiheit im Islam, die immer mehr auch eine «europäische» Herausforderung geworden ist, oder um einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und schliesslich auf die Vereinigten Staaten von Amerika im Status diverser Widersprüche, hier aus der Optik eines Altmeisters der Geschichtswissenschaft.
Alles ist in Bewegung. Diese Einsicht ist trivial. Sie muss aber in Erinnerung gerufen werden für die Lektüre der einzelnen Beiträge. Diese sind hier weitgehend so dargestellt, wie sie anlässlich der Vortragsabende präsentiert wurden – anderes ist, auch hinsichtlich ihres dokumentarischen Werts, nicht zu verlangen. Es handelt sich um Momentaufnahmen, die Entwicklung der verhandelten Themen hat sich inzwischen wieder in die eine oder andere Richtung verschoben.
Eine Grundkonstellation allerdings ist stabil. Man kann sie in die Forderung überleiten, dass Europa zukunftsfähig und für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewappnet nur sein kann, wenn es sich vermehrt auf jene Werte besinnt, die seine success story definiert haben: Neugier, aufgeklärte Verantwortung, Schaffenskraft und Freiheit des Gestaltens im Politischen wie in Wirtschaft und Gesellschaft.
Zürich, im April 2012
Dr. Dr. h.c. Martin Meyer
Globale Ungleichgewichte: Herausforderung für die Wirtschaftspolitik
AXEL A. WEBER
Vortrag vom 23. Februar 2011
Um Inhalt und Bedeutung des Themas globale Ungleichgewichte angemessen zu erfassen, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass während der letzten Jahrzehnte die Nationen dieser Welt ökonomisch eng zusammengerückt sind: Stück für Stück fielen Barrieren, die den weltweiten Fluss von Ideen, Dienstleistungen, Waren und Kapital behindert hatten, und es entstand ein globaler Wirtschaftraum. Diese Entwicklung hat zu einem rasanten Anstieg des Wohlstands geführt und birgt noch immer das Potenzial für weiteres Wirtschaftswachstum. Die Schweiz ist ein beeindruckendes Beispiel für diese positive Kraft der Globalisierung. Schliesslich ist es nicht zuletzt Ergebnis einer frühen Einbindung in den Welthandel, dass aus einem relativ armen Land mit wenigen natürlichen Ressourcen eines der reichsten Länder der Welt geworden ist.
In den letzten Jahren ist jedoch das Wachstum der Weltwirtschaft aus dem Gleichgewicht geraten. Sichtbares Symptom sind auseinanderlaufende Entwicklungen in den Leistungsbilanzen verschiedener Länder. Während vor allem die USA sehr grosse Leistungsbilanzdefizite aufweisen, erwirtschaften China und viele Öl exportierende Länder Überschüsse. Vielfach wird im gleichen Atemzug auch auf die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands verwiesen – zu Unrecht, denn im globalen Kontext kommt es vielmehr auf den Euroraum an, dem auch Deutschland angehört und der wegen seiner einheitlichen Geld- und Wechselkurspolitik als Block betrachtet werden muss. Und als solcher hat er gegenüber dem Rest der Welt eine in etwa ausgeglichene Leistungsbilanz. Zwar finden sich auch innerhalb des Euroraums erhebliche wirtschaftliche Divergenzen und dauerhafte Leistungsbilanzunterschiede; doch wäre es sowohl mit Blick auf die Ursachen als auch mit Blick auf die Lösungsansätze verfehlt, dieses innereuropäische Phänomen einfach unter das Thema «globale Ungleichgewichte» zu fassen.
Bevor wir uns aber den globalen und innereuropäischen Ungleichgewichten sowie den jeweiligen Handlungsmöglichkeiten der Politik widmen, möchte ich zunächst einen Blick hinter die Kulissen der anhaltenden Unterschiede von Leistungsbilanzsalden werfen.
Makroökonomische Ungleichgewichte – Symptome versus Ursachen
Anders als es die öffentliche Diskussion bisweilen suggeriert, stellen selbst anhaltende Überschüsse oder Defizite der Leistungsbilanz nicht unbedingt ein Problem dar. Technisch betrachtet reflektiert die Leistungsbilanz die Differenz zwischen der öffentlichen und privaten Ersparnis eines Landes sowie seinen Investitionen. Länder, in denen mehr gespart als investiert wird, exportieren einen Teil ihres Kapitals ins Ausland, verzeichnen Leistungsbilanzüberschüsse und erhöhen so ihr Auslandsvermögen. Länder, die mehr investieren als sparen, müssen sich Geld im Ausland leihen und verzeichnen Leistungsbilanzdefizite. Und ebenso wie für uns Bürger gilt: Es gibt a priori keinen Grund, warum Volkswirtschaften als Ganzes nicht Sparer oder Investoren sein können.
Betrachtet man etwa ein Land mit rasch alternder Bevölkerung wie Deutschland, so ist es dort ein Gebot der ökonomischen Vernunft, mehr zu sparen, als im Inland zu investieren. Zum einen müssen die Bürger sparen, wenn sie auch im Alter ihren Lebensstandard halten wollen, zum anderen nimmt durch die rückläufige Erwerbsbevölkerung die Anzahl rentabler Investitionsprojekte im Inland ab. Das Kapital wird daher im Ausland angelegt, es kommt zu temporären Leistungsbilanzüberschüssen. Auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Länder, die sich in einem wirtschaftlichen Aufholprozess befinden. Dort gibt es meist viele rentable Investitionsprojekte, denen aber nur eine unzureichende inländische Ersparnis gegenübersteht. Entsprechend müssen diese Länder Kapital im Ausland beschaffen, was zu temporären Leistungsbilanzdefiziten führt.
Solcherart begründete Unterschiede in den Leistungsbilanzen – der Ausdruck «Ungleichgewicht» ist hier eigentlich irreführend – erhöhen den Wohlstand, weil sie erlauben, den inländischen Verbrauch zeitlich von der inländischen Erzeugung zu entkoppeln. Dadurch lässt sich der Konsum über die Zeit glätten, während Kapital gleichzeitig dorthin fliesst, wo es den grössten Nutzen stiftet und die höchsten Renditen erzielt. Woher rühren also die Sorgen um die Leistungsbilanzunterschiede auf globaler und europäischer Ebene? Der Grund ist, dass diese Leistungsbilanzunterschiede andere Ursachen haben. Sie waren häufig eben nicht Ausdruck wohl begründeter Spar- oder Investitionsentscheidungen, sondern tiefer liegender Fehlentwicklungen. Damit waren sie nicht Grundlage nachhaltigen Wachstums, sondern ein Problem für die Stabilität der Weltwirtschaft. Werfen wir zunächst einen Blick auf die globale Ebene.
Makroökonomische Ungleichgewichte auf globaler Ebene
Die heute zu beobachtenden anhaltenden Leistungsbilanzunterschiede begannen sich Mitte der 1990er-Jahre zu entwickeln. Bis zur Jahrtausendwende resultierten sie vor allem aus vermuteten Unterschieden in der Rentabilität verschiedener Anlagen. In den USA führten der Hightech-Boom und eine stark zunehmende Produktivität zu steigenden Investitionen. Gleichzeitig nahmen die Investitionen in einigen asiatischen Ländern ab – eine Folge der Asienkrise von 1997 und der Rezession in Japan. Im Ergebnis geriet die Leistungsbilanz der USA ins Defizit, während die asiatischen Länder Leistungsbilanzüberschüsse verzeichneten. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Gründe für das Auseinanderlaufen der Leistungsbilanzen jedoch geändert – und signalisieren zunehmend strukturelle Fehlentwicklungen.
So reflektierte das wachsende Leistungsbilanzdefizit der USA zunehmend einen allgemeinen Rückgang der Ersparnis. Die öffentlichen Ersparnisse nahmen ab, obwohl wegen der alternden Bevölkerung steigende Kosten für Sozial- und Gesundheitssysteme zu erwarten sind. Die privaten Ersparnisse gingen ebenfalls zurück, weil die Bürger steigende Immobilienpreise nutzten, um über Kreditaufnahme ihren Konsum auszudehnen. Den amerikanischen Leistungsbilanzdefiziten gegenüber standen weiter steigende Überschüsse in einigen Schwellenländern, vor allem in China sowie in den Öl exportierenden Staaten. Für Letztere erklären sich die Überschüsse zwar zum Teil durch steigende Ölpreise; dennoch wurden die Überschüsse auch dadurch begünstigt, dass einige Länder eine Wechselkurspolitik betrieben, die ihre Exportsektoren künstlich stärken sollte und die einen beträchtlichen Anstieg der Devisenreserven nach sich zog. Diese Entwicklung vermochte zwar zeitweise die Weltkonjunktur zu stimulieren, bewirkte aber kein dauerhaft kräftiges Wachstum und erhöhte die Verwundbarkeit gegenüber Schocks.
Daher ist es dringend geboten, die Weltwirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Jedoch sollten wir uns davor hüten, die Komplexität des Problems zu unterschätzen. Die Leistungsbilanz eines Landes spiegelt ein sehr komplexes Geflecht in- und ausländischer Einflussfaktoren wider. Daher darf nicht einfach an den Symptomen angesetzt und versucht werden, die Leistungsbilanz direkt zu steuern. Vielmehr gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Leistungsbilanzen aus effizienten, unverzerrten Marktprozessen ableiten und damit auch tragfähig sind. Was bedeutet das für die Defizit- und Überschussländer?
Volkswirtschaften mit Leistungsbilanzüberschüssen sollten vor allem solche strukturellen Verzerrungen beseitigen, die die Binnennachfrage beschränken. Für Länder mit einer unterbewerteten Währung bedeutet das zum Beispiel, die Wechselkurse flexibler zu gestalten. Die anschliessende Aufwertung der Währung würde die Kaufkraft der Bürger stärken und so dazu beitragen, privaten Konsum und Investitionen im Inland wieder zu einer wichtigen Stütze des Wachstums zu machen. Der Ruf nach flexibleren Wechselkursen ist also eine durchaus berechtigte Forderung, jedoch kein Allheilmittel. In China wäre es zum Beispiel ebenso wichtig, die sozialen Sicherungssysteme zu verbessern, damit die Bürger weniger Geld für Notfälle oder das Alter zurücklegen müssen. Diese Verringerung des Vorsichtssparens würde den inländischen Konsum fördern und so den Überschuss der Leistungsbilanz verringern.
In Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten kommt es dagegen darauf an, die volkswirtschaftliche Ersparnis zu erhöhen. Dabei sind Einschränkungen des heimischen Verbrauchs unvermeidbar – die Einkommensniveaus und Wachstumsraten der Vorkrisenzeit können nicht mehr als Massstab dienen. Für den Fiskus bedeutet dies vor allem eine deutliche Verringerung der Staatsdefizite, für die privaten Haushalte in vielen Fällen eine Rückführung der Verschuldung, die im Zuge vorangehender Immobilienblasen rapide gestiegen war. Gerade mit Blick auf die Kreditblase im privaten Sektor leisten die mittlerweile auf den Weg gebrachten Reformen im Bereich der Finanzmarktregulierung einen unverzichtbaren Beitrag, um künftig ähnliche Fehlentwicklungen zu verhindern. Darüber hinaus würde eine marktgerechte Stärkung des Exportsektors ebenfalls dazu beitragen, das Leistungsbilanzdefizit zu verringern.
Auch wenn ich nun einige Ansatzpunkte zur Beseitigung globaler Ungleichgewichte angedeutet habe, müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass es kein Allheilmittel gibt. Je nach Ursachen der Ungleichgewichte sind länderspezifische Lösungen erforderlich. Es handelt sich letztlich um eine nationale Aufgabe, die jedoch internationale Bedeutung hat. Diese Bedeutung wurde bereits früh erkannt. Schon 2006 wurde im Internationalen Währungsfonds (IWF) die Vereinbarung getroffen, globale Ungleichgewichte zu verringern. Der Erfolg dieser Vereinbarung hielt sich allerdings in engen Grenzen.
Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde dann ein erneuter Versuch zur Kontrolle globaler Ungleichgewichte unternommen – dieses Mal von den G20. Ihre im September 2009 veröffentlichte Rahmenvereinbarung für kräftiges, nachhaltiges und ausgeglichenes Wachstum spricht sich ausdrücklich für die Förderung ausgeglichenerer Leistungsbilanzen aus. Und im Gegensatz zur IWF-Vereinbarung wird dieser neue Versuch von den Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer gestützt. Eine Vereinbarung auf dieser Ebene kann eher den notwendigen Druck schaffen, die Reformen auf nationaler Ebene in Angriff zu nehmen. Für den in diesem Kontext zu etablierenden makroökonomischen Überwachungsmechanismus konnten beim G20-Treffen, das vom 18. bis 19. Februar 2011 in Paris auf Ebene der Finanzminister und Zentralbankgouverneure stattfand, weitere Fortschritte erzielt werden, und ich bin zuversichtlich, dass die noch anstehenden, zugegeben schwierigen Verhandlungen letztlich zu einem konstruktiven Ergebnis führen werden. Mit diesem positiven Ausblick sollten wir die globale Ebene verlassen und uns dem Euroraum zuwenden.
Makroökonomische Ungleichgewichte im Euroraum
Im Euroraum sind unausgeglichene Leistungsbilanzen keine neue Erscheinung – vielmehr bestehen sie schon seit Beginn der Währungsunion. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind sie allerdings erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Zu den Ländern mit dauerhaften Überschüssen in der Leistungsbilanz zählen zum Beispiel Deutschland oder die Niederlande. Anhaltende Defizite weisen dagegen Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien oder Irland auf. Auch im Euroraum sind diese Leistungsbilanzunterschiede Ausdruck struktureller Fehlentwicklungen – allerdings mit durchaus eigenen Ursachen.
Erinnern wir uns: Beschafft sich ein Land Kapital im Ausland, führt das zu einem Defizit in seiner Leistungsbilanz; verleiht es Kapital ins Ausland ist ein Überschuss der Leistungsbilanz die Folge. Im Euroraum waren es vor allem die Länder der geografischen Peripherie, die sich Kapital im Ausland beschafft haben. Erleichtert wurde das durch die Einführung des Euro, weil zum einen Wechselkursrisiken wegfielen und sich zum anderen die Risikoaufschläge unterschiedlicher Länder auf niedrigem Niveau annäherten. Das Problem war nun, dass die Defizitländer das zufliessende Kapital nicht immer effizient eingesetzt haben. Anstatt nachhaltige Investitionen zu finanzieren, floss es in boomende Immobilienmärkte, finanzierte hohe Staatsdefizite oder übermässigen privaten Konsum. Die derart stimulierte gesamtwirtschaftliche Nachfrage zog angesichts starrer Arbeitsmärkte deutliche Lohnerhöhungen nach sich, die den Fortschritt der Produktivität übertrafen. Das wiederum verringerte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Länder – Exporte gingen zurück, Importe nahmen zu, und die Leistungsbilanzdefizite wuchsen weiter. Davon profitierten auch die Überschussländer, doch anders als auf der globalen Ebene waren deren steigende Leistungsbilanzsalden vor allem die unmittelbare Folge der hohen Exportnachfrage aus Defizitländern und nicht der Ausschaltung marktlicher Anpassungsprozesse.
Ebenso wie die Ungleichgewichte auf globaler Ebene haben auch die Ungleichgewichte im Euroraum letztlich nationale Ursachen; ihre Auswirkungen jedoch betreffen die gesamte Währungsunion. Über die eng vernetzten Finanzmärkte konnten sich die Störungen rasch verbreiten und mündeten schliesslich in der Staatsschuldenkrise. Um zukünftigen Schaden von der Währungsunion abzuwenden, müssen die Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums dauerhaft abgebaut werden.
Angesichts der geschilderten Ursachen muss der entscheidende Beitrag dazu primär von den Defizitländern erbracht werden: Notwendig sind Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Defizitländer wieder verbessern. Dazu gehören Reformen in der Verwaltung, im Steuer- und Abgabensystem, im Bildungswesen sowie im Arbeits- und Sozialrecht, um die Produktivität der heimischen Unternehmen zu erhöhen, die Arbeitsmärkte zu flexibilisieren und die Staatshaushalte dauerhaft zu konsolidieren. Wenn mit dem Wirksamwerden dieser Massnahmen die Leistungsbilanzdefizite abnehmen, wird das nicht ohne Auswirkungen auf die Überschussländer bleiben. Mit abnehmenden Exportmöglichkeiten dürften dort künftig binnenwirtschaftliche Wachstumskräfte an Bedeutung gewinnen.
In der Vergangenheit wurde wiederholt ein stärkerer Beitrag der Überschussländer zum Abbau der Ungleichgewichte verlangt – insbesondere eine gezielte Förderung der Binnennachfrage. Dazu ist zweierlei zu sagen. Erstens sind die vorgeschlagenen fiskal- oder lohnpolitischen Stimuli ein wenig Erfolg versprechendes Instrument, um die Leistungsbilanzen der Defizitländer zu verbessern. Stiegen beispielsweise die Importe Deutschlands um 10 Prozent, so nähmen die Leistungsbilanzsalden in Spanien, Portugal und Griechenland lediglich um jeweils etwa 0,25 Prozentpunkte zu; in Irland wäre es ein Prozentpunkt. Zweitens ist das Lohnniveau angesichts dezentraler Lohnverhandlungen als wirtschaftspolitisches Instrument nicht verfügbar.
Fazit
Fassen wir kurz zusammen: Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise sind Leistungsbilanzungleichgewichte Gegenstand einer intensiven öffentlichen Debatte. Bei der Analyse dieser Ungleichgewichte müssen wir jedoch gedanklich sauber trennen zwischen der globalen und der europäischen Ebene – der Euroraum als Ganzes hat gegenüber dem Rest der Welt eine ausgeglichene Leistungsbilanz und spielt daher in der Debatte um globale Ungleichgewichte nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt umso mehr, als die Ursachen für die Ungleichgewichte durchaus Unterschiede aufweisen.
Angesichts dieser Unterschiede sind auf globaler und europäischer Ebene jeweils unterschiedliche Ansätze nötig, um die Ungleichgewichte zu beseitigen. In beiden Fällen liegt jedoch die Verantwortung letztlich auf nationaler Ebene. Nur dort können die strukturellen Reformen umgesetzt werden, die notwendig sind, um eine marktliche Anpassung zu ermöglichen, die die Weltwirtschaft wieder auf einen stabilen und ausgewogenen Wachstumspfad bringt.
Entzaubertes Amerika? Fred-Luchsinger-memorial-Lecture
FRITZ STERN
Vortrag vom 9. März 2011
Der Titel meines Vortrags – Entzaubertes Amerika? – kam mir während eines Gesprächs mit Dr. Martin Meyer. Ich dachte an die für mich unvergesslichen Worte von Max Weber aus seinem 1919 gehaltenen Vortrag «Wissenschaft als Beruf», in dem er von der «entzauberten Welt» sprach. Wie anders als entzaubert konnte man die Welt nach den Verheerungen des Krieges beschreiben? Im Kopf war mir insbesondere eine in jenem Vortrag geäusserte Prognose: «Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird und der jungen Generation am schwersten, ist: einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach dem ‹Erlebnis› stammt aus dieser Schwäche. Denn Schwäche ist es, dem Schicksal der Zeit nicht in sein ernstes Antlitz blicken zu können.» Es war die Warnung vor alten Göttern oder auch Dämonen, die mir so zeitgemäss vorkam.
Ich dachte zunächst an die «alten Götter», die in unserer entzauberten Welt in neuen Gestalten hervortreten könnten, und dann kam die Ahnung, dass diese «Götter» vielleicht auch den schleichenden Niedergang Amerikas begleiten. Ein Niedergang entsprungen aus äusseren Verhältnissen, aber noch mehr im Lande selbst verursacht, durch Unbehagen und eigene Konflikte.
Amerika wurde oft entdeckt und vieles wurde auch verdeckt, aus Liebe, aus Unverständnis oder aus Hass und Hochmut. Im Lande selbst wurde es bei aller Selbstkritik immer als etwas Einzigartiges gefeiert. Es wurde in einem liberalen Geist gegründet und es schien, als ob das Land den tiefsten Schmerz, den ein Land empfinden kann, den Bürgerkrieg, überwinden konnte. All das kommt mir am Anfang des 21. Jahrhunderts etwas zweifelhaft vor. Die entzauberte Welt braucht politische Mündigkeit, Bürger, die sich einer immer komplexeren Welt stellen wollen. Die Gefahr der alten Götter oder deren vulgäre Propheten, wie Jacob Burckhardt sagte, der «terribles simplificateurs», verdient ernst genommen zu werden. Bevor ich jedoch auf das Aktuelle komme, möchte ich zunächst kurz auf ein paar historische Aspekte eingehen.
Amerika, die sogenannte Neue Welt hat Europa stets fasziniert. Und Amerika empfand sich auch als neue Welt, im langsamen Prozess zur Selbstständigkeit. Auf den politischen Plan getreten ist das Land Mitte des 18. Jahrhunderts im Kampf mit dem monarchischen Kolonialherren Grossbritannien, erst nur im Protest gegen Ungerechtigkeit, dann im Krieg um Unabhängigkeit. Schliesslich erklärten sich die 13 Kolonien 1776 als unabhängig – in einer noch nie dagewesenen Weise: Die Unabhängigkeitserklärung wurde begründet im angemessenen Respekt vor den Meinungen der Menschheit, auf den Prinzipien, dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind, darunter das Recht auf Leben und Freiheit sowie das Streben nach Glück. In ihr spiegelten sich Zeichen von politischer Vernunft, belebt von Idealen der europäischen Aufklärung. Sie wurde Vorbild für beinah 175 Staaten – und das Land fühlte sich als Vorbild. Widersprüche verdüsterten das Bild von Anfang an, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Zwar war von allen Menschen die Rede, aber nur Weisse waren gemeint, dann die Sklaverei, die Ursünde des Landes.
1787 wurde die Verfassung der USA verabschiedet, eine einmalige Verfassung, geprägt von liberal-konservativen Grundsätzen und Möglichkeiten in Anerkennung der Notwendigkeit, dass auch diese Struktur dem geordneten Wandel angepasst werden muss. Das politische Denken der zweiten Gründergenerationen, festgehalten in den berühmten Federalist Papers, war ebenfalls eine geniale Synthese von europäischem Denken und amerikanischer Wirklichkeit. Auch schweizerisches Denken floss mit ein.
Wenn ich nun auf die aktuelle Situation zu sprechen komme, möchte ich doch zunächst mit zwei privaten Erinnerungen beginnen: 1972 bis 1973 verbrachte ich ein Arbeitsjahr in Holland – einem Land, das wie so viele europäische Länder Geschichte nur so ausatmen. Während dieser Zeit besuchte ich in Leiden den kleinen, harmonischen Hof um die alte Peterskerk. Dieser Hof hatte Anfang des 17. Jahrhunderts den englischen Dissidenten, den Pilgrims gehört, die aus religiösen Gründen aus England geflüchtet waren. Als ich da stand – im späten Herbstlicht erschien es mir wie ein traumhaftes Refugium –, kam mir plötzlich die Frage, was die Pilgrims wohl bewogen hat, diesen freien und friedlichen Ort, an dem sie ihren Glauben in aller Sicherheit leben konnten, zu verlassen, sich einer zwei Monate langen Tortur auf stürmischem Meer auszusetzen, um sich in einem unbekannten, eher wilden Land niederzulassen. War es etwa die Plage der neuen Sprache oder noch mehr das Unbehagen, dass die Kinder anders aufwachsen würden – als zukünftige Holländer, der englischen Sprache und den englischen Sitten entfremdet? Und war diese Erfahrung von vielschichtiger Mobilität nicht eine, die uns auch in unserer Zeit der weltweiten Migration vertraut ist? Ich war im Unklaren. Zurück in den USA konnte ich meine Erklärungen in der Literatur bestätigt finden.
Der Entschluss der Pilgrims, sich in die Neue Welt aufzumachen, geschah aber auch, um Gottes Reich auf Erden zu errichten, im festen Glauben, Gottes Willen zu verwirklichen. Man opferte vieles, nahm vieles auf sich, und die Überwindung der Gefahren untermauerte sogar die Pflicht, etwas entsprechend Grossartiges aufzubauen, und zwar etwas anderes, als es die spanischen Conquistadoren wollten, die zwar auch streng religiös waren, aber von Anfang an Gott und Gold als verwandt betrachteten.
Man glaubte sehr früh an einen amerikanischen Traum, an die gesegnete Einmaligkeit des Landes. Und auch wenn es schon früh Stimmen der Entzauberung oder Ernüchterung gab, lag doch der Superlativ über dem Land. Das erste Schiff mit den Pilgrims, die Mayflower, erreichte Amerika nach heute kaum vorstellbaren Gefahren – aber puritanisches Bewusstsein hat ja Gefallen am asketischen, entsagenden Leben. Fast unvermeidlich, dass daraus bald ein «Mayflower»-Stolz entstand, dass sich die Menschen als eine gottbegnadete Aristokratie betrachteten. Ein so harter, aber offenbar gesegneter Anfang bekam die Weihen des Religös-Grossartigen. Der Mythos der Mayflower und der Plymouth-Kolonie kam später.
Meine zweite Erinnerung reicht noch weiter zurück. Meine Familie war mit mir 1938 aus einem Hitler bejubelnden Deutschland geflüchtet, aus einem Land, das einem ja schon längst enteignet worden war, um in einem Amerika anzukommen, das Franklin D. Roosevelt zum Präsidenten hatte, der die lebendige Demokratie verkörperte, wo Herbert Lehmann, Spross einer deutsch-jüdischen Familie, Gouverneur des Staates New York und der einmalige halb italienische, halb jüdische 100-Prozent-Amerikaner Fiorello LaGuardia energischer anti-faschistischer Bürgermeister von New York war. Amerika – das war ein Land der Freiheit, ein Land, das zwar gerade erneut in eine wirtschaftlich Rezession gefallen war, das aber trotzdem Hoffnung und Vertrauen ausstrahlte. Das Leben meiner Eltern, der Emigranten überhaupt war unendlich schwer. Englisch war mir fremd, aber ich fühlte vom ersten Tag an den Segen der Befreiung, ich glaubte sehr schnell an dieses neue Land. Es war eine bedrückende, aber gleichzeitig bezaubernde Erfahrung. Ich erinnere mich an einen der ersten Tage. Ich hatte mich in einem Vorort der Stadt verirrt und wandte mich an einen Polizisten. Allein, dass der Polizist als Freund wahrgenommen werden konnte, war für mich etwas Neues und zutiefst Beruhigendes: Ich spürte den Frieden der Zivilgesellschaft, ehe ich das Wort auch nur kannte.
Amerika ist oft entdeckt worden und blieb für Europäer ein reizvolles Rätsel. Ich möchte hier nur einige der grossen Stimmen erwähnen, die früh versucht haben, das Land zu verstehen. Einmalig ist diesbezüglich wohl Alexis de Tocqueville, der mit seinem Freund Gustave de Beaumont 1831 bis 1832 die USA besuchte. Ihre Briefe aus Amerika sind kürzlich erstmals erschienen und haben mich sehr beeindruckt. Was hat Tocqueville alles intuitiv verstanden und in herrlichen Briefen festgehalten, um es ein paar Jahre später in seinem Buch grundlegend zu erläutern. Sein erster und bleibender Eindruck: «Die einzige tiefe Leidenschaft, die einzige, die das Herz Tag für Tag bewegt, ist das Erringen von Wohlhaben (und Eigentum) […] Dieses glückliche Land hat keine wirkliche Regierung.» Gleichzeitig fand er, dass «die christliche Religion hier ein stärkeres Fundament hat als irgendein anderes Land, das ich kenne und ich bin sicher, dass dies jede politische Administration beeinflusst». Und: «Das Land muss dem lieben Gott danken, dass es so gelegen ist, dass es weder eine stehende Armee noch eine Polizeikraft braucht, und daher auch nicht eine geschickte oder beständige Aussenpolitik. Falls jemals eines von diesen drei Dingen notwendig sein sollte, dann kann man ohne eine Kristallkugel sagen, dass die Vereinigten Staaten entweder ihre Freiheit oder ‹balance of power› verlieren würden.» Letzteres eine uns melancholisch stimmende Vorhersage.





























