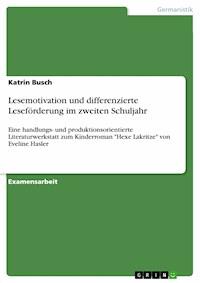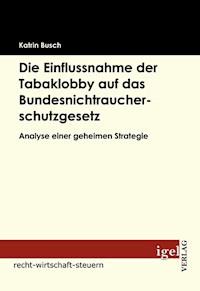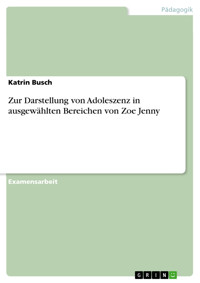
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1, Justus-Liebig-Universität Gießen (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit den letzten beiden Jahrzehnten folgen zahlreiche Jugendromane verstärkt einem charakteristischen Erzählmuster: dem Adoleszenzroman. Diese Romanform, deren literaturgeschichtlicher Ursprung ins späte 18. Jahrhundert fällt, thematisiert „die Ablösungs-, Selbstfindungs- bzw. Identitätsprobleme des jugendlichen Menschen.“ Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zählt der Adoleszenzroman zur Erwachsenenliteratur, seit den 80er Jahren ist er auch als jugendliterarische Form in Deutschland etabliert. Grundlage für die „jugendliterarische Eingemeindung“ des Adoleszenzromans bildet die emanzipatorische Kinderliteraturreform seit Ende der 60er Jahre. Im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses und der kulturellen Veränderungen von Kindheit und Jugend ist es auch für kinder- und jugendliterarische Texte notwendig geworden, darauf zu reagieren und die neuen Problemfelder kritisch zu reflektieren. Die neuen Jugendromane verfügen mehr als die Kinderromane über große zeitgenössische Qualitäten: Sie spiegeln die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und die Veränderungen von Pubertät und Adoleszenz sowie von Familien-, Schul- und jugendlicher Freizeitkultur wieder. Laut Ewers stellt sich den Autoren beim Verfassen zeitgenössischer Texte demzufolge die Frage nach einer Literatur, die die aktuelle Situation von jungen Lesern adäquat abbildet. Auch Gansel stimmt zu, dass „das Moment der Authentizität, der Wahrscheinlichkeit, der Wahrheitsfindung an Bedeutung gewinnt.“ Das Bewusst- sowie Unterbewusstsein von Heranwachsenden realitätsnah darzustellen, kann demzufolge am besten von jungen Autoren erfolgen, die selbst noch einen nahen Bezug zu ihrer eigenen Adoleszenz besitzen. Einen Zugang zu den veränderten Jugendwelten zu finden, ist für ältere Autoren schwierig geworden; eine Rückbesinnung auf die eigene Kindheit reicht bei der Wirklichkeitserkundung nicht mehr aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 3
2.Der Adoleszenzroman582.1. Geschichtliche Entwicklung des Adoleszenzromans59
3. Zur Darstellung von Adoleszenz in ausgewählten Romanen von Zo? Jenny76
3.1 „Das Blütenstaubzimmer“ von Zo e Jenny77
Page 4
3.2. „Der Ruf des Muschelhorns“ von Zoe Jenny105 3.2.1. Inhalt des Textes 105
3.2.2. Aufbau und Erzähltechnik des Textes 108 3.2.3. Figurenanalyse 113
3.2.3.1.Psychologische Aspekte der Kindheit 113
3.2.3.2.Psychologische Aspekte der Adoleszenz 115
3.2.4. Soziales Umfeld der Protagonistin 119
3.2.4.1.Die Protagonistin und die Erwachsenen 119
3.2.4.2.Die Protagonistin und die Jugendlichen 123 3.2.5. Fazit 128
Page 5
0. Einleitung
Seit den letzten beiden Jahrzehnten folgen zahlreiche Jugendromane verstärkt einem charakteristischen Erzählmuster:dem Adoleszenzroman.
Diese Romanform, deren literaturgeschichtlicher Ursprung ins späte 18. Jahrhundert fällt, thematisiert „die Ablösungs-, Selbstfindungs- bzw. Identitätsprobleme des jugendlichen Menschen.“1Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zählt der Adoleszenzroman zur Erwachsenenliteratur, seit den 80er Jahren ist er auch als jugendliterarische Form in Deutschland etabliert. Grundlage für die „jugendliterarische Eingemeindung“ des Adoleszenzromans bildet die
emanzipatorische Kinderliteraturreform seit Ende der 60er Jahre.2Im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses und der kulturellen Veränderungen von Kindheit und Jugend ist es auch für kinder- und jugendliterarische Texte notwendig geworden, darauf zu reagieren und die neuen Problemfelder kritisch zu reflektieren. Die neuen Jugendromane verfügen mehr als die Kinderromane über große zeitgenössische Qualitäten: Sie spiegeln die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse3und die Veränderungen von Pubertät und Adoleszenz sowie von Familien-, Schul-und jugendlicher Freizeitkultur wieder.4
Laut Ewers stellt sich den Autoren beim Verfassen zeitgenössischer Texte demzufolge die Frage nach einer Literatur, die die aktuelle Situation von jungen Lesern adäquat abbildet. Auch Gansel stimmt zu, dass
„das Moment der Authentizität, der Wahrscheinlichkeit, der Wahrheitsfindung an Bedeutung
gewinnt.“5
Das Bewusst- sowie Unterbewusstsein von Heranwachsenden realitätsnah darzustellen, kann demzufolge am besten von jungen Autoren erfolgen, die selbst noch einen nahen Bezug zu ihrer eigenen Adoleszenz besitzen. Einen Zugang zu den veränderten Jugendwelten zu finden, ist für ältere Autoren schwierig geworden; eine
1Ewers, Hans-Heino: Der Adoleszenzroman als jugendliterarisches Erzählmuster. In: Der Deutschunterricht (Berlin),
6/1992, S. 291
2Vgl. Gansel, Carsten: Authentizität - Wirklichkeitserkundung - Wahrheitsfindung. Zu aktuellen Entwicklungslinien in
der Literatur für Kinder und junge Erwachsene. In: Fundevogel, Frankfurt/Main 1998, S. 6
3dazu gehören nach Gansel das Brüchigwerden von lebensweltlichen Kategorien wie Klasse und Stand, der
traditionellen Geschlechterrollen, der Eheverhältnisse, der Familienbeziehungen oder des Verhältnisses der Generationen
zueinander und zu ihren Erziehungsmethoden, die nach Beck/Beck-Gernsheim als Individualisierung und Pluralisierung,
d.h. „die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen“, beschrieben werden. Vgl. dazu Gansel 1998, S. 8
4Vgl. Ewers, Hans-Heino (hrsg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman: Jugendliteratur der 80er und 90er Jahre zwischen
Moderne und Postmoderne. Weinheim; München 1994, S. 7
5Gansel 1998, S. 20
Page 6
Rückbesinnung auf die eigene Kindheit reicht bei der Wirklichkeitserkundung nicht mehr aus.6Eine Literatur, die die Bedingungen von heutigen Jugendwelten gesellschaftsanalytisch thematisiert, bedarf auch einer komplexeren
Darstellungsweise der Struktur des Textes. Da die Jugendliteratur in der Öffnung gegenüber dem Adoleszenzroman jedoch zu ersten Mal mit dem modernen Roman in Berührung gekommen ist, muss sie in formaler Hinsicht auf das erwachsenliterarische Erzählmuster zurückgreifen.7Aus diesem Grund beginnen die Grenzen zwischen jugend- und erwachsenenliterarischem Adoleszenzroman zu verwischen. Die Tendenz der Übernahme von Formen aus der Erwachsenenliteratur hat zu einer gattungstypologischen Ausdifferenzierung sowie zu einer Öffnung des Leserbezugs des Adoleszenzromans geführt.
Gansel macht jedoch auf einen wichtigen Punkt bei der „jugendliterarischen Eingemeindung“ des Adoleszenzromans aufmerksam: Nicht nur der Adoleszenzroman spiegelt das Moderne in der aktuellen Jugend literatur wieder. Texte, die das Thema der „Adoleszenz“ beinhalten, seien nicht alle unter diesem gattungstypologischen Muster zu subsumieren. Als Folge wäre eine Aufschwemmung der Gattung zu erkennen, die die literaturkritische Unterscheidung unbrauchbar mache.8
Um dies zu vermeiden ist es wichtig geworden, einerseits den Begriff des Adoleszenzromans zu präzisieren, andererseits die gattungstypologische Ausdifferenzierung der Jugendliteratur vorzunehmen.
An dieser Stelle knüpft die vorliegende Arbeit an die Thematik an. Ziel ist, das Muster des jugendliterarischen Adoleszenzromans von anderen
gattungstypologischen Mustern abzugrenzen und außerdem die Ausdifferenzierung der verschiedenen Ausprägungen von Adoleszenz innerhalb der Gattung genauer zu bestimmen. Dabei rückt die Form des (post)modernen Adoleszenzromans in den Vordergrund, deren Merkmale herausgearbeitet werden und zur Definierung des Gattungsbegriffs beitragen. In dieser Arbeit gilt es zu analysieren, inwiefern ausgewählte (post)moderne Adolesze nzromane auf den Wandel im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses und den veränderten Jugendwelten reagiert und dem Aktualitätsanspruch Folge leistet.
6Vgl. Gansel 1998, S. 19
7Vgl. Ewers 1992, S. 294
8Vgl. Gansel 1998, S. 16
Page 7
Es ist außerdem wichtig zu betrachten, ob und wie die literarische Darstellungsweise auf (post)moderne Bedingungen eingeht.
Zu Beginn der Erarbeitung der dargestellten Intentionen soll die Vorgehensweise dieser Arbeit erläutert werden:
Da der Adoleszenzroman auf inhalts- bzw. stoffbezogenen Merkmalen basiert, soll im ersten Kapitel auf das Wesen von Adoleszenz eingegangen werden. Das Besondere an dieser Lebensphase ist, dass es hierbei immer um ein Wechselspiel zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Determinanten geht.10D.h. also, dass die Gliederungspunkte immer in Bezug zueinander stehen. Aus diesem Grund geht es zunächst darum, die physiologischen und biologischen Aspekte während der Pubertät und den Phasen der Adoleszenz zu erfassen. Mit den körperlichen Veränderungen gehen psychische Auseinandersetzungen der Heranwachsenden einher, die im Kapitel der „Psychologischen Aspekte von Adoleszenz“ näher betrachtet werden. Die darauf basierende Darstellung der psychologischen Entwicklungsstadien erfolgt unter Berücksichtigung der Geschlechtsdifferenzierung auf der Grundlage des psychoanalytischen „5-Phasen-Modells“ von Peter Blos.11
Anschließend wird der kulturgeschichtliche Aspekt behandelt, denn physiologische und psychologische Prozesse werden durch diesen beeinflusst. Für die Bestimmung von Adoleszenz unter soziologischen Aspekten i st es deswegen wichtig, die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu untersuchen und zu schauen, inwieweit sich soziokulturelle Veränderungen seit dem 20. Jahrhundert auf die Lebensformen, -welten und -perspektiven sowie die Verhaltensweisen junger Menschen auswirken. Dies wird anhand einiger Beispiele von veränderten Merkmalen der Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen in modernen Jugendwelten konkretisiert.
Mit den gesellschaftlichen Modernisierungen geht eine neue Form von Adoleszenz einher, die nunmehr auch literarisch dargestellt wird. Im zweiten Kapitel geht es darum zum einen um die geschichtliche Entwicklung des Adoleszenzromans und zum anderen um die gattungstypologische Ausdifferenzierung. Dies erfolgt in Abgrenzung zu den Gattungen des Bildungs-, Entwicklungs- und Erziehungsroman sowie in Abgrenzung zu den jugendliterarischen Gattungen der Jeansliteratur, der
10Vgl. Flaake, Karin; King, Vera (hrsg.): Weibliche Adoleszenz. Zur Sozialisation junger Frauen. Frankfurt/Main; New
York 1992, S. 13
11Vgl. Blos, Peter: Adoleszenz: Eine psychoanalytische Interpretation. Stuttgart 1989
Page 8
problemorientierten Jugendliteratur und der emanzipatorischen Mädchenliteratur. In diesem Zusammenhang werden auch definitorische Vorschläge diskutiert. Unter Berücksichtigung von physiologischen, psychologischen und soziologischen Merkmalen von Adoleszenz lassen sich unterschiedliche historische Ausprägungen der Gattung des Adoleszenzromans unterscheiden. Diese werden zum Abschluss des zweiten Kapitels bestimmt.
Auf der Grundlage der herausgearbeiteten Merkmale von Adoleszenz und der dazu inhalts- bzw. stoffbezogenen Gattung werden im dritten Teil dieser Arbeit die Textbeispiele „Das Blütenstaubzimmer“ (1997) und „Der Ruf des Muschelhorn“ (2000) von der jungen Autorin Zoe Jenny analysiert. Ausgangspunkt wird dabei sein, welche literarische Gestaltung Adolesezenz in aktueller Perspektive erfährt. Um herauszufinden, ob die Texte auf der Darstellungsebene zeitspezifische Merkmale aufweisen sowie eine formale Veränderung zeigen, werden sie in Bezug auf die Oberflächenstruktur (Figuren, Handlungen, Episoden, Motive, Bilder) und auf die Tiefenstrukturen (Held, Gegenspieler, Erzählperspektive, semantische und syntaktische Beziehungen)12untersucht. Eine besondere Bedeutung trägt dabei die Betrachtung der Darstellungsweise der Beziehungen zwischen den jugendlichen und erwachsenen Figuren wie auch das Verhältnis der jugendlichen Protagonisten zueinander.
In der Schlussbemerkung werden die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammenfassend reflektiert.
12Vgl. Gansel, Carsten: Jugendliteratur und jugendkultureller Wandel. In: Ewers, Hans-Heino (hrsg.) 1994, S. 15
Page 9
1. Adoleszenz
Möchte man den Begriff der Adoleszenz definieren, so muss man diesen unter einer mehrdimensionalen Sichtweise betrachten. Die Adoleszenz bezieht sich auf die Lebensphase, die den Übergang von Kindheit zum Erwachsenenalter bezeichnet. Der Verlauf dieser Lebensphase muss einmal aus biologischer und physiologischer Perspektive gesehen werden, bei der körperliche Veränderungen einhergehen. Weiterhin spielen psychische und soziokulturelle Aspekte im Verlauf der Adoleszenz eine wichtige Rolle. Aus Sicht der Biologie spricht man bei dieser Lebensphase, in der es um die somatischen Veränderungen geht, von der Pubertät. Aus psychologischer Perspektive betrachtet man vor allem das Erleben und die Auseinandersetzung mit den somatischen Veränderungen. Hierbei wird diese Phase mit dem Begriff der Adoleszenz beschrieben. Im Hinblick auf gesellschaftshistorische Aspekte wird in der Soziologie bei der Adoleszenz von der Jugendphase gesprochen.1Remschmidt geht von einer Adoleszenzphase aus, die mit dem 12./14. Lebensjahr beginnt und etwa mit dem 25. Lebensjahr endet. Die Grenzen gestalten sich sowohl nach unten als auch nach oben offen. Jedoch lässt sich die untere Grenze etwas genauer bestimmen, da man diese bei Mädchen mit Einsetzen der Menarche und bei Jungen mit der ersten Ejakulation ausmachen kann. Die obere Grenze hingegen unterliegt einer größeren Variabilität, die von gegebenen sozialen Kriterien (Berufsausbildung, Familiengründung etc.) abhängig ist.2
Ob die Adoleszenzphase eine Übergangsphase zum Erwachsenenalter ist oder als eigenständiger Lebensabschnitt betrachtet werden kann, ist wissenschaftlich nicht geklärt. Ein Faktor, der nach Remschmidt für die Betrachtung der Adoleszenz als Übergangsphase spricht, ist die Tatsache, dass dieser Zeitraum von jungen Menschen selbst als negativ erlebt wird aufgrund körperlicher, psychischer und oftmals krisenhafter Auseinandersetzung mit der Veränderung des eigenen Körpers. Von dem Jugendlichen wird deswegen ein schneller Übergang in den Erwachsenenstatus angestrebt.3
1Vgl. Fend, Helmut: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Opladen 2000, S. 23
2Vgl. Remschmidt, Helmut: Adoleszenz. Entwicklung und Entwicklungskrisen im Jugendalter. Stuttgart, New York
1992, S. 5
3Vgl. ebd.
Page 10
Als weiterer Grund wird das Fehlen von Initiationsriten genannt, die dem Heranwachsenden den reibungslosen Eintritt in die kulturell- gesellschaftliche Welt der Erwachsenen erleichtern. Stattdessen dehnt sich die „Übergangsphase“ ohne sichere gesellschaftliche „Wegweiser“ aus, ohne verbindliche Werte und Normen aufzuzeigen.
Der dritte Faktor, warum Adoleszenz eine Übergangsphase darstellt ist, dass ein Erwachsener immer kompliziertere Funktionen in unserer Gesellschaft wahrnehmen muss und deren Übernahme zunehmend problematischer wird. Um diese Aufgaben verantwortungsvoll zu erfüllen, braucht der Jugendliche mehr Zeit und dementsprechend eine längere Übergangsphase.4Erikson und Eisenstadt schreiben demgegenüber der Adoleszenz den Charakter einer eigenständigen Phase zu. Diese umfasst einen Zeitraum, in dem Jugendliche weder Kind- noch Erwachsenenstatus besitzen, „sondern als Gruppe mit spezifischen Bedürfnissen, Problemen und Sorgen betrachtet werden. In diesem langen Zeitraum haben die Adoleszenten phasenspezifische Verhaltensweisen, Normen, Einstellungen, Gesellungsformen, Rollenverhalten und Konflikte.“5
Überwiegend wird in der Literatur aber die Auffassung vertreten, dass die Adoleszenz eine Übergangsphase darstellt.
1.1 Physiologische und biologische Entwicklung in der PubertätDer Anfang der Adoleszenzphase ist gekennzeichnet von biologischen Veränderungen im Körper des Heranwachsenden, die wiederum wichtige Voraussetzungen für alle folgenden Entwicklungsprozesse sind. Die Pubertät besteht aus vielen Prozessen und ist somit ein komplexer Vorgang. Dieser vollzieht sich über drei Merkmalsgruppen, welche ich im nächsten Kapitel ausführlich darstellen werde. Fend legt die Merkmalsgruppen folgendermaßen fest:
1. Wachstum wie Größe, Gewicht und Körperproportionen
2. Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale wie Brustentwicklung, Schambehaarung, Stimmveränderung, Bartwachstum, Körperbehaarung
4Vgl. ebd.
5Vgl. ebd., S. 6
Page 11
3. Entwicklung primärer Geschlechtsmerkmale (wie Penis und Hoden bzw. der Gebärmutter)
und sexuelle Reifung im Sinne der Menarche und Spermarche.6
Der gesamte biologische Reifungsprozess liegt zwischen vier und zehn Jahren.7Bei Mädchen beginnt die klassische Phase körperlicher Veränderungen etwa zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr.8
In der Regel beginnt die Pubertät bei Jungen zwei Jahre später als bei Mädchen und ist am Ende des zweiten Lebensjahrzehnts abgeschlossen. Mit der Summe an biologischen Entwicklungsprozessen gehen psychische und soziale Veränderungen des Menschen in dieser Lebensphase einher. Der Jugendliche muss lernen, mit seinem sich ändernden Körper zurecht zu kommen, wobei nicht selten Unsicherheiten und krisenartige Konflikte mit sich selbst und der Umwelt entstehen. Darauf soll in dieser Arbeit später noch einmal konkret eingegangen werden.
Zunächst werden die drei wichtigsten puberalen Prozesse beschrieben.
1.1.1 Wachstumsprozesse
Durch endokrine (d.h. hormonell bedingte) Steuerung erfolgt einerseits die Entwicklung der Geschlechtsreife, andererseits eine Veränderung des Menschen hinsichtlich Größe, Körperkraft, Gewicht und den verschiedenen Organsystemen. Nach Fend sind der Wachstumsschub und die Reifung der Fortpflanzungsorgane wichtige Phänomene während der Pubertät.9Remschmidt konstatiert mit dem Wachstumsschub den Beginn der Pubertät.10Jungen wachsen in der Pubertät ca. 9,5 cm, Mädchen 8 cm pro Jahr. Zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr fällt das jährliche Wachstum ab und erreicht sein Ende. Das Pubertätswachstum erfolgt in Schüben und beginnt bei Mädchen zwei Jahre früher als bei Jungen. Mädchen erreichen nicht die gleiche Größe wie Jungen. Der Größenunterschied zwischen Mann und Frau beträgt etwa 12-13 cm.11
6Vgl. Fend 2000, S. 102
7Die Pubertät ist eine zeitlich variable Phase, die nach oben und unten offen ist. Ein Altersjahrgang braucht heutzutage
etwa zehn Jahre, bis ein biologischer Reifungsprozess abgeschlossen ist.
8Vgl. Hagemann-White, C.: Berufsfindung und Lebensperspektive in der weiblichen Adoleszenz. In: Flaake, K./King, V.
(hrsg.): Weibliche Adoleszenz. Zur Sozialisation junger Frauen. Frankfurt am Main, New York 1992, S. 66
9Vgl. Fend 2000, S. 103
10Vgl. Remschmidt 1992, S. 24
11Vgl. Fend 2000, S. 103
Page 12
Genauso wie die Körpergröße verändert sich während der Pubertät auch das Körpergewicht. Durch Auf- und Ausbau des Skeletts, der Muskeln, der inneren Organe und des Fettgewebes erfolgt eine Gewichtszunahme.12Infolge des Gewichts- und Längenwachstums verändern sich auch die Körperproportionen drastisch. Nach Fend erfolgt eine unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeit von Rumpf und Beinen, was zu bekannten führt.13Erscheinungsformen der „Pubeszentendisharmonie“
Körperproportionen verändern sich in einer bestimmten Reihenfolge: Zuerst wachsen Hände und Füße, dann Hüften, Brust, Schultern und am Ende der Rumpf. Gesichtsknochen wachsen rascher als der Rest des Schädels, was in der Pubertät oft zu ungleichmäßigen Gesichtsproportionen führen kann (z.B. eine lange Nase).14
Während des Wachstumsprozesses sind die Veränderungen der Proportionen bei Jungen deutlicher erkennbar als bei Mädchen. Bekommt der Junge im Gegensatz zum Mädchen breitere Schultern, längere Arme und ein schmaleres Becken, so sind beim Mädchen breite Hüften und, im Vergleich zum Rumpf, kürzere Beine prägnant. Außerdem unterscheidet sich die Entwicklung des Fett-und Muskelanteils. Beim Mädchen vergrößert sich der Fettanteil, was mit den bestehenden Schönheitsidealen zusammenstoßen und die Heranwachsende in ihrem positiven Selbstbild erschüttern kann. Beim Jungen dagegen entwickelt sich eine größere Körperkraft.
Bei der motorischen Entwicklung lässt sich feststellen, dass Jungen grobmotorisch geschickter sind, Mädchen hingegen sind feinmotorisch besser ausgebildet.15
12Vgl. Remschmidt 1992, S. 28
13Vgl. Fend 2000, S. 104
14Vgl. ebd.
15Vgl. ebd., S. 104 f
Page 13
1.1.2 Entwicklung primärer und sekundärer GeschlechtsmerkmaleDie Entwicklungen primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale unterliegen einer altersgemäßen Variabilität. Sie folgen aber in relativ konstanter Weise aufeinander.
Bei Mädchen beginnt die Pubertät mit der einsetzenden Pubesbehaarung. Nach Hagemann-White ist die erste Menstruation nicht der Beginn der Pubertät, sondern stellt eher den Abschluss der Veränderungsphase des Körpers dar. Der Wachstumsschub ist somit mit Einsetzen der Menarche beim Mädchen oft schon beendet.16
Merkmale zur Beurteilung der sexuellen Reifung sind außerdem das Wachstum äußerer Genitalien, die Erhöhung der Sensibilität für erotische Reize sowie die beginnende Brustentwicklung. Die Menarche setzt in europäischen Ländern etwa mit dem 13. Lebensjahr ein. Bei Mädchen in den USA ist die erste Menstruation in den letzten Jahren auf ein Lebensalter von 12,3 Jahren gesunken. Viele Mädchen erleben ihre erste Menstruation schon mit elf Jahren oder früher.17Faktoren für das Einsetzen der Menstruation unterliegen genetischen Bedingungen sowie der Ernährungsweise, Wohnortlage, sozialen Bedingungen, Reizzufuhr und klimatischen Umständen.18Etwa zwischen dem 12. und 13. Lebensjahr wachsen auch die inneren Genitalien beim Mädchen. Uterus und Vagina werden größer. Die Ovarien reifen aus. Der Endpunkt einer Entwicklung ist nach Hagemann-White die Fruchtbarkeit. Der erste Eisprung wird jedoch nicht bewusst wahrgenommen.19
Eine zeitliche Abfolge des Reifungsprozesses ist bei Jungen ähnlich wie bei Mädchen erkennbar. Die Pubertät beginnt bei Jungen ca. zwei Jahre später als bei Mädchen. Zunächst beginnt das Wachstum der Hoden, gefolgt von der Pubesbehaarung und dem Peniswachstum. Auch beim männlichen Geschlecht vergrößert sich in geringem Maße die Brust. Etwa ein Jahr nach Beginn des Hodenwachstums, ca. zwischen dem 9. und 15. Lebensjahr, erfolgt die erste Ejakulation. Damit setzt auch beim männlichen Jugendlichen die
16Vgl. Hagemann-White 1992, S .66
17Vgl. ebd.
18Größenwachstum und Gewichtszunahme haben in den letzten 100 Jahren zugenommen. Einher geht das frühere
Auftreten der ersten Menarche. Verantwortlich dafür wird u.a. eine bessere Ernährung, günstigere soziale
Voraussetzungen oder bessere medizinische Versorgung gemacht. Vgl. Remschmidt 1992, S. 62
19Vgl. Hagemann-White 1992, S. 66
Page 14
Fortpflanzungsfähigkeit ein. Andere Veränderungen, die die sekundären Geschlechtsmerkmale beim Jungen betreffen, sind die Axillarbehaarung und der Bartwuchs im Gesicht, der Stimmbruch, der aufgrund der Vergrößerung des Kehlkopfes auftritt, und eine Veränderung der Haut, die sich allerdings auch beim Mädchen bemerkbar macht.20
Die Reifungsabläufe bei Mädchen und Jungen sind nicht konstant, sondern in zeitlicher, wie auch in geschlechtsspezifischer Sichtweise individuell verschieden. Die sogenannten „Frühentwickler“ weisen schon sehr zeitig pubertäre Entwicklungsmerkmale auf, nicht selten treten aber auch „Spätentwickler“ auf, die erst mit 15/16 Jahren ihre ersten pubertären Veränderungen durchleben.
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass der Reifungsprozess bestimmten Einflüssen unterworfen ist, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden kann. Zusammengefasst sind dies genetische, klimatische, ernährungsphysiologische und sozioökonomische Einflüsse, die sich im Wandel der Zeit und in unterschiedlichen Kulturen verändern und somit auch andere Bedingungen für die menschliche Entwicklung darstellen.
1.1.3 Verarbeitungsprozesse der biologischen VeränderungenDie Adoleszenzphase bezeichnet also den Eintritt in das Erwachsenenalter. In dieser Zeit unterliegt der junge Körper einer Vielzahl von Veränderungen, bei der die körperliche wie auch sexuelle Reifung eine wichtige Bedeutung trägt. Der Körper verändert sich zwar schon im frühen Kindesalter, Säuglinge bzw. Kinder besitzen jedoch noch nicht die Fähigkeit, ihren Körper bewusst wahrzunehmen und Veränderungen zu beobachten. Die Bedeutung des eigenen Körpers und die Einstellung dazu nimmt in der Pubertät ganz andere Dimensionen ein: Jugendliche bekommen einen „neuen Körper“ und müssen lernen ihn zu entdecken, zu akzeptieren und „zu bewohnen“. Auch müssen die Heranwachsenden mit der eigene n Geschlechtlichkeit zurecht kommen, die sie noch nie zuvor so massiv gespürt und erlebt haben.21Im Folgenden ist es also
20Vgl. Remschmidt 1992, S. 66 f
21Vgl. ebd., S. 86
Page 15
auch wichtig zu klären, wie Jugendliche ihre körperlichen Veränderungen verarbeiten und ob Schwierigkeiten oder Störungen während dieses Prozesses auftreten können.
Remschmidt beschreibt wichtige Gründe, warum Jugendliche der Veränderung des eigenen Körpers derart große Bedeutung zumessen. Zum einen steigert sich die Aufmerksamkeit von außen: Der Heranwachsende beginnt zu „reifen“ und somit wird erwartet, dass er neue Aufgaben und Normen erfüllt, die einen Druck auf ihn ausüben. Zum anderen wird sich der Jugendliche darüber bewusst, dass die Adoleszenz eine begrenzte Zeitspanne umfasst, deren Endgültigkeit mit dem Erwachsen-Sein festegelegt ist. Infolgedessen tritt die Bestrebung auf, sich so gut wie möglich zu entwickeln, sich demzufolge mit anderen zu messen und den eigenen Körper verstärkt zu beobachten. Auch die Bewertungen und
Beobachtungen von außen sind für den Jugendlichen wichtig, denn er selbst hat oft nur unzureichende Vorstellungen vom Verlauf der Pubertät und der Individualität der Körperentwicklung. Die Unkenntnis darüber kann schließlich zur Überbewertung von Normabweichungen während der körperlichen Veränderungsphase führen, was eine massive Besorgnis und Konzentration auf jede kleinst mögliche Disproportionierung hervorrufen kann.22Die Selbsteinschätzung, die mit dem Vergleich der anderen Altersgenossen einhergeht, ist somit zentraler Punkt in der Pubertät und kann in Ängsten und Überbewertungen münden. Fend weist darauf hin, dass es durch die heutige Propagierung von Idolen in den Massenmedien, sei es in Jugendzeitschriften (Girl, Bravo etc.) oder Jugendsendungen auf Fernsehkanälen wie MTV oder VIVA, für den Jugendlichen nicht gerade einfach ist, Körperdisharmonien während der Pubertät zu akzeptieren. Hier wird nämlich ein perfektes, schlankes, sportliches und attraktives Schönheitsideal entworfen.23Der Vergleich mit anderen Jugendlichen kann aus diesem Grund in der Pubertät positiv gewertet werden, da den Adoleszenten so die große Bandbreite an körperlichen Variationsmöglichkeiten aufgezeigt wird. Dieser positive Vergleich kann andererseits auch ins Gegenteil umschlagen, wenn nicht erkannt wird, welche Veränderungen im Bereich der Normalität liegen. Oft treten dann
22Vgl. ebd., S. 86 f
23Fend 2000, S.232