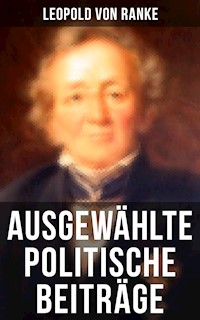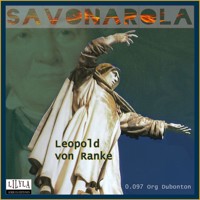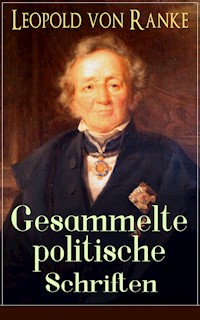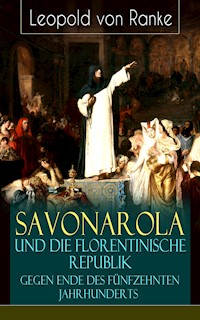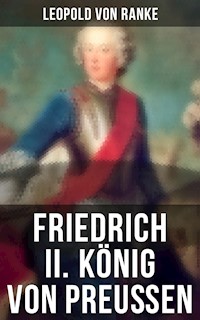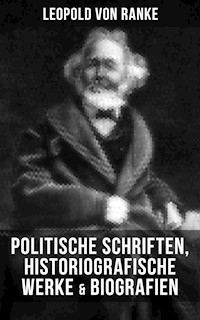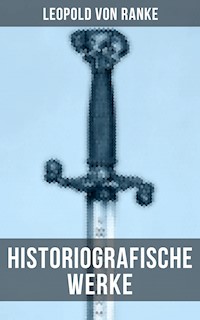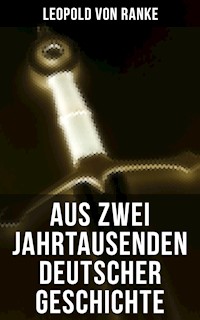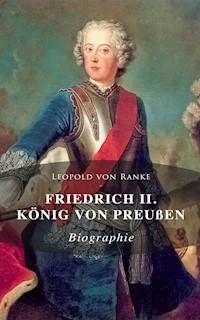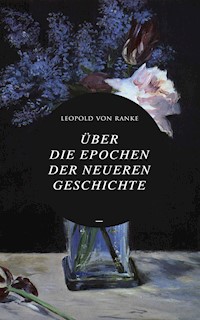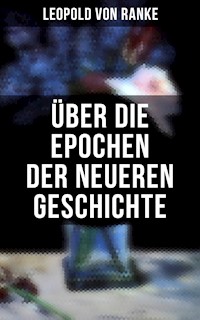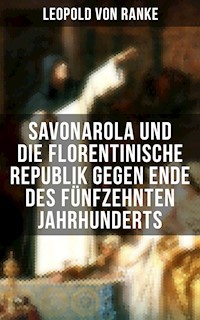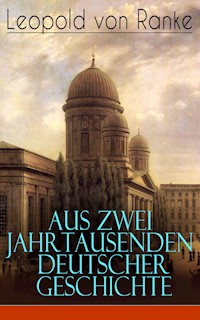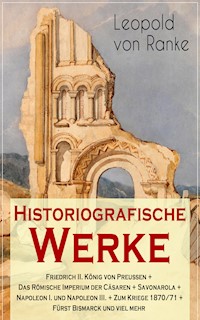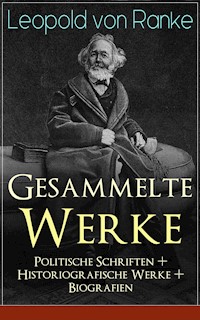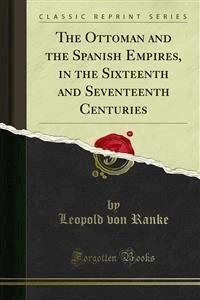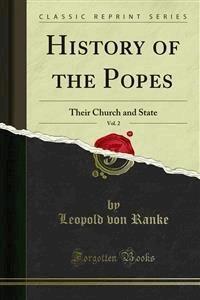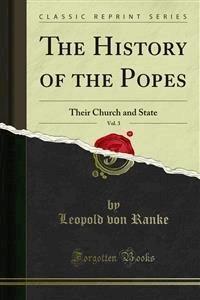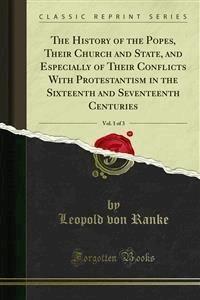Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Zur eigenen Lebensgeschichte' bietet Leopold von Ranke den Lesern einen faszinierenden Einblick in sein eigenes Leben und seine einzigartige Perspektive auf die Welt. Mit seinem prägnanten und detailreichen Schreibstil präsentiert er seine Memoiren als ein Werk der historischen Betrachtung, das ebenso persönlich wie informativ ist. Ranke, als führender Vertreter der Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, erzählt von seinen Begegnungen mit den großen Persönlichkeiten seiner Zeit und reflektiert über die Bedeutung von Geschichte und Erinnerung. 'Zur eigenen Lebensgeschichte' ist ein literarisches Juwel, das sowohl historisch interessierte Leser als auch Liebhaber autobiografischer Literatur gleichermaßen ansprechen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur eigenen Lebensgeschichte
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Mit dem vorliegenden Doppelbande findet die Ausgabe der sämmtlichen Werke Leopold v. Ranke's ihren Abschluß. Seine Weltgeschichte dieser Sammlung einzuverleiben, lag nicht in der Absicht des Verewigten. Statt dessen hat sich der Herr Verleger entschlossen, dieselbe in ihrer gegenwärtigen, glänzenderen Ausstattung den Besitzern der Werke zu einem wesentlich ermäßigten Preise anzubieten, worüber die diesem Bande vorgedruckte Geschäftsanzeige nähere Auskunft ertheilt. –
Gerade das weitführende Unternehmen der Weltgeschichte war es, was Ranke daran verhindert hat, der Summe seiner darstellenden Arbeiten Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens hinzuzufügen, in denen sich zugleich der allgemeine Gang der Begebenheiten des 19. Jahrhunderts als ein mitempfundenes Stück der universalhistorischen Bewegung wiederspiegeln sollte. Dem fühlbaren Mangel, soweit es angeht, abzuhelfen, ist der Zweck des vorliegenden Bandes.
Er beginnt mit dem, was an autobiographischen Aufzeichnungen wirklich zustande gekommen ist. Die beiden Dictate von 1863 und 1869, von denen das erste bereits dem Publicum mitgetheilt worden1, gewähren einen ziemlich vollständigen Ueberblick über die jugendliche Entwicklung bis zu dem Punkte, wo die eigene historische Thätigkeit des Autors anhebt. Die Aufsätze von 1875 und 1885 wurden je vorm achtzigsten und neunzigsten Geburtstage dictirt, weshalb der letzte vielfach an die früher2 veröffentlichte Festrede anklingt, die er jedoch an Fülle und Bestimmtheit des Inhalts weit übertrifft. Beide setzen die Erzählung der persönlichen Lebensbegegnisse nur dürftig fort, während sie die Beziehungen der Studien und literarischen Productionen des Verfassers zu den Erscheinungen der Zeitgeschichte wenigstens im Grundriß darlegen. Sie erregen das Verlangen nach einer authentischen Ergänzung, welche durch die zweite Abtheilung unseres Bandes, über dreihundert ausgewählter Briefe aus den Jahren 1819–1886, in reichem Maße dargeboten wird.
Auch eine derartige Publication hat Ranke noch selber ins Auge gefaßt3; seine Anweisung, nur solche Briefe dazu auszusuchen, die des Aufbewahrens werth seien, diente bei der Composition der gegenwärtigen Sammlung zur Richtschnur. Was sich etwa doch von an sich geringhaltigeren Stücken darin findet, möge man mit der Absicht entschuldigen, die in den wichtigeren Schreiben berührten Verhältnisse, persönlicher oder sachlicher Natur, in einer gewissen Abrundung vorzuführen; statt lästiger Anmerkungen schien es gerathen, die Texte selbst einander gegenseitig erläutern zu lassen. Über den bedeutenden Eindruck des Ganzen kann kein Streit obwalten. Was Ranke von Johannes Müller sagt4, er habe durch seine Briefe am Ende mehr gewirkt, als durch alle seine Werke, wird sich freilich auf ihn selber glücklicherweise niemals übertragen lassen. Aber auch hier rauscht – um sein schönes Wort zu wiederholen – der ursprüngliche Quell des Geistes uns näher und vernehmlicher; auch in den Briefen Ranke's ist das individuelle Leben leichter zu fassen, um so mehr, als er in seiner Geschichtschreibung das eigene Selbst der gegenständlichen Wahrheit zuliebe geflissentlich zurückgedrängt hat.
Bekannt waren von den 329 hier versammelten Briefen bis jetzt nur die 31 an Carl Geibel gerichteten – eine Auslese aus dessen 1886 als Handschrift gedruckter Publication: aus den Briefen Leopold v. Ranke's an seinen Verleger –; sowie die 3 von Alfred v. Reumont empfangenen, die derselbe seinem Nekrolog auf Ranke5 in zerpflücktem Zustande eingeflochten. Alle übrigen waren bisher ungedruckt und sind – mit verschwindenden Ausnahmen – durch die Bemühung der Hinterbliebenen zusammengebracht worden; wie denn die Briefe an Familienmitglieder, an Zahl 175, mehr als die Hälfte sämmtlicher Stücke ausmachen. Obenan stehen darunter: 73 an den Bruder Heinrich, überaus interessant für die Erkenntniß der inneren Entwicklung des Historikers, zumal des jungen; 65 an die Gemahlin, durch lebendige Schilderung äußerer Begegnisse ausgezeichnet; 25 an den Bruder Ernst, merkwürdig besonders in Bezug auf die höchsten Jahre. Gleich allen diesen wurden den Originalen entnommen: die 35 an den Freund Heinrich Ritter adressirten Schreiben, die Hauptquelle für die Geschichte der großen Studienreise; endlich jene an die drei vornehmsten Schüler – meine Gloire als Lehrer, wie Ranke selber sagt6: 22 an Waitz, 14 an Giesebrecht, 6 an Heinrich v. Sybel. Den Spendern der einen wie der anderen sei auch an dieser Stelle der erkenntlichste Dank dargebracht! Von den übrigen 43 Nummern entstammen die meisten, wie z.B. die anziehenden 12 an König Max, den Concepten oder zurückbehaltenen Abschriften.
Die sechs Abschnitte, in welche die vorliegende Briefsammlung chronologisch zerlegt ist, sind durch äußere Momente von einander geschieden: Berufung an die Universität, Aufbruch gen Süden, Rückkehr, Vermählung, Eintritt in den Wittwerstand; doch entspricht ihnen zugleich eine innere Gliederung, die für den Leser der Werke von Bedeutung ist. In der Frankfurter Periode sehen wir aus dem Hintergrunde philosophischer Ideen und klassischer Studien den Autor der romanisch-germanischen Geschichten hervortreten; die erste Berliner Zeit vergegenwärtigt neben dem Anfänger auf dem Katheder den Verfasser von Fürsten und Völkern; in Wien und Italien legt der Schilderer der serbischen Revolution den Grund zu künftigen Meisterwerken; zwischen Heimkehr und Hochzeit fällt außer der historisch-politischen Zeitschrift und den schulstiftenden historischen Uebungen die Schöpfung der Päpste und der Reformationsgeschichte; der Ehemann ist zugleich der Urheber der preußischen, französischen, englischen Geschichte und des Wallenstein, wie der Begründer der historischen Commission; den Wittwertagen sind die letzten Hauptschriften, vom Ursprung des siebenjährigen Krieges bis zur Weltgeschichte, entsprungen.
Eben für diese spätesten Jahre, wo neben leidenschaftlich erhöhter Arbeitsamkeit der Fluß der brieflichen Kundgebung, wenn nicht spärlicher, doch einförmiger rinnt, thut sich willkommen noch eine andere Quelle der Mittheilung auf. Der vereinsamte Greis7 ergab sich dem Selbstgespräch des Tagebuchs. Auch aus den früheren Perioden fand sich im Nachlasse Ranke's eine Anzahl Hefte vor, die jedoch meist mit wissenschaftlichen Notizen angefüllt sind. Das Wenige, was darin der biographischen Theilnahme entgegenkommt, ist auf den ersten Seiten der dritten Abtheilung unseres Bandes zusammengestellt. Eine verhältnißmäßig reiche Ernte von Tagebuchblättern ließ sich dagegen für die Zeit von 1870–1885 gewinnen. Steht dabei die politische Reflexion im Vordergrunde, so wird man nur desto angenehmer überrascht; denn was an Äußerungen über die großen Vorgänge des 19. Jahrhunderts in anderen Bänden der Werke enthalten ist, reichte doch nirgend bis zu dieser Epoche.
Den Schluß des Bandes bildet eine kleine Nachlese verschiedenen Inhalts, die sich selber rechtfertigen mag. Die Erwiderung auf Leo's Angriff und der Entwurf zur Geschichte der Wissenschaften sind vorlängst gedruckt und wurden bei der Composition des vorigen Doppelbandes, in den sie hineingehört hätten, übersehen8. Die übrigen Nummern wurden erst neuerdings dem handschriftlichen Nachlaß enthoben. Ihre Zahl hätte sich wohl aus den Archiven oder den Registraturen der Behörden um einige weitere Gutachten und Denkschriften vermehren lassen; allein der Herausgeber blieb dem Grundsatze treu, nur solche Stücke in die Werke Ranke's aufzunehmen, welche der Meister selbst durch Aufbewahrung im Entwurf oder in Abschrift einigermaßen entschieden dazu bestimmt hatte.
Und so mag denn dieser, der persönlichen Erscheinung des Verewigten geweihte Band der langen Reihe seiner Werke nachfolgen, wie der dankbare Hervorruf des Dichters die Kette der Scenen einer dramatischen Schaustellung schließt. Ranke selbst berichtet in den Briefen an seine Gemahlin mit unschuldigem Vergnügen als eine artige Schmeichelei die Worte seines Freundes Thiers: que je suis le plus grand historien de l'Allemagne et peutêtre de l'Europe, que je vois les choses présentes en historien9. Aber ernstlicher erfreut sein Herz jener andere Ausruf des Vicemasters vom Trinity College beim Festmahl in Cambridge: we admired him before, but now we see, that he is a good fellow!10 Den ersten Spruch dürfte man seinen sämmtlichen Werken überhaupt, den zweiten diesem Schlußbande zur Aufschrift setzen.
Bonn, im November 1890.
Alfred Dove.
Aufsätze zur eigenen Lebensbeschreibung
1. Dictat vom October 1863
Vorwort
Hier in Venedig werde ich ganz besonders an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens erinnert. Wie viele Freunde und Gönner, die mir bei meinem ersten und zweiten Aufenthalt freundschaftliche Dienste erwiesen, konnte ich jetzt nur an ihren Gräbern besuchen; andere, die mir nahe standen, sehe ich in eisgrauer Gebrechlichkeit wieder, kaum zu erkennen gegen damals. Wie oft hat uns in den letzten Jahren zu Haus die Nachricht von dem Abscheiden bald des einen, bald des anderen Freundes erschreckt, auf dessen längeres Leben wir mit Sicherheit rechneten. Dann aber ist auch das meiste von dem verschwunden, was das Gedächtniß eines Jeden über ihn selber aufbewahrt; wie wir soeben bei Jacob Grimm erlebten, von dessen Beziehungen und Motiven ich gleich nach seinem Tode die wichtigsten Momente nicht in Erfahrung bringen konnte, die er selber ohne langes Besinnen mit aller Bestimmtheit mitgetheilt hätte. Entschuldigung genug, wenn ich ein paar freie Stunden dazu anwende, um einen Abriß meines Lebenslaufes, wobei mir mein Sohn Otto die Feder leiht, zu Papier zu bringen.
Jahre der Kindheit
Schubert hat in seinem Leben den Eindruck geschildert, den ihm der Anblick der Gegend Thüringens, in der ich geboren wurde, bei dem Besuch meines väterlichen Hauses gemacht hat. Es ist ein Thal, das sich der güldenen Aue anschließt und häufig zu ihr gerechnet wird, zwischen dem Kyffhäuser und dem Orlas, auf den beiden längeren Seiten von waldbedeckten Anhöhen umgeben, von der Unstrut durchströmt, die sich – denn einst war wohl alles mit Wasser bedeckt – am Fuße des Orlas einen Ausgang gebrochen hat. Seit langen Jahrhunderten aber ist es mit menschlichen Ansiedelungen bedeckt. Die historische Erinnerung reicht – denn das alte thüringische Königreich ist so gut wie vergessen – in die glänzendsten Zeiten der deutschen Geschichte unter dem sächsischen Hause zurück. Einige populäre Erinnerungen, die sich an die Ortsnamen knüpfen, halten Heinrich I. im Gedächtniß. Da ist vor allem das Kloster Memleben, Schöpfung und Sterbestätte der Kaiser, an jenem Durchbruch der Unstrut; die alte Burg Wendelstein, Kloster Roßleben, Kloster Donndorf und die kleine Stadt Wiehe, welche in der Urkunde des 11. Jahrhunderts als eine kaiserliche Veste bezeichnet wird. Hier in Wiehe, in einem von den Vorfahren ererbten Hause, wurde ich am 21. December 1795 geboren. Der Vater gehörte einer Familie an, die wir doch nur bis in die Hälfte des 17. Jahrhunderts genau verfolgen können. Die Vorfahren, die uns bekannt sind, waren alle Geistliche, meist in der Grafschaft Mansfeld.
Unser Stammvater war Israel Ranke, Pfarrer in Bornstedt, einem ansehnlichen Dorf unfern Eisleben, das von Bauern und Bergleuten bewohnt wird, nahe den Ruinen einer Burg der alten Grafen von Mansfeld, von der ein stattlicher Thurm erhalten ist. Israel Ranke hatte einen Bruder mit Namen Andreas1, welcher Pfarrer im Städtchen Hettstedt war, wo man in der Kirche ein Bild von ihm gefunden hat. Andreas war ein Gelehrter, der auf der Universität Leipzig einige Dissertationen verfaßt hat, die etwas Scholastisches in sich tragen, aber in die Fragen jener Zeit eingreifen. Eine Reliquie von ihm ist eine sehr ausgearbeitete Predigt, gehalten nach einem Brandunglück, von dem die kleine Stadt heimgesucht worden war. Sie ist mit einigen historischen Erläuterungen versehen, die ihr in den Augen der Einwohner noch immer einen gewissen Werth geben; sie hat einige Züge, die von Geist zeugen. Auch von Israel sind einige schriftliche Denkmale übrig, die aber nicht gedruckt worden sind. Er lebte ganz seiner Pfarre, welche er von 1671–1694 verwaltete. Das Kirchenbuch zeigt seine Züge in einer festen Handschrift. In seine Zeit fiel eine pestartige Krankheit, so daß er in die Lage kam, eine große Menge Todesfälle in dem Buche aufzuzeichnen; doch wurde das Pfarrhaus davon wie gar nicht berührt. Er hatte eine zahlreiche Familie, wie denn ein Denkmal in der Kirche einem seiner Kinder gewidmet ist, welches ihm starb. Den Stamm setzte sein Sohn Israel Ranke fort, der in dem benachbarten Wolferode das Pfarramt bekleidet hat. Von ihm ist ein Gebet übrig, worin er Gott um Segen für sein Wirken auch in den freien Künsten bittet, damit er den Menschen könne Nutzen schaffen; Worte von Einfachheit und Tiefe, wie sie nicht besser gedacht werden können.
Dessen Sohn war ein Johann Heinrich Israel Ranke, geboren 1719. Er war erst 6 Jahr alt, als sein Vater starb, der kaum so viel hinterließ, daß seine Wittwe leben konnte. Der Knabe wuchs in dem Hause des benachbarten Geistlichen, Decan in Dederstedt, auf, bis er in die Jahre kam, wo ein Lebensberuf ergriffen werden mußte. Da es an allem Vermögen fehlte, so gerieth man auf den Gedanken, den anschlägigen Knaben ein Handwerk lernen zu lassen. Es giebt dort in der Gegend manche Handwerker, welche sich bis nahe zur Kunst erheben; auch damals mag es solche gegeben haben. Der junge Ranke aber wollte nichts davon hören; er wollte werden, was sein Vater und sein Großvater gewesen waren, nämlich Geistlicher. Er entschloß sich kurz und gut, nach Halle zu wandern, um dort Aufnahme in die lateinische Schule des Waisenhauses nachzusuchen. Wir finden seinen Namen in dem Register der Schule 1733. Er wußte es zu erreichen, daß er in Halle und Leipzig studieren konnte, und gelangte zuletzt in die Pfarre des kleinen Dorfes Ritteburg, wo die Unstrut unmittelbar an dem Garten vorüberfließt. Dort hat er mehr als ein Menschenalter gepredigt. Er verheirathete sich mit einem Fräulein Eberhardi in Hechendorf, von welcher das kleine Besitzthum der Familie an uns übergegangen ist. Auch er selbst wußte sehr gut Haus zu halten und hatte einige Capitalien erübrigt. Vielen Kummer machte es ihm, daß er seine Pfarre als Emeritus verlassen mußte. Er that das nur, indem er sein Studierzimmer als sein Eigenthum reservirte. Er ist 1799 in Wiehe gestorben, wohin er sich, den Achtzigen nahe, zu seinem Sohne begeben hatte. Er war ein gelehrter Mann und hatte eine Menge Bücher hinterlassen, fast ausschließlich theologischen Inhalts, die mehr noch der ersten als der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angehörten. Sie lagen auf unserem Boden zusammengehäuft; Classiker fanden sich beinahe keine darunter. Er scheint der orthodoxen Schule von Halle angehört zu haben. Der merkwürdigste Ueberrest von ihm war eine hebräische Bibel und ein Exemplar der Septuaginta mit dem neuen Testament; sie waren mit einer lateinischen Interlinearversion versehen, die der Großvater mit kleiner, aber sehr leserlicher und sauberer Handschrift zwischen die Zeilen geschrieben hatte.
Mein Vater, Gottlob Israel Ranke, war, nicht ganz zur Zufriedenheit des Großvaters, auf der Universität Leipzig von der theologischen zur juridischen Facultät übergegangen, hatte in einigen kleinen Stellen am Harz gestanden und sich dann als praktischer Jurist in Wiehe niedergelassen, wo ihm von seiner frühverstorbenen Mutter ein Haus und ein kleines Landgut zufiel. Seine Thätigkeit war zwischen Bewirthschaftung dieses Besitzes und juristischen Geschäften getheilt. Er machte keinen Anspruch auf Gelehrsamkeit, war schlicht und einfach in seinen Sitten, von unerschütterlicher gläubiger Religiosität, wie er es denn zuweilen bereute, nicht auch Pfarrer geworden zu sein; dabei jedoch ein Mann, der in seiner Bildung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angehörte, der Aufklärung nicht abhold. Auch uns wies er gern über die Schranken der Schule hinaus auf das Leben an; er forderte uns auf, fremde Sprachen zu lernen, auch die neueren, von denen jedoch ihm selbst keine Kunde beiwohnte. Er ließ die alten Stämme in dem Berge, der unser bestes Erbtheil war, ausroden und nutzbare Obstbäume an ihre Stelle setzen. Den Garten, den er erwarb, der aber mehr aus ein paar Teichen bestand, ließ er wirklich zu einem Garten umschaffen, die Untiefen verschütten und Bäume pflanzen, die er dann mit eigener Hand pfropfte. Seine vornehmste, unermüdliche Sorgfalt aber war der Familie gewidmet, die ihm allmählich aus einer gesegneten Ehe erwuchs.
Seine Frau, meine Mutter, Tochter des Rittergutsbesitzers Lehmike in Weidenthal bei Querfurt, war ihm in erster voller Jugendblüthe zugeführt worden. Sie bildeten ein unschuldiges, in allen körperlichen und geistigen Beziehungen gesundes Menschenpaar. Die Mutter war sinnvoll, geistig angeregt, nicht ohne einen gewissen poetischen Anflug, der dem Vater fremd war, jedoch minder glaubensfest als dieser, sehr gutherzig und überaus fleißig, unermüdlich thätig für die wachsende Familie. Die Besorgung der Küche, die Beköstigung der Tagelöhner, namentlich im Sommer, lag ihr ob. Später ging sie wenig aus. In ihren früheren Jahren hat sie wohl selbst ihren kleinen Erstgeborenen getragen, wenn sie mit dem Vater oder einer Freundin nach dem Berge spazieren ging; so im Frühjahr 1796, das, wie sie erzählte, besonders schön war. Noch lebte der Großvater im Haus, dessen letzte Jahre sie durch Fürsorge und jugendlich schöne Erscheinung erheiterte. Er war der Meinung, daß Gott sie eigentlich für ihn ausgesucht und ihm zugeschickt habe, mehr noch als für den Sohn. Er war mein Taufpathe; und es ist fast meine erste dunkle Erinnerung, wie er einst, aus seinem Bette aufstehend, mir an dem nahen Tisch ein kleines Geschenk reichte. Er hat mir seinen Segen gegeben.