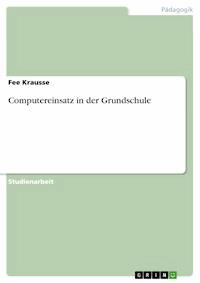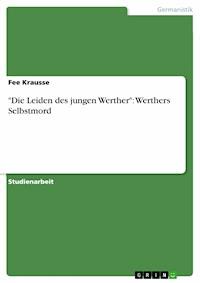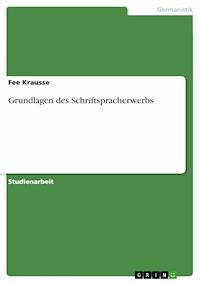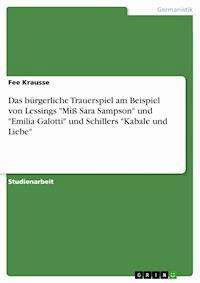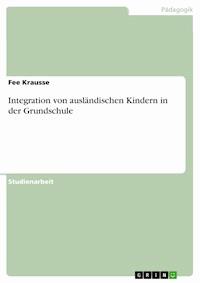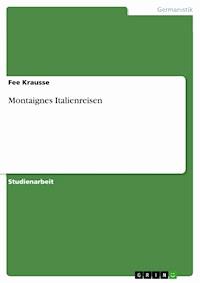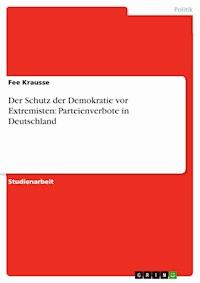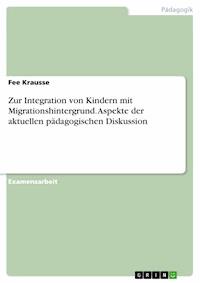
Zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Aspekte der aktuellen pädagogischen Diskussion E-Book
Fee Krausse
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Pädagogik - Interkulturelle Pädagogik, Note: 1, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: „Auf Aufsehen erregende Weise ist das Thema ‚Migration und ihre Folgen für Bildung und Erziehung‘ am Beginn des 21. Jahrhunderts durch den sog. PISA-Schock in die öffentliche Diskussion in Deutschland gelangt.“ (Gogolin 2003, S. 101) Spätestens mit dieser Studie hat das Thema Migration seine alte Aktualität zurück erlangt. Erneut steht die Frage der Integration im Mittelpunkt. „Ich möchte keine zweisprachigen Ortsschilder haben.“ Das war 2002 die Überschrift eines Interviews mit dem deutschen Innenminister Otto Schily. Im Vergleich zu den Inhalten des Interviews erscheint die Überschrift noch harmlos. Schily vertritt die Meinung, die Minderheiten sollten sich anpassen und Deutsch lernen, denn die beste Integration sei Assimilation (vgl. List 2003, S. 33). Diese Einstellung divergiert sehr von den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Diskussionen. Dieser Arbeit liegt keine eindeutige Fragestellung zugrunde; sie hat vielmehr Überblickscharakter und verfolgt das Ziel, Grundlagen der pädagogischen Diskussion rund um das Thema „Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule“ offenzulegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 3
3.2 Sprache und Kommunikation S. 52
3.3 Institutionelle Diskriminierung in der Schule S. 68
3.4 Blickpunkt Lehrer S. 78
Page 4
3.5 Bildungspolitik S. 100
4. Resümee S. 126 5. Literaturverzeichnis S. 132
Page 5
1. Einleitung
„Auf Aufsehen erregende Weise ist das Thema ‚Migration und ihre Folgen für Bildung und Erziehung‘ am Beginn des 21. Jahrhunderts durch den sog. PISA-Schock in die öffentliche Diskussion in Deutschland gelangt.“ (Gogolin 2003, S. 101) Spätestens mit dieser Studie hat das Thema Migration seine alte Aktualität zurück erlangt. Erneut steht die Frage der Integration im Mittelpunkt. „Ich möchte keine zweisprachigen Ortsschilder haben.“ Das war 2002 die Überschrift eines Interviews mit dem deutschen Innenminister Otto Schily. Im Vergleich zu den Inhalten des Interviews erscheint die Überschrift noch harmlos. Schily vertritt die Meinung, die Minderheiten sollten sich anpassen und Deutsch lernen, denn die beste Integration sei Assimilation (vgl. List 2003, S. 33). Diese Einstellung divergiert sehr von den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Diskussionen.
Dieser Arbeit liegt keine eindeutige Fragestellung zugrunde; sie hat vielmehr Überblickscharakter und verfolgt das Ziel, Grundlagen der pädagogischen Diskussion rund um das Thema „Integration von Kindern mit Migrations-hintergrund in der Schule“1offenzulegen.
1.1 Zur Aktualität des Themas
Bei der Erhebung von Daten bezüglich der Migrationsbewegungen in Deutschland muss beachtet werden, dass in „Ausländer-Statistiken“ ausschließlich Menschen mit einem ausländischen Pass berücksichtigt werden, während z.B. Kinder von Aussiedlern - aufgrund ihres sofortigen Anspruchs auf einen deutschen Pass - nicht eingeschlossen sind. Selbstverständlich sind generell nur melderechtlich registrierte Personen erfasst. Bildungssoziologisch sind die amtlichen Statistiken weniger sinnvoll, da neben den Pass-Deutschen (Aussiedlern) auch Eingebürgerte und Kinder aus „Mischehen“ integrationsbedürftig sind (vgl. Preuss-Lausitz 2000, S. 24).
1Mit Kindern sind alle Schüler gemeint, auch Jugendliche und junge Erwachsene.
Page 6
Daten zur Migration in Deutschland
„Die Bundesrepublik Deutschland ist seit ihrer Entstehung de facto ein Einwanderungsland.“ (Wilpert 1991, S. 34) Die höchste Einwanderungsrate (abgesehen von Kriegszeiten) stellte sich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Zwischen 1961 und 1970 wurden 7,5 Millionen Zuzüge gezählt, von 1971 bis 1980 waren es 7,0 Millionen und von 1981 bis 1990 sogar 7,7 Millionen (vgl. Wenning 1994, S. 53). Ende 1998 betrug die Zahl der ausländischen Mitbürger in Deutschland insgesamt ca. 7,32 Millionen; das entsprach etwa 9 % der Gesamtbevölkerung. Der Großteil der Zuwanderer stammt immer noch aus der Türkei, gefolgt von Einwanderern aus dem ehemaligen Jugoslawien und Immigranten aus Italien.
Da Migranten immer noch „gettoisiert“ werden, konzentriert sich der Ausländeranteil meist in Großstädten. Obwohl in Berlin zahlenmäßig die meisten Ausländer leben, betrug ihr Anteil im Jahr 2000 „nur“ 13,1 %2, während der Ausländeranteil z.B. in Frankfurt am Main mit 27,8 % und Stuttgart mit 23,8 % deutlich höher liegt (vgl. Gesemann 2002, S. 81).
In Frankfurt bildeten ausländische Kinder im Schuljahr 2000/01 einen Anteil von 34,0 % (insgesamt an allgemeinbildenden Schulen) (vgl. Plath u.a. 2002, S. 13). Auch diese Zahl bezieht sich nur auf Schüler3mit nicht-deutschem Pass, Kinder mit einer anderen Muttersprache werden nicht erfasst. Es bleibt festzuhalten, dass ethnische, sprachliche und kulturelle Vielfalt kein marginales Phänomen mehr in deutschen Schulen ist, sondern vielmehr zum alltäglichen Bild gehört. Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund Es scheint offensichtlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Gründen schulisch benachteiligt sind. Nachfolgende Tabellen stellen die schulische Situation in Frankfurt dar. Ich habe diese ausgewählt, da Hessen und speziell Frankfurt erstens einen hohen Ausländeranteil aufweist und zweitens eine aktuelle „Dokumentation zur Situation von Schülerinnen und Schülern mit
2Auffällig ist der große Unterschied des Ausländeranteils zwischen Ost- und West-Berlin, mit
5,7% gegenüber 17,4%.
3In dieser Arbeit verwende ich „Schüler“, „Lehrer“, „Migranten“ etc. geschlechtsunspezifisch,
d.h. es sind sowohl weibliche als auch männliche Vertreter der Gruppen gemeint.
Page 7
Migrationserfahrungen an Frankfurter Schulen im Schuljahr 2000/01“ (Plath u.a. 2002) vorliegt.
Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern je nach Schulform (in %)
Diese Tabelle zeigt, dass der Anteil ausländischer Kinder an Hauptschulen im Gegensatz zu deutschen Kindern deutlich höher und gleichzeitig ihr Anteil an Gymnasien extrem niedrig ist. Zudem fällt die verhältnismäßig hohe Beteiligung ausländischer Kinder an Sonderschulen für Lernbehinderte auf4. „Gegenwärtig stellt Hessen mit der mit 15,6 % zweithöchsten
Anteilsquote nichtdeutscher Schülerinnen und Schüler im
allgemeinbildenden Schulsystem dar. Zugleich steht Hessen an
zweiter Stelle der Bundesländer, in denen Migrantenkinder an den
Schulen für Lernhilfe besonders stark vertreten waren. Ihr Anteil
belief sich im vergangenen Schuljahr [1994/95] auf 30 %.“
(Apitzsch 1998, S. 15)
4Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch in West-Berlin schon 1991 ab: Der Anteil ausländischer
Schüler betrug im Schuljahr 1990/91 22,7%, wobei sie an Hauptschulen fast die Hälfte der
Schülerschaft ausmachten und 34% der Schüler an Sonderschulen (für Lern- und Geistig-
behinderte) bildeten. Auffallend ist, dass sich der Ausländeranteil innerhalb von 15 Jahren an
Hauptschulen fast vervierfacht hat und ihr Anteil an Sonderschulen sogar vervierzehnfacht hat
(vgl. Ucar 1991, S. 81f).
Page 8
In der folgenden Tabelle erscheinen die Daten zwar nicht mehr so gravierend, zeigen jedoch auch den Trend, dass ausländische Kinder an sogenannten „schlechteren“ Schulformen überrepräsentiert sind, während sie nur eine geringe Beteiligung in der gymnasialen Schulbildung aufweisen.Prozentuale Verteilung der Schüler über die Schulformen,
getrennt für Deutsche und Ausländer (in %)
Ein ähnliches Bild spiegelt sich in der Aufstellung der erzielten Schulabschlüsse ausländischer Kinder wider. Während im Schuljahr 1999/2000 5,4 % der deutschen Jugendlichen die Schule ohne Abschluss und 12,7 % mit Hauptschulabschluss verließen, hatten 12,8 % der ausländischen Jugendlichen keinen Abschluss und 25 % „nur“ einen Hauptschulabschluss5. Demgegenüber standen 43,6 % deutsche Jugendliche mit der allgemeinen Hochschulreife und lediglich 17 % der ausländischen Jugendlichen, die die allgemeine Hochschulreife erreichten (vgl. S. 83).
Um diesen Schulerfolg bzw. -misserfolg zu erklären, lassen sich verschiedene Gründe finden. Radtke (1998, S. 22-24) zählt vier mögliche Ursachen auf; eine Ursache bezieht sich auf die Kinder selbst, die anderen betreffen das Umfeld Schule.
5Es findet eine zunehmende Entwertung des Hauptschulabschlusses statt (vgl. Auernheimer 1995,
S. 48).
Page 9
1.Häufig werden die Ursachen für schulische Benachteiligung ausländischer
Kinder in deren familiären und sozialen Umfeld gesucht. Zur Begründung
werden ihre Entwicklung, Erziehung und Kontakte zur Umwelt herangezogen.
Auch betonen Vertreter dieser Position die differente Kultur und Sprache,
weshalb Kinder mit Migrationshintergrund Defizite aufweisen.
2.Die zweite mögliche Ursache kann am Lehrpersonal der Schulen gesucht
werden. Zu hinterfragende Aspekte wären hier Professionalität und Kom-
petenz der Lehrkräfte, auch vor dem Hintergrund der Lehrerausbildung und
-fortbildung.
3.Ein weiterer Grund kann ein verfehltes Curriculum darstellen. Es stellt sich
die Frage, ob Lehrpläne und Schulbücher ausreichend auf die multikulturelle
Situation in Schulen eingehen und somit eine Chancengleichheit ermöglichen.
4.Die letzte - in der Öffentlichkeit wenig diskutierte - Perspektive bezieht sich
auf die Organisation der Schule und die Strukturen des Bildungsangebotes.
Dabei spielen Unterschiede des Bildungsangebotes sowohl in Quantität als
auch in Qualität eine Rolle. Dazu zählen z.B. Förderangebote der Schule und
Entscheidungen über die Schullaufbahn der Kinder. Wenn diese Differenzen
sich negativ auf bestimmte Schülergruppen (in diesem Fall Migrantenkinder)
auswirken, wird von institutioneller Diskriminierung gesprochen.
Forschungsrichtungen der interkulturellen Pädagogik
Aus der Forschung über die schulische Beteiligung nicht-deutscher Schüler haben sich unterschiedliche Forschungsrichtungen in Bezug auf eine angemessene Integration von Kindern mit Migrationshintergrund entwickelt. Aktuell leitende Themen sind: InterkulturellesLernen Spracheund Kommunikation InstitutionelleDiskriminierung BlickpunktLehrer Bildungspolitik
Page 10
Interkulturelles Lernen6umfasst einen großen Bereich von Theorien und
Konzepten über didaktische und organisatorische Aspekte bis hin zu Praxis-Vorschlägen.
Im Rahmen der Sprach- und Kommunikationsforschung werden sowohl sprachliche Probleme der Migrantenkinder als auch Kommunikationsstörungen aufgrund von verschiedenen kulturellen Normen behandelt. Institutionelle Diskriminierung wird selten angesprochen und diskutiert, da der Aspekt direkt die Organisation der Schulen angreift. Dazu gehören z.B. Richtlinien und Handlungsweisen bei Einschulung, Schulwechsel und Versetzung.
Der Blickpunkt Lehrer beschäftigt sich auf der einen Seite mit den persönlichen Einstellungen der Lehrer (diskriminierend, tolerant, rassistisch?), auf der anderen Seite mit der Aus- und Fortbildung in Bezug auf interkulturelle Unterrichts-Situationen und der Ausbildung einer eigenen interkulturellen Kompetenz. Die Sektion, die sich mit den vorgenannten Punkten auseinandersetzen muss, ist die Bildungspolitik. Wissenschaftler beschäftigen sich mit der vergangenen und aktuellen Bildungspolitik auf nationaler und internationaler Ebene und geben Anreize, entsprechende Reformen zur Verbesserung der interkulturellen Situation umzusetzen.
1.2 Historische Hintergründe der Migration in Deutschland
In der Bundesrepublik lassen sich drei große Migrantengruppen unterscheiden: ausländische Arbeitnehmer, Flüchtlinge und Spätaussiedler. „Dabei hat schon jede nationale Gruppe eine eigene Wanderungsgeschichte in der Bundesrepublik, die selbstverständlich auch durch soziale, politische, religiöse und kulturelle Differenzierungsprozesse gekennzeichnet ist.“ (Barth 1998, S. 12) Hinzu kommen autochthone Minderheiten, deren Heimat sich durch Grenzverschiebungen änderte.
6Das Adjektiv „interkulturell“ wird von einigen Autoren in Wortzusammensetzungen groß
geschrieben, von anderen klein. Der Einfachheit halber schreibe ich es außerhalb von Zitaten
durchgängig klein.
Page 11
Arbeitsmigration
Während für Frankreich, die Niederlande und Großbritannien die Zuwanderung aus den ehemaligen Kolonien eine große Bedeutung hatte, war das System der Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften in den sechziger Jahren für die Bundesrepublik typisch7. Durch Wiederaufbaumaßnahmen, Modernisierungsprozesse und wirtschaftliche Expansion, primär dem Handel mit der Dritten Welt, wurde ein Wachstum des Arbeitsvolumens notwendig (vgl. Auernheimer 1995, S. 44).
Die Bundesrepublik unterzeichnete Anwerbeabkommen „mit Italien (1995), mit Spanien und Griechenland (1960), mit der Türkei (1961), mit Marokko (1963), mit Portugal (1964), mit Tunesien (1965) und dem ehemaligen Jugoslawien (1968). Der Anwerbestop von 1973 hat die Anwerbephase dieser ausländischen Arbeitnehmer beendet“ (Barth 1998, S. 12). Doch aus den ehemaligen Anwerbeländern wurden europäische Partner und durch das Assoziativabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Republik Türkei, dürfen die Angehörigen der (ehemaligen) Gastarbeiter im Sinne der Familienzusammenführung nachkommen. Auffallend ist der schlechtere Rechtsstatus der ehemaligen Vertragsarbeitnehmer der früheren DDR (hauptsächlich Staatsangehörige aus Vietnam, Mozambique und Angola). Mittlerweile gibt es vor allem mit mittel-und osteuropäischen Staaten Abkommen über kurzfristige Arbeitsverhältnisse. Ende der siebziger Jahre begannen in der Bundesrepublik die Diskussionen um eine Integration der Gastarbeiter, vor allem der zweiten Migrantengeneration. Nach Castles (1987) begann in den achtziger Jahren die „Herausbildung neuer ethnischer Minderheiten“, und zwar durch Gettoisierung und der damit verbundenen eigenen ethnischen Infrastruktur. Dabei findet sich zusätzlich eine hohe ethnische Homogenität in den Ausländervierteln. Gleichzeitig bildeten sich soziale Ungleichheit, ethnische Differenzlinien und Diskriminierung heraus.
7Angesichts meines Themas vernachlässige ich hier die gesamteuropäischen und globalen
Migrationsbewegungen.
Page 12
Flüchtlinge und Asylbewerber
Sowohl der Begriff „Flüchtling“ als auch der 1980 eingeführte Ausdruck „Asylant“ sind negativ besetzt. Die beiden Begriffe werden generell synonym gebraucht, obwohl die Verwaltung nach Barth (1998, S. 13) zwischen verschiedenen rechtlichen Stadien von Asylanten unterscheidet: 1.Asylbewerber
sind Flüchtlinge, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist.
2.Asylberechtigte
sind Flüchtlinge, über deren Asylantrag positiv beschieden wurde.
3.Bona-fide-Flüchtlinge
sind Flüchtlinge, über deren Asylantrag zwar schon positiv beschieden wurde,
der jedoch noch nicht rechtskräftig ist.
4.Bürgerkriegsflüchtlinge
Diese Flüchtlinge können keinen Asylstatus erhalten, da ihnen keine
individuelle Verfolgung nachgewiesen werden kann.
5.De-facto-Flüchtlinge
sind Flüchtlinge, die im Asylverfahren nicht anerkannt wurden , aber aus
humanitären und faktischen Gründen nicht abgeschoben werden können.
6.Kontingentflüchtlinge
sind Flüchtlinge, die aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen durch
politischen Beschluss in der Bundesrepublik aufgenommen werden.
Flüchtlinge und Asylbewerber lösten in den achtziger Jahren zusammen mit den Aussiedlern die sogenannte Gastarbeiterproblematik ab. Wissenschaftliche Literatur befasst sich vorwiegend mit den rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens und weniger mit den sozialwissenschaftlichen Aspekten, da nur mit einem vorübergehenden Aufenthalt gerechnet wird und somit keine Integration von Flüchtlingen vorgesehen ist (vgl. Auernheimer 1995, S. 51). Problematisch stellt sich die Schulsituation für Flüchtlingskinder dar. Nur die Bundesländer Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben eine gesetzliche Schulpflicht, deren Einhaltung jedoch nicht konsequent verfolgt wird. Vor allem alleinreisende minderjährige Flüchtlinge, die vor Krieg, Kriegsdienst oder Verfolgung fliehen, haben es schwer. Ihre Chancen auf eine Schulbildung und einen Ausbildungsplatz sind gering, soziale Marginalität scheint vorprogrammiert. Meist sind sie in Heimen untergebracht; „der Anteil von
Page 13
Flüchtlingskindern an den Heimkindern lag 1993 in Hessen bei 20 Prozent“ (S. 56). Sie sind meist durch biografische Erlebnisse traumatisiert, die durch eine liebevolle Betreuung kompensiert werden müssen. Helfen können dabei homogene Flüchtlingsgruppen, wodurch andererseits wieder einer Gettoisierung Vorschub geleistet wird. Familientrennung, traumatische Fluchterlebnisse und Ausländerfeindlichkeit erschweren das Einleben in einem fremden Land. Aussiedler
Die dritte Einwanderungsgruppe in Deutschland stellen die osteuropäischen Spätaussiedler dar. Schon im Mittelalter wanderten Deutsche als Kolonisatoren nach Osteuropa aus. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Volksdeutscheunter dem Verdacht der Kollaboration - durch die Reichsregierung ausgesiedelt, wodurch sich abrupt ihre Rechtslage und ihr sozialer Status verschlechterten und sie ab diesem Zeitpunkt Diskriminierungen ausgesetzt waren. Während es in der ehemaligen Sowjetunion, in Ungarn und Rumänien zumindest deutschsprachige Kultureinrichtungen gab, ignorierte Polen schlichtweg deutschsprachige Bürger. „Die Sprachkenntnisse sind [...] bei dieser Gruppe aufgrund der kulturellen Unterdrückung besonders mangelhaft. Nach übereinstimmenden Angaben sprechen zwischen 80 und 90 Prozent überhaupt nicht oder nur sehr wenig Deutsch.“ (S. 59)
Aussiedler sind also deutsche Staatszugehörige und erhalten mit der Anerkennung des Aussiedlerstatus aufgrund des bundesdeutschen Staatsbürgerschaftsrechts alle Bürgerrechte. „Sozial und individuell sind natürlich auch Aussiedler Migranten. Zu beobachten ist, daß die individuellen Problemlagen dieser Gruppe sich denen der anderen Migranten immer stärker annähert.“ (Barth 1998, S. 13) Auch Aussiedler leben meist in einem homogenen kulturellen Umfeld, was zunächst eine Integration behindert und zudem sprachlichen Problemen nicht entgegen tritt.
Page 14
Autochthone Minderheiten
Autochthone8Minderheiten zählen nicht zu den Migrationsgruppen, müssen jedoch auch als ethnische Minderheiten betrachtet werden. In der Bundesrepublik existieren fünf kleine autochthone Minderheiten: die Dänen in Schleswig, die Friesen in Niedersachsen, die Sinti und Roma und seit der deutschen Wiedervereinigung die Sorben in Brandenburg und Sachsen (vgl. Auernheimer 1995, S. 67). Während die Sprachen der Friesen, Sinti und Roma schon lange vernachlässigt wurden, unterstützte zumindest die DDR-Regierung die Erhaltung des Sorbischen. Dies geschah durch Zweisprachigkeit in Kindergärten des Sprachgebiets, in Schulen mit Sorbisch als Unterrichtsfach und in einigen Schulen mit Sorbisch als Unterrichtssprache. Auch heute ist in den Landesverfassungen von Brandenburg und Sachsen noch ein Minderheitenschutz verankert.
8Autochthon: eingesessen; Autochthone: Ureinwohner, Eingeborene (vgl. Duden Band 1 1996,
S. 141)
Page 15
2. Allgemeine Begriffsklärungen
Im Bereich der interkulturellen Pädagogik werden viele Begriffe verwendet, davon einige synonym, andere gelten mittlerweile wiederum als diskriminierend. So scheint sowohl der Ausdruck „Ausländerkind“ als auch „Migrantenkind“ negativ besetzt, weshalb man sich aktuell auf „Kind mit Migrationshintergrund“ geeinigt hat. Da dieser Ausdruck jedoch sehr lang ist, werde ich in meinen Ausführungen auch von Migrantenkindern oder ausländischen Kindern sprechen, ohne dies abwertend zu meinen.
Weitere Begriffe, die vor dem Hauptteil dieser Arbeit näher bestimmt werden müssen, sind der Kulturbegriff im interkulturellen Kontext, der Ausdruck „Kulturelle Differenz“, der Unterschied zwischen „Multi- und Interkulturalität“ und schließlich der Integrationsbegriff. Definitionen von anderen Begriffen werden im Verlauf der Arbeit geklärt.
2.1 Der Kulturbegriff im interkulturellen Kontext
Zunächst muss festgehalten werden, dass der Kulturbegriff9je nach Forschungsrichtung sehr unterschiedlich interpretiert wird. „Zwei US-amerikanische Kulturanthropologen wollen über 100 verschiedene Definitionen gefunden haben [...]“ (Auernheimer 2003, S. 73). Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Der eine Aspekt bezieht sich auf den symbolischen Charakter (Rituale, Wohnformen, Kleidung) des mehrdeutigen Kulturbegriffs, der andere Aspekt befasst sich mit der Orientierungsfunktion von Kultur (Darstellung nach außen). Heute besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Kultur heterogen und dynamisch / wandelbar ist und somit nicht eindeutig definiert werden kann. Es finden ständig Änderungen der Lebensverhältnisse statt, jedoch darf kein Automatismus unterstellt werden.
9Einige Erziehungswissenschaftler verwenden statt „Kultur“ den Begriff „Lebenswelt“, da er die
Selbstverständlichkeit und Unreflektiertheit unserer Orientierungsmuster widerspiegelt und keine
umgangssprachlichen Nebenbedeutungen hat (vgl. Auernheimer 2003 und Nieke 2000).