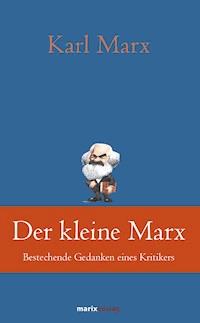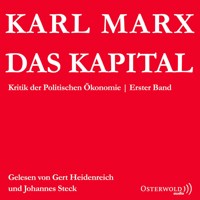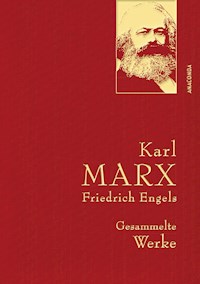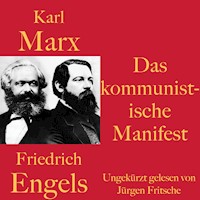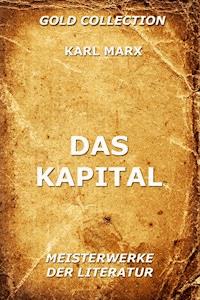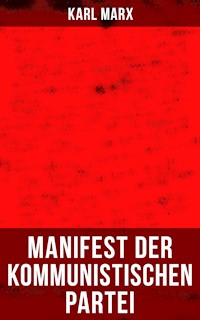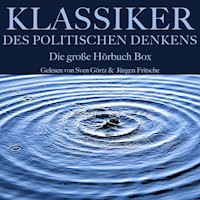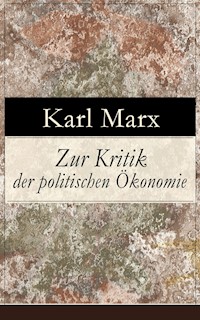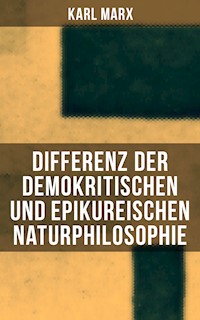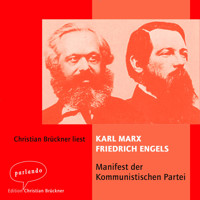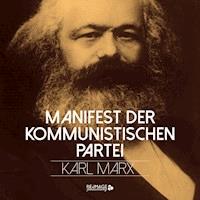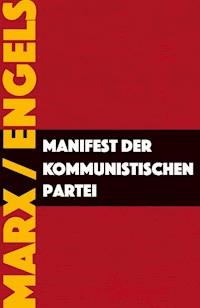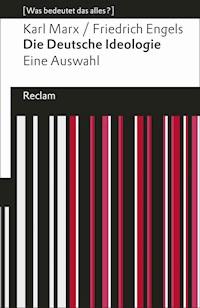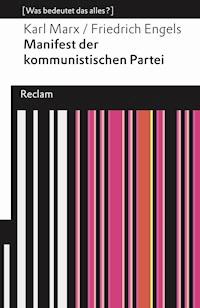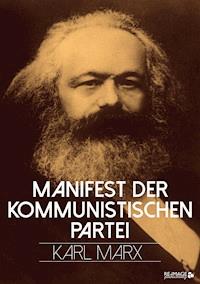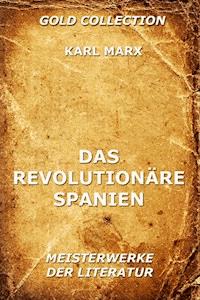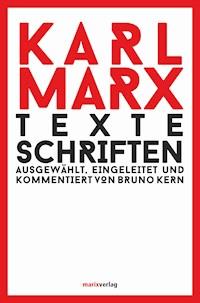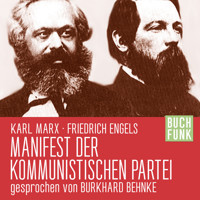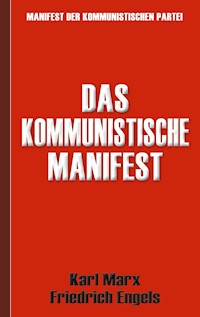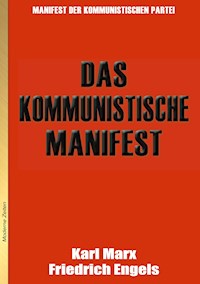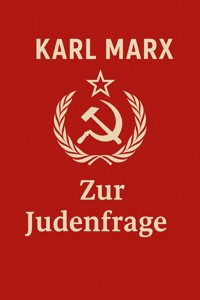
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Zur Judenfrage legt Karl Marx 1843 einen seiner frühesten und zugleich kontroversesten Texte vor. Ausgehend von der Debatte um religiöse Emanzipation in Preußen entwickelt er eine radikale Kritik: Politische Freiheit allein genüge nicht, solange ökonomische Abhängigkeiten und soziale Ungleichheiten fortbestehen. Dieses Werk ist mehr als ein historisches Dokument – es stellt die bis heute aktuelle Frage nach den Bedingungen echter Freiheit. Gleichzeitig erfordert es eine kritische Lektüre, denn manche Begriffe spiegeln die Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts wider und wirken heute problematisch. Diese Ausgabe bietet mit einem einordnenden Vorwort den Schlüssel zum Verständnis eines Textes, der Philosophie, Politik und Gesellschaftskritik auf einzigartige Weise verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Karl Marx
Zur Judenfrage
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
~
I. Bruno Bauer: Die Judenfrage. Braunschweig 1843
II. Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden.
Impressum neobooks
Vorwort
Wenn wir heute, fast zwei Jahrhunderte nach seinem Erscheinen, Karl Marx’ Essay Zur Judenfrage aufschlagen, begegnen wir einem Text, der weit mehr ist als nur ein theoretisches Dokument aus einer längst vergangenen Epoche. Es ist ein Werk, das an einer Schnittstelle von Philosophie, Religion, Politik und beginnender Sozialkritik steht – und zugleich einer der kontroversesten Texte aus Marx’ Feder. Seine Entstehung 1843 fiel in eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche: Das alte Europa mit seinen monarchischen Strukturen und starren Ständegesellschaften begann zu wanken, liberale und demokratische Bewegungen gewannen an Kraft, und die „soziale Frage“ – das Elend der wachsenden Industriearbeiterschaft – rückte ins Zentrum politischer Debatten.
Die konkrete Ausgangslage für Zur Judenfrage war zunächst eine Debatte über Religionsfreiheit und politische Emanzipation im damaligen Preußen. Marx antwortete auf Schriften des jungen Philosophen Bruno Bauer, der argumentierte, Juden könnten erst dann vollständige politische Rechte erhalten, wenn sie ihre religiöse Identität aufgäben. Marx widersprach Bauer entschieden – doch nicht, indem er einfach für Toleranz und gleiche Rechte plädierte. Stattdessen drehte er die Fragestellung radikal um: Nicht die Juden müssten sich ändern, meinte Marx, sondern die Gesellschaft selbst. Politische Emanzipation reiche nicht aus, solange die ökonomischen und sozialen Grundlagen von Unterdrückung und Entfremdung bestehen blieben.
Gerade hier liegt die historische Bedeutung des Textes: Er ist einer der ersten Momente, in denen Marx den Gedanken formuliert, dass wahre Freiheit nicht allein in politischen Rechten, sondern in der Veränderung der materiellen Verhältnisse liegt. Religion, so schreibt er berühmt, sei nur „die Theorie der Welt“, während das Elend und die Ausbeutung des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft die eigentliche Praxis bilden. Deshalb, so Marx, müsse man tiefer gehen: Nicht nur die politische Ordnung reformieren, sondern die gesellschaftliche Grundlage selbst umwälzen.
Doch dieser Text ist nicht nur für seine theoretische Radikalität bekannt, sondern auch für die bis heute heftig diskutierte Sprache, in der Marx von „dem Judentum“ spricht. Manche Passagen scheinen problematisch, weil sie Begriffe verwenden, die später in ganz anderen, antisemitischen Kontexten auftauchten. Marx selbst wollte keine antisemitische Schrift verfassen – er setzte „Judentum“ oft gleich mit Geldwirtschaft oder Kapitalismus, was seiner Zeit geschuldet ist, aber heute befremdlich wirkt. Moderne Leserinnen und Leser müssen daher genau unterscheiden: zwischen der historisch-philosophischen Argumentation und den problematischen Formulierungen, die nicht aus dem 20., sondern aus dem 19. Jahrhundert stammen und dennoch einer kritischen Lektüre bedürfen.
Warum also sollten wir uns im 21. Jahrhundert noch mit Zur Judenfrage beschäftigen? Die einfachste Antwort lautet: weil Marx hier, bei allen Widersprüchen und zeitbedingten Begriffen, eine der grundlegenden Trennlinien moderner Gesellschaften aufzeigt – die Unterscheidung zwischen politischer und sozialer Emanzipation. Politische Emanzipation bedeutet, dass Menschen formell gleiche Rechte erhalten: Freiheit der Religion, Meinungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz. Diese Rechte sind unbestreitbar Fortschritte der Moderne. Aber Marx bemerkt scharf: Politische Gleichheit bedeutet nicht automatisch soziale Gleichheit. Man kann Bürgerrechte genießen und doch in Armut, Ausbeutung oder Entfremdung leben. Diese Kritik trifft bis heute: Auch in modernen Demokratien existieren Klassenunterschiede, ökonomische Ungleichheiten und Abhängigkeiten, die nicht durch Wahlen oder Verfassungen allein verschwinden.
Damit berührt Marx eine Debatte, die aktueller kaum sein könnte. Wenn wir heute über soziale Gerechtigkeit, über die Macht globaler Konzerne, über prekäre Arbeitsverhältnisse oder über die Rolle des Geldes im politischen Prozess sprechen, dann bewegen wir uns in einem Feld, das Marx hier bereits andeutet. Sein Text fordert uns auf, nicht bei der Frage nach Rechten und Gesetzen stehen zu bleiben, sondern tiefer zu fragen: Welche materiellen Bedingungen verhindern, dass Menschen ihre Freiheit wirklich leben können? Wo entstehen neue Formen von Abhängigkeit, selbst dort, wo die politische Ordnung demokratisch verfasst ist?
Gleichzeitig zwingt uns der Text, über Sprache und historische Kontexte nachzudenken. Manche Begriffe, die Marx verwendet, sind für heutige Leser irritierend. Er spricht vom „Judentum“ nicht primär als Religion, sondern als Symbol für eine kapitalistische Wirtschaftsweise – eine Metapher, die in seiner Zeit verbreitet war, heute aber problematisch wirkt, weil sie sich von tatsächlichen Juden und ihren Lebensrealitäten löst und abstrakte Stereotype erzeugt. Marx zielte nicht auf antisemitische Hetze; er kritisierte das System des Geldes und des Privateigentums. Doch die Gleichsetzung von „Judentum“ und Kapitalismus, auch wenn sie metaphorisch gemeint war, öffnete späteren Missdeutungen Tür und Tor. Moderne Lektüren müssen deshalb beides tun: die Kritik am Kapitalismus ernst nehmen und zugleich die problematischen Begriffe historisch einordnen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Gerade diese doppelte Perspektive macht Zur Judenfrage zu einem wichtigen Text: Er zeigt, wie eng Sprache, Geschichte und Philosophie miteinander verflochten sind. Wer ihn heute liest, begegnet einem Werk, das einerseits radikale Fragen nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit stellt, andererseits aber auch die Grenzen seiner eigenen Epoche spiegelt. Vielleicht liegt genau darin sein Wert: Er zwingt uns, über die Bedingungen wirklicher Emanzipation nachzudenken – und zugleich kritisch zu prüfen, wie Begriffe und Ideen in unterschiedlichen Zeiten wirken können.
In einer Welt, in der ökonomische Ungleichheit, religiöse Spannungen und politische Krisen erneut zunehmen, kann die Lektüre von Marx’ Zur Judenfrage uns lehren, dass wahre Freiheit mehr bedeutet als Gesetze und Rechte. Sie erfordert auch die Veränderung jener Strukturen, die Menschen in Armut, Abhängigkeit oder Ausgrenzung halten. Aber sie lehrt ebenso, dass wir wachsam sein müssen, wie wir über „die Anderen“ sprechen – denn Worte schaffen Wirklichkeiten, und aus Ideen können Ideologien werden.
~
Karl Marx
Zur Judenfrage
Geschrieben August bis Dezember 1843.
Bruno Bauer: "Die Judenfrage". Braunschweig 1843.
Bruno Bauer: "Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden". "Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz". Herausgegeben von Georg Herwegh. Zürich und Winterthur, 1843, 5.56-71.
I. Bruno Bauer: Die Judenfrage. Braunschweig 1843
Die deutschen Juden begehren die Emanzipation. Welche Emanzipation begehren sie? Die staatsbürgerliche, die politische Emanzipation.
Bruno Bauer antwortet ihnen: Niemand in Deutschland ist politisch emanzipiert. Wir selbst sind unfrei. Wie sollen wir euch befreien? Ihr Juden seid Egoisten, wenn ihr eine besondere Emanzipation für euch als Juden verlangt. Ihr müßtet als Deutsche an der politischen Emanzipation Deutschlands, als Menschen an der menschlichen Emanzipation arbeiten und die besondere Art eures Drucks und eurer Schmach nicht als Ausnahme von der Regel, sondern vielmehr als Bestätigung der Regel empfinden.
Oder verlangen die Juden Gleichstellung mit den christlichen Untertanen? So erkennen sie den christlichen Staat als berechtigt an, so erkennen sie das Regiment der allgemeinen Unterjochung an. Warum mißfällt ihnen ihr spezielles Joch, wenn ihnen das allgemeine Joch gefällt! Warum soll der Deutsche sich für die Befreiung des Juden interessieren, wenn der Jude sich nicht für die Befreiung des Deutschen interessiert?
Der christliche Staat kennt nur Privilegien. Der Jude besitzt in ihm das Privilegium, Jude zu sein. Er hat als Jude Rechte, welche die Christen nicht haben. Warum begehrt er Rechte, welche er nicht hat und welche die Christen genießen!
Wenn der Jude vom christlichen Staat emanzipiert sein will, so verlangt er, daß der christliche Staat sein religiöses Vorurteil aufgebe. Gibt er, der Jude, sein religiöses Vorurteil auf? Hat er also das Recht, von einem andern diese Abdankung der Religion zu verlangen?
Der christliche Staat kann seinem Wesen nach den Juden nicht emanzipieren; aber, setzt Bauer hinzu, der Jude kann seinem Wesen nach nicht emanzipiert werden. Solange der Staat christlich und der Jude jüdisch ist, sind beide ebensowenig fähig, die Emanzipation zu verleihen als zu empfangen.