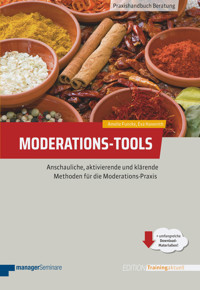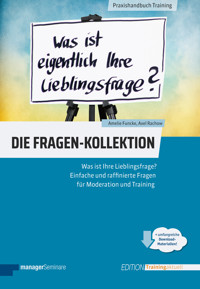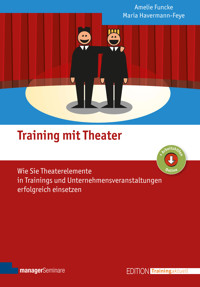Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Bildung
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
In dieser Sammlung erhalten Trainer, Moderatorinnen, Berater, Dozentinnen, Lehrer und Supervisorinnen einen Fundus von 49 anregenden Übungen sowie 23 impulsgebende Geschichten zur Arbeit an Themen wie Haltungen, Werte, Kulturen. Die Methoden unterstützen dabei, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Zuschreibungen und Vorurteile zu erkennen und mit ihnen umzugehen.
Vielen der dargestellten Präsenzmethoden haben die Autorinnen eine prägnant beschriebene virtuelle Variante an die Seite gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amelie Funcke, Gabriele Braemer
Zusammen finden
Diversity – Methoden für Menschen in Gruppen und Teams, die Vielfalt erleben
managerSeminare Verlags GmbH, Edition Training aktuell
Amelie Funcke, Gabriele Braemer
Zusammen finden
Diversity –
Methoden für Menschen in Gruppen und Teams, die Vielfalt erleben
© 2022 managerSeminare Verlags GmbH
2. Aufl. 2024
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-977910
www.managerseminare.de
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
ISBN 978-3-98856-281-4
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Ralf Muskatewitz
Cover: Adobe stock: Ashley van Dyck
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-RessourcenBegleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die persönliche Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie können die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.www.managerseminare.de/tmdl/b,282030
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Einführung
I.Selbstreflexion initiieren
Methoden und Übungen
Die Gehaltserhöhung
Die Macht der Gewohnheit
Finde den Stein
In einem anderen Leben
Ist das wahr?
John
Neue Wege gehen
Power Flower
The Work
Geschichten, Witze, Anekdoten
Eine Katze muss angebunden sein
Grab nicht woanders, grab bei dir
Der eifrige Novize
II.Zuschreibungen, Stereotype, Vorurteile betrachten und ihnen begegnen
Methoden und Übungen
Bespiegeln
Die Albatros-Kultur
Die Chinesen sind
Im Blick der anderen
Paravent der Wahrheit
Typisch
Unter feinen Leuten
Geschichten, Witze, Anekdoten
Sabotage zwischen Himmel und Hölle
Die Frau, die sich beim Zirkus bewarb
Das Ende der Fahnenstange
Ein Mann hängt in der Luft
Frauen und Technik
III.Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken und damit umgehen
Methoden und Übungen
Barnga
Das Pillendilemma
Die Derdianer
Diversity-Bingo
Drehen und wenden
Ganz schön Schaf
Passt – passt nicht
Resonanz
Same same and different
Treffer versenkt
Geschichten, Witze, Anekdoten
Ossi und Wessi
Voltaire und die Engländer
Der erste Esel
IV.Verstehen und Verständigung unterstützen
Methoden und Übungen
4711
Alle meinen es gut
Ausgegrenzt
Chatter
Ein tierisches Vergnügen
Erkläre mir die Natur
In fremden Mokassins
Mit Mann und Maus
Offen oder geschlossen
Stretch
Überleben in der Wüste
Was wie stört
Geschichten, Witze, Anekdoten
Alles klar!
Der indische Programmierer
Ganz schön clever!
Die große Flut
Der Leuchtturm
Komplexe Welt
Wie ein Krieg entsteht
V.Das Zusammenfinden fördern
Methoden und Übungen
Berufliche Wanderkarte
Blind einem Ort begegnen
Boundary Spanning Leadership
Cynefin LEGO®-Spiel
Fantastisches Team
Irritiert
Länderverständigung
Lebenseinsichten
Lösungsraum Natur
Shall I call you?
Wer wir sind
Geschichten, Witze, Anekdoten
Studium mit Hindernissen
Kommt ein Skelett zum Arzt
Drama auf dem Eis
Der findige Autor
Von Giraffen und Elefanten
Service
Schnellfinder Übungen
Schnellfinder Geschichten, Witze, Anekdoten
Literaturempfehlungen
Stichwortverzeichnis
Download-Ressourcen – Link im Impressum
Die Gehaltserhöhung
Aufgabenblätter und Lösungen
Ist das wahr?
Arbeitsblatt Behauptungen
John
Kurzgeschichte „John“ mit Auflösung
Power Flower
Abbildungen der Power Flower
Arbeitsblatt mit Leitfragen
Die Chinesen sind …
Beitrag „Völkerverständigung“
Barnga
Barnga Spielanleitung
Die Derdianer
Unterstützungsblatt für die Moderatorin
Anweisungen für Derdianer, Ingenieure, Beobachter
Diversity-Bingo
Bingo-Spielkarte
Bingo-Lösungskarte
Abbildung: Vier Ebenen der Diversität
Same same and different
Kategorien für Trennendes und Leitfragen für Gemeinsamkeiten
Ein tierisches Vergnügen
Beobachtungsbogen
Überleben in der Wüste
Teilnehmeranleitung
Traineranleitung mit Lösungsweg
Boundary Spanning Leadership
Modellerläuterung + Workshop-Design
Zwei Fallbeispiele
Cynefin Lego-Spiel
Zusatzinformation Cynefin Framework
Länderverständigung
Beobachtungsfragen
Shall I call you?
Vier-Ebenen-Modell der Diversität
5 Fallstudien für Teilnehmende
5 Fallstudien für Trainer
Einführung
Diversity heißt Vielfalt
… und mit Vielfalt haben wir in Seminaren und Workshops immer zu tun. Der Erfolg derselben macht sich auch daran fest, wie gut es gelingt, mit ihr umzugehen. In Köln sagt man „Jeder Jeck is anders“ – und stellt damit klar, dass das nicht nur so ist, sondern auch so sein darf. Wenn es nicht nur beim Spruch bleibt, sondern eine Haltung dahintersteht, dann kann der Vielfalt statt mit zurückhaltender Skepsis mit Neugierde und Wohlwollen begegnet werden. Das Bunte und Lebendige daran, die Chancen und Möglichkeiten werden sichtbar und können genutzt werden.
Wie kam es zu diesem Buch?
Die Idee entstand im Zusammenhang und in der Folge unserer Methodensammlung „Ein Herz fürs Team“, die 2018 erschienen ist. Darin befindet sich ein (Unter-)Kapitel namens: „Kulturen thematisieren“, in dem wir einige Methoden dazu vorstellen.
Dieses Kapitel war unser Ansatzpunkt. Wir dachten, dass viel mehr möglich ist. So lässt sich einiges von Institutionen lernen, die sonst im Business-Kontext wenig im Blick sind: insbesondere vom Non-Profit-Bereich mit seinen Bildungsveranstaltungen. Hier, z.B. in der interkulturellen (Jugend-)Bildungsarbeit, der Entwicklungshilfe, der politischen Bildungsarbeit, entwickelt und nutzt man schon sehr lange lebendige, aktivierende Methoden mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen. Erfahrungsorientierte Vorgehensweisen haben eine lange Tradition. Und auch an den Universitäten beschäftigt man sich mit dem Thema und geht mit Leitfäden und Trainings praxisnah an die Sache heran.
Viele Methoden, so dachten wir, die ja eigentlich in einen anderen Kontext gehören, können für die hier besprochenen Zwecke in angepasster Form adaptiert werden. Wir haben uns also den Themenbereich noch mal vorgenommen, mit der Lupe betrachtet, erweitert und aufgefächert.
Die Leitfrage war: Worum genau geht es eigentlich, wenn Menschen unterschiedlicher „Herkunft“ im weitesten Sinn (sei es Nationalität, Kultur, Geschlecht, Unternehmen, Abteilung, Persönlichkeit …) gut miteinander arbeiten wollen?
Der Begriff „Herkunft“ wird gern schon mal gleichbedeutend mit „Kultur“ verwendet. Wobei ja Kultur nicht nur die Herkunft beschreibt. Es gibt vielfältige Definitionen für den Kulturbegriff; eine schöne ist beispielsweise diese:
„Ein Fisch entdeckt seine Abhängigkeit vom Wasser erst, wenn er sich auf dem Trockenen befindet …“ – Unsere eigene Kultur ist wie das Wasser für den Fisch. Sie ist Lebenselement (…).
Oder nach Doppler (2019): „Kultur ist …
– die Summe der Überzeugungen, die eine Gruppe, ein Volk oder eine Gemeinschaft im Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat, um mit den Problemen der internen Integration (Zusammenhalt) sowie der externen Anpassung (Überleben) fertig zu werden,
– die Summe der Regeln (Dos und Don‘ts), die so gut funktionieren, dass sie zu ‚ungeschriebenen Gesetzen‘ werden und jeder nachfolgenden Generation als die ‚richtige‘ Art des Denkens, Fühlens und Handelns weitergegeben werden.“
Für uns bezeichnet Kultur kurz gefasst die „Art und Weise, wie Menschen leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen. Dabei hat Kultur auch damit zu tun, welche Erfahrungen Menschen gemacht haben und was sie aus diesen Erfahrungen für sich ableiten.“ (Maletzke 1996)
Zurück zur oben stehenden Leitfrage. Auf ihrer Basis sind unsere Kapitel entstanden:
Selbstreflexion initiieren
Zuschreibungen, Vorurteile, Stereotype betrachten und ihnen begegnen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken und damit umgehen
Verstehen und Verständigen unterstützen
Das Zusammenfinden fördern
Nun galt es, die Themenbereiche mit Methodenideen zu füllen. Eine wertvolle Unterstützung waren uns dabei die Kolleginnen Cathrin Germing und Silke von Hoffmann (S. 15), die beide auf interkulturelle Themen spezialisiert sind.
Das Zuordnen der Methoden fiel mal leichter, mal taten wir uns schwerer. Schwierig war es deshalb, weil manche Methoden entweder schon so, wie sie sind, oder aber durch kleine Anpassungen auch in anderen Kapiteln Sinn ergeben. Ab Seite 308 gibt es eine Tabelle, in der du dazu jeweils noch einen weiteren Vorschlag findest. Allerdings sind das ja nur unsere Fantasien. Du hast bestimmt noch andere! Nutze sie! Auch das ist Vielfalt …
Der Zoom-Boom: Zu den virtuellen Beschreibungen
Es war ursprünglich anders gedacht – jedoch wie viele andere auch, mussten wir unsere Pläne ändern. Weil uns mitten in unserer Arbeit am Buch die Corona-Pandemie überrollte und alles andere überlagerte, fragten wir uns, ob es überhaupt gerade klug ist, ein Buch zu schreiben, das auf Präsenzmethodik baut. Denn an diesem beispiellosen „Zoom-Boom“ kam ja niemand mehr vorbei, das war nicht zu ignorieren. Wollten wir wirklich ewig Gestrige sein und das Buch so schreiben, als sei weiter nichts gewesen? Nein, wollten wir nicht. Wir wollten aber auch noch nicht die Zuversicht aufgeben, dass wir unser altes, analoges Berufsleben wiederbekommen – mit Menschen, „so richtig in echt“. So entschieden wir, den Präsenzmethoden eine virtuelle Variante an die Seite zu stellen, dort, wo es uns möglich erschien. Die Übersicht ab Seite 308 gibt auch darüber Aufschluss.
Diese virtuellen Beschreibungen sind recht knapp gehalten, in Kurzform dargestellt. Zu sehr ins Detail wollten wir nicht gerne gehen, um uns nicht zu wiederholen – aber auch deshalb, weil sich die technischen Möglichkeiten rasant verändern und das Beschriebene schnell veralten lassen.
Witze, Anekdoten, Geschichten
Wir gewannen Spaß daran, dieser Methodensammlung auch eine Sammlung von Geschichten, Witzen und Anekdoten (Tabelle ab Seite 310) beizufügen, die für uns gut dazu passen. Denn viele beschäftigen sich humorvoll oder auch böse mit den in unserem Buch besprochenen Aspekten. Zumindest lassen sie sich so deuten. Sie als Impuls oder Medium zur Verdeutlichung einer Botschaft zu nutzen, hat Vorteile:
Sie verhelfen zur Distanz, denn die „Geschichten“ die erzählt werden, sind ja nicht die eigenen. Sie führen in eine andere (analogische) Welt.
Sie bringen auf den Punkt. Knapp erzählt, arbeiten sie das Wesentliche heraus.
Wenn sie witzig sind, kann man lachen, was sowieso schon schön ist und in angespannten Situationen viel Gutes bewirken kann.
Es ist zumindest anregend oder macht sogar Spaß, sie zu reflektieren und in Bezug auf die eigene Lage zu deuten.
Kurzgeschichten und Anekdoten mangelt es an Vielfalt
Bei der Recherche sind wir über etwas gestolpert, das uns vorher gar nicht so aufgefallen war: Die Figuren und Rollen vor allem in den kurzen Erzählungen, Gleichnissen, Weisheiten, Anekdoten, die wir gefunden haben, sind in erstaunlich hartnäckiger Weise männlich dominiert. Frauen und Mädchen tauchen so gut wie nicht auf. Das finden wir nicht nur völlig unnötig und lebensfremd, sondern in der Konsequenz auch verhängnisvoll für Mädchen und Frauen, weil ihnen damit weibliche Vorbilder und Identifikationsfiguren abhandenkommen. Als ob es für Frauen und von Frauen nichts zu lernen gibt.
Autorin A.F.: „Mich erinnert das an ein Erlebnis im Zusammenhang mit dem Schulwechsel meiner Tochter. Als ich mit der damals 10-Jährigen an einem Tag der Offenen Tür ein Kölner Gymnasium besichtigte, kamen wir auch ins obere Stockwerk, wo sich der Chemie- und Physikbereich befanden. Der Flur dort war dekoriert mit Bildern berühmter Chemiker und Physiker – alles Nobelpreisträger und alles weiße, alte (auch das noch!) Männer. Ich – die Ambitionen meiner Tochter im Sinn – fragte erstaunt einen Lehrer, wo denn die weiblichen Vorbilder seien. Er sagte tatsächlich: ‚Es gibt doch keine.‘ Da konnte ich sein Wissen über Nobelpreise, ausgerechnet in Chemie und Physik, sogar aus dem Stegreif etwas auffrischen. Er sagte dann noch, das sei aber keine Deutsche. Das fand ich kleinlich, zumal sich das Gymnasium sehr weltoffen gibt und den Namen eines berühmten Italieners trägt.“
Dies ist ein weiteres trauriges Beispiel, wie den Mädchen und den Jungen die Wissenschaftlerinnen als Vorbilder nicht nur fehlen, sondern sogar verschwiegen werden. Vielleicht trägt das ja auch zum allseits beklagten Desinteresse von Mädchen an MINT-Fächern bei. Habt Verständnis, liebe männliche Kollegen, für diesen Gedankenausflug in Sachen Frauen und Mädchen – wir denken, ihr versteht, und viele von euch haben sicher auch Töchter …
Zurück zu den Geschichten: Wir wollten also den Männerberg etwas abtragen – und haben uns deshalb erlaubt, hier und da ein wenig zu verändern und so etwas zum Ausgleich und zur Lebenswirklichkeit beizutragen. Die Verfasser mögen uns verzeihen …
Gender und (An-)Sprache
Und schon sind wir beim Thema „Gendern“ und dem Sprachgebrauch in diesem Buch. Wir mögen es, wenn Sprache „fließt“ und wollen nicht gerne immer wieder über umständliche Formulierungen stolpern. Wir wissen aber auch, dass Sprache die Bilder, die im Kopf entstehen, und damit die Sichtbarkeit der Geschlechter mitbestimmen. Wenn jemand sagt „Wir warten noch auf den Moderator“, wird sich kaum jemand eine Frau vorstellen.
Mit unseren Formulierungen wollen wir mit dafür Sorge tragen, dass die Geschlechter möglichst gleichermaßen gesehen werden. Für uns hat sich ein Verfahren schon bewährt: Wir mischen einfach lustig weibliche und männliche Formen durcheinander – alle sind dann jeweils mitgemeint. Das ist sicher nicht ideal und wird auch nicht allen und allem gerecht, wenn wir verfolgen, was im Moment zum Thema gerechte Sprache alles diskutiert wird. Es ist im Moment unsere Lösung – wohl wissend, dass es nur eine Lösung für den Moment ist.
Erstmals haben wir übrigens auch diskutiert, ob wir, wenn wir euch hier im Buch ansprechen, duzen oder siezen. Das „du“ ist ja hier in Deutschland inzwischen nicht nur bei Ikea, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen angekommen und entwickelt sich zur gängigen Form bei der Ansprache auch fremder Personen.
Nach dieser Einleitung ist dann Schluss mit dem Duzen. In den Methodenbeschreibungen sind wir weitgehend beim „Sie“ geblieben. Wer das befremdlich findet, möge sich geduzt fühlen. :)
Wir wünschen euch viel Vergnügen mit dem Buch und seinen Methoden und Geschichten!
Gabi Braemer und Amelie Funcke
Letzte Hinweise, bevor es losgeht
Quellen der Methoden und Geschichten
Wir haben uns bemüht, Quellen zu recherchieren. Möglicherweise ist uns dabei aber etwas durchgegangen. Für diesen Fall bitten wir um Entschuldigung.
Zeitangaben und Gruppengrößen
Bei Zeitangaben und Empfehlungen zu Gruppengrößen handelt es sich stets um ungefähre Angaben, die häufig vom Kontext abhängen.
Download-Ressourcen
Immer, wenn nebenstehendes Symbol auftaucht, findest du weitere Infos, Arbeitsblätter oder sonstige nützliche Hilfestellungen in den Download-Ressourcen. Diese digitalen Zusatzangebote gehören zum Buch. Als Leserin oder Leser kannst du sie kostenfrei abrufen, wenn du den Link im Impressum nutzt und dich auf den Seiten einmalig registrierst.
Cathrin und Silke
Cathrin Germing und Silke von Hoffmann haben mit ihrem Methoden-Input maßgeblich zu diesem Buch beigetragen. Deshalb möchten wir die beiden hier kurz vorstellen:
Cathrin Germing beschäftigt sich seit Studienzeiten mit interkulturellen Themen, die sich variantenreich durch ihre berufliche Laufbahn ziehen. Die Diplompädagogin arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Lehrkraft für besondere Aufgaben vor allem an den Universitäten Münster und Duisburg-Essen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Theologie begleitete sie ein internationales Projekt für interreligiöses Lernen. Auch freiberuflich sensibilisiert sie für interkulturelle Themen, z.B. in der Lehrerbildung, an der Hochschule für Polizei und Verwaltung, an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Die Ausbilderin und Beraterin für personzentrierte Gesprächsführung arbeitet als Gutachterin für den Gütesiegelverbund Weiterbildung und ist Mitglied des Vorstands der GWG. Darüber hinaus ist sie passionierte Drachenfliegerin. Ihr Herz schlägt für „Kiten und Reiten“.
Mail: [email protected]
Silke von Hoffmann ist zertifizierte Trainerin im Businessbereich mit Ausbildung zur interkulturellen Trainerin. Sie lebte in Portugal, Brasilien und Mexiko und hat dort ihre Leidenschaft für die Entwicklung und Entfaltung von Menschen und Potenzialen entdeckt. Ihre Schwerpunkte sind Kommunikation, Zeit- und Selbstmanagement sowie die interkulturelle Kompetenz. Dabei ist sie u.a. durch ihre Erfahrungen als Managerin eines kleinen Familienunternehmens und die mehrjährigen Auslandsaufenthalte sehr praxisorientiert, flexibel und offen. Sie arbeitet freiberuflich u.a. im Kölner Institut für Interkulturelle Kompetenz (KIIK) und bei der edutrainment company und ist Mitglied bei SIETAR. Die Dipl. Ing. für biomedizinische Technik und Mutter von vier Töchtern gibt in ihrer Freizeit zertifizierte Patchwork-Nähkurse, golft und segelt gerne.
Mail: [email protected]
Webseite: www.von-hoffmann.de
I.Selbstreflexion initiieren
Die Reflexion der eigenen Bedürfnisse, Vorlieben, Voraussetzungen, Denk- und Handlungsmuster etc. hilft nicht nur, unsere blinden Flecken zu beleuchten und uns selbst mit unseren Impulsen zu verstehen. Wahrnehmung und Einsicht sind auch die ersten, unumgänglichen Schritte, wenn wir etwas verändern wollen. Darüber hinaus hilft uns die Selbsterkenntnis, auch unser Urteil über andere bewusster zu reflektieren und zu relativieren.
Zu Einsichten zu gelangen, ist Arbeit, manchmal mühevoll, nicht immer angenehm, oftmals ein längerer Prozess. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn so manche Denk- und Handlungsmuster, die uns (unbewusst) begleiten, haben ja ebenfalls einen längeren Weg zurückgelegt, um sich bei uns zu verfestigen. Sehr schön bringt das diese Geschichte auf den Punkt:
Eine Katze muss angebunden sein
Eine Katze stört die Abendmeditation eines indischen Gurus im Tempel. Der Guru bindet sie daraufhin draußen an. Als der Guru stirbt, hält der Nachfolger daran fest, dass draußen eine Katze angebunden sein muss. Dann stirbt die Katze. Eine neue wird angeschafft. Gelehrte schreiben lange Aufsätze, warum eine angebundene Katze vor dem Tempel heilsnotwendig ist. Am Ende verschwindet sogar die Abendmediation – eine Katze aber bleibt angebunden.
(Christiane Woopen, Medizinethikerin, im Zeitinterview, ZEIT Nr. 5, 28. Jan. 2021, S. 33. Nach Peter Knauer, „Handlungsnetze“.)
Zur Selbstreflexion braucht es in erster Linie den Willen, dann aber auch den genauen Blick, das feine Ohr, das gute Gespür beim Hineinschauen, -horchen und -spüren in sich selbst. In Gruppen und Teams stellt der andere als Gegenüber mit Empathie und Feedback sicher, dass wir dabei nicht im eigenen Saft stecken bleiben. Es braucht ein gegenseitiges Aufeinandereinlassen. Der eine gibt, die andere nimmt und dann umgekehrt.
All das ist zu würdigen. Das „Gefundene“ dürfen wir durchaus als einen „Schatz“ betrachten – so wie es uns die folgende Geschichte lehrt:
Grab nicht bei anderen, grab bei dir!
Der Rabbi Eisik lebte in Krakau und träumte eines Nachts, er solle nach Prag wandern. Dort werde er unter der Karlsbrücke, die zum Schloss führt, einen Schatz finden. Dreimal träumte er das – und so wanderte er los. Aber in Prag an der Brücke standen ganz viele Wachposten, die den Übergang zum Schloss Tag und Nacht bewachten. Rabbi Eisik wagte es nicht, seine Schaufel zum Graben anzusetzen. Er ging nun jeden Tag zur Brücke und lungerte herum und überlegte, wo der Schatz wohl liegen könnte. Dem Hauptmann der Wache fiel der Rabbi auf und schließlich fragte der ihn: „Warum kommst du jeden Tag hierhin und lungerst hier herum?“ Da erzählte der Rabbi dem Hauptmann von seinem Traum. Der Hauptmann lachte aus vollem Hals und erwiderte: „Wo kämen wir denn hin, wenn wir Träumen trauen würden? Ich zum Beispiel träume nun schon wochenlang von einem armen Juden in Krakau. Ich soll nach Krakau wandern und unter dem Ofen in seiner Stube graben, dort würde ich einen Schatz finden …“
Rabbi Eisik lächelte, bedankte sich höflich bei dem Hauptmann und wanderte zurück nach Krakau. Dort angekommen, grub er schleunigst unter seinem Ofen und da lag der Schatz. Später, als der Rabbi ein berühmter Weiser des Chassidismus geworden war, pflegte er zu sagen: „Merke dir diese Geschichte. Grab nicht woanders, grab bei dir.“
(Aus der chassidischen Überlieferung des Ostjudentums)
Die Methoden und Übungen in diesem Kapitel
Die Gehaltserhöhung
Das eigene Wahrnehmungs- und Deutungsverhalten steht hier auf dem Prüfstand. Die Übung erschüttert die Annahme, dass man die „objektive“ Wahrheit kennt.
Die Macht der Gewohnheit
Hier sorgen die Betrachtungen der anderen für neue Perspektiven bzw. für ein Reframing der zur Diskussion gestellten Situation oder Verhaltensweise. Bringt Bewertungsgewohnheiten ins Wanken.
Finde den Stein
In Bezug auf Führung/Anleitung/Begleitung gewinnen Menschen Klarheit darüber, was ihnen guttut – und was sie eher befremdet und voneinander entfernt.
In einem anderen Leben
Realität und Fiktion begegnen und vermischen sich: Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn …? Erfolge und Misserfolge werden im Hinblick auf die Rahmenbedingungen untersucht, diese dann fiktiv verändert. Die Erkenntnisse schärfen das Bewusstsein für Chancen, Grenzen, Beschleuniger, Bremser … Nur für Gruppen mit vertrauensvollem Klima!
Ist das wahr?
Die Teilnehmenden finden Gründe für und gegen den Wahrheitsgehalt einer Behauptung. So eröffnet die Übung alternative Blickwinkel und mischt feste Denkmuster etwas auf. Im besten Fall erkennt jede Person, auf welchen Überzeugungen ihre Wahrnehmungen gründen und wie sich das auf ihr Verhalten auswirkt.
John
Die Methode zeigt uns, wie schnell sich aufgrund von Aussagen Bilder und Annahmen in unseren Köpfen entwickeln, die gerne gewohnten Mustern entsprechen.
Neue Wege gehen
Eine experimentelle Übung. Sie reflektiert die Frage: Was passiert (gedanklich, körperlich, emotional, …), wenn ich einen mir unbekannten Weg gehe – und was hat das damit zu tun, wie ich im Leben Neuem begegne?
Power Flower
Wo fühle ich mich bevorzugt? Wo eher schlechter gestellt? Anhand eigener Erfahrungen setzt sich die Gruppe mit Macht und Diskriminierung auseinander. Sie ruft sich Privilegien und Benachteiligungen ins Bewusstsein und entwickelt Handlungsoptionen.
The Work
Die Methode geht zurück auf Byron Katie. Durch die Fragen von „The Work“ werden belastende Gedanken genauer unter die Lupe genommen und um neue, veränderte Betrachtungen ergänzt.
Die Geschichten, Anekdoten und Witze
A. Aus dieser Einleitung
Eine Katze muss angebunden sein: Eine kurze Herleitung der Entstehung einer Gewohnheit.
Grab nicht bei anderen, grab bei dir! Ein Mann findet auf Umwegen seinen „Schatz“.
B. Weitere Geschichten
Der eifrige Novize: Lange studiert – und doch am Wesentlichen vorbei …?
Die Gehaltserhöhung
Eine Geschichte wird anhand verschiedener Behauptungen auf ihren „Wahrheitsgehalt“ überprüft
Anwendung und Wirkung
Diese Übung verdeutlicht auf einfache Weise, dass viele Spannungen in heterogenen Arbeitsgruppen darauf beruhen, dass alle Beteiligten für sich in Anspruch nehmen, die objektive Wahrheit gesehen, gehört oder gesagt zu haben. Dabei wird meist übersehen, dass „wirklich ist, was wirkt, nicht was ist“ (Lewin).
Bei dieser Übung überprüft die Gruppe nach Anhören einer kurzen Geschichte die anschließenden Feststellungen auf Richtig und Falsch – und in der Auflösung ihr eigenes Wahrnehmungs- und Deutungsverhalten. Die Erkenntnisse daraus lassen sich auf ihre Alltagssituationen, z.B. im Kontakt mit Schnittstellenpartnern, Kunden, Kollegen etc. übertragen und auswerten.
Vorgehen
Die Gruppe wird zu einem Experiment eingeladen. Dazu erhält jeder Teilnehmende (TN) ein DIN-A4-Blatt mit der beschriebenen Seite nach unten und der Bitte, es verdeckt zu lassen.
Die Moderatorin leitet an: „Ich lese Ihnen jetzt eine Geschichte vor und bitte Sie, aufmerksam zuzuhören.“
Die Geschichte:
Ein Vorgesetzter hatte einen Mitarbeiter nicht zur Gehaltserhöhung vorgeschlagen. Der Mitarbeiter reichte seine Kündigung ein. Das wurde von den Kollegen bedauert, denn er war allgemein beliebt. Es wurde darüber diskutiert, ob man etwas unternehmen solle.
Auswertung
Im ersten Schritt wird die Gruppe aufgefordert, das Blatt umzudrehen und die dort aufgelisteten Feststellungen nacheinander auf Richtig und Falsch einzuschätzen (Einzelarbeit – Fragen im Download).
Im zweiten Schritt bekommt jeder TN das Lösungsblatt (siehe Download) und vergleicht die eigenen Einschätzungen mit den objektiven Aussagen der Geschichte.
Anschließend reflektiert die Gruppe über ihre Beobachtungen, z.B. mit folgenden Fragen:
Was war mir in Erinnerung geblieben, und warum?
Worauf hatte ich geachtet? Und was hat das mit mir zu tun?
Welche Auswirkungen hatten meine Annahmen, z.B. auf mein Zuhörverhalten?
Wozu führt dies in Diskussionen?
Was macht sie effektiv? Was führt zu Schwierigkeiten?
Was ist der Schlüssel zu dieser Übung?
Transfer
Nach einem Austausch über Eindrücke und Beobachtungen können diese auf das Trainings-/Workshopthema bzw. die Alltagssituationen der TN übertragen werden:
Wo begegnet mir/uns Ähnliches im Alltagsleben?
Was habe ich daraus gelernt?
Was bedeutet dies für uns? Wie können wir damit umgehen?
Praxistipps
Nennen Sie der Gruppe die Aufgabe (Aussagen auf Wahrheitsgehalt überprüfen), erst nach Vorlesen der Geschichte. Ein unbelastetes Zuhören ist dann wahrscheinlicher.
Vertiefendes/Hintergrund
Phase: Als Einstieg in eine Themenbearbeitung
Situation: Wenn es darum geht, für die eigenen Wahrnehmungen und Deutungen, deren Hintergründe und Auswirkungen zu sensibilisieren
Technische Hinweise
Gruppierung: Ab 3 TN
Setting: Alle im Raum, in Einzelarbeit, anschließend Auswertung je nach Gruppengröße in Kleingruppen oder im Plenum
Medien und Material: Geschichte und DIN-A4-Blatt mit Aussagen und Lösungsblatt für die Moderatorin (siehe Download)
Dauer: 20-90 Minuten inkl. Auswertung im Plenum, je nach TN-Zahl und Intensität
Vorbereitung: Bögen mit Feststellungen zur Geschichte ausdrucken
Variationen
Sie können auch mit der Auflösung warten und die Gruppe eine Weile über Falsch und Richtig diskutieren lassen. Unter Umständen werden dadurch feste Annahmen der TN deutlich, die sich im Folgenden auswerten lassen.
Wählen Sie eine andere Geschichte (z.B. „Die Sekretärin“, siehe Download) oder erfinden Sie selbst eine.
Virtuelle Variante
Ablauf
Anmoderation für alle im Plenum.
Lesen Sie die Geschichte vor.
Laden Sie anschließend die Feststellungen zur Geschichte als Dokument im Chat für alle hoch. Formulieren Sie dann die Aufgabe (auf Richtig und Falsch überprüfen) mit Zeitvorgabe.
Die TN halten ihre Einschätzungen im Dokument für sich fest.
Anschließend tauschen sich alle in Kleingruppen in Teilgruppenräumen (mit Zeitvorgabe) über ihre Ergebnisse aus und diskutieren sie.
Nach Ablauf der Zeit werden im Plenum die Eindrücke gesammelt. Nennen Sie anschließend die Lösung und blenden dabei die Geschichte ein.
Regen Sie zur Reflexion über relevante Erkenntnisse der TN im Plenum an.
Wichtige Erkenntnisse der TN werden auf einem (vorbereiteten) Whiteboard oder einer leeren PowerPoint-Seite festgehalten.
Quelle
Leider nicht bekannt.
Downloads
Aufgabenblatt und Lösung zu „Die Gehaltserhöhung“
Aufgabenblatt und Lösung zu „Die Sekretärin“
Die Macht der Gewohnheit
Im Dialog Schubladen im eigenen Kopf bewusst machen und gewohnte Bewertungsmuster erweitern
Anwendung und Wirkung
Veränderungen (in der Organisation, im Team, im Privatleben) bringen es häufig mit sich, dass damit auch an der Komfortzone gerüttelt wird. Das Festhalten an gewohnten Zuschreibungen und Vorannahmen, die uns Sicherheit geben, führt dabei nicht selten zu zähen Dialogen, selbstschädigenden Entscheidungen und „mehr desselben“.
In dieser Übung erfahren die Teilnehmenden (TN), wie durch die Betrachtungsweisen ihrer Kollegen der eigene Blickwinkel erweitert, blockierende Einstellungen ans Licht gelockt und die eigenen Gedanken in neue, inspirierende Bahnen gelenkt werden können.
Vorgehen
Die Übung ist gut einsetzbar in Teamcoachings, Mentoren- oder Coaching-Ausbildungen – und immer dann, wenn es darum geht, sich festgefahrene Denkmuster ins Bewusstsein zu holen und damit Bewegung in die gegenseitige Verständigung zu bringen.
Bitten Sie die Gruppe, sich in Dreiergruppen (A, B, C) zusammenzuschließen und erläutern Sie die Aufgabe:
Schritt 1: Einzelarbeit
Jeder sammelt für sich einige persönliche Verhaltensweisen, Eigenschaften bzw. Lebensumstände, die ihm nicht gefallen. Beispiele: „Meine Wohnung ist zu klein, ich bin schnell aufbrausend, der Job ist nicht anspruchsvoll genug …“
Schritt 2: Austausch über alternative Deutungen
Eines der drei Gruppenmitglieder (A) liest einen Satz aus der eigenen Liste vor. Die anderen beiden (B, C) bringen abwechselnd alternative Betrachtungsweisen oder Vorteile ein, die sich ihrer Meinung nach aus der Situation ergeben (max. 5 Minuten). Die Ideen dürfen Spaß machen und müssen nicht immer ganz ernst gemeint sein.
Beispiel:
A: „Die Kollegin X nervt mich mit ihren langatmigen Berichten im Meeting.“
B: „Na Gott sei Dank, damit ist sie eine zuverlässige Informationsquelle!“
C: „Ja, und außerdem lernst du durch sie, dich in Geduld zu üben und aufmerksam zuzuhören.“
Schritt 3: Wirken lassen
Der erste TN (A) lässt die gehörten „Umdeutungen“ auf sich wirken und sagt, wenn er mag, mit welcher Äußerung er am meisten anfangen kann. Ansonsten erfolgt nach einem „Danke“ an die „Beratenden“ der Wechsel: Der zweite TN der Kleingruppe fährt fort usw.
Auswertung
Beispiele für Leitfragen im Plenum:
Was ist passiert?
Was ist mir aufgefallen?
Was hat mich irritiert, überrascht, gefreut, erleichtert?
Was haben die unterschiedlichen Vorstellungen im Kopf bewirkt?
Woher – im „wirklichen Leben“ – kennen wir Ähnliches und welche Vorgehensweise hat sich bewährt?
Praxistipps
Es kann für die TN hilfreich sein, noch einmal zu betonen, dass es nicht darum geht, Lösungen zu liefern. Eher soll die betroffene Person dabei unterstützt werden, sich die eigenen Gewohnheiten im Bewerten von Situationen, Eigenschaften etc. bewusst zu machen und darüber hinaus Beispiele bekommen, wie sie neu oder anders über ihre Situation denken und empfinden kann. Manchmal bringen die „Beratungen“ auch keinen „Durchbruch“ – dann reicht ein „Danke“ als Resonanz.
Vertiefendes/Hintergrund
Phase: Als Einstieg in Themen wie z.B. blockierende Glaubenssätze, Überzeugungen in Teamworkshops, Mentoren- und Coaching-Ausbildungen
Situation: Wenn es darum geht, gewohnte Denkmuster wahrzunehmen, zu überdenken und mit anderen Sichtweisen und Blickwinkeln zu experimentieren
Technische Hinweise
Gruppierung: Mindestens 3 Personen, ab 6 Personen Gruppe teilen Setting: In Dreiergruppen im Raum verteilt
Medien und Material: Keine
Dauer: 60 Minuten inkl. Auswertung
Vorbereitung: FC mit Arbeitsauftrag
Variationen
Bei kleineren Gruppen – und wenn die TN sich schon gut kennen und vertrauen – kann die jeweilige Person auch auf dem „heißen Stuhl“ Platz nehmen. Die übrigen sitzen um sie herum und bringen abwechselnd alternative Sichtweisen ein. Intensiv!
Paradoxe Vorschläge und Übertreibungen lösen mitunter – bei einer gleichzeitig wertschätzenden und respektvollen Beziehung zwischen den Gruppenmitgliedern – größeren Widerstand aus, und zwar in die richtige, weil eher befreiende Richtung. Die betroffene Person kann über sich selbst lachen, weil sie die Absurdität mancher Überzeugungen und Befürchtungen vor Augen geführt bekommt und sich verstanden fühlt. Anspruchsvoll!
Beispiel:
A: „Eigentlich sollte ich abnehmen und mehr Sport treiben …, aber das ist so anstrengend.“
B. „Auf gar keinen Fall sportliche Betätigung! Denn in deinem Alter solltest du mehr deine Gelenke schonen und ENDLICH die Freuden des Lebens genießen …“
C: „Ja, gutes Essen zum Beispiel …!“
Virtuelle Variante
Ablauf
Leiten Sie in die Übung ein und bitten Sie jeden TN, sich auf einem Notizzettel bestimmte Umstände, Verhaltensweisen o. Ä. aufzuschreiben, die ihm/ihr nicht gefallen (5 Minuten).
Die Gruppe teilt sich in Dreiergruppen auf (A, B, C), am besten durch Zufallsprinzip, und führt Gespräche (Zeitvorgabe 10-15 Minuten, 5 Minuten/Person).
Die Teilgruppen halten nach der Übung ihre drei wichtigsten Erkenntnisse auf einem Notizzettel oder einem Whiteboard fest (speichern nicht vergessen).
Anschließend kommen alle für eine gemeinsame Auswertung ins Plenum zurück.
Quelle
Leider nicht bekannt.
Finde den Stein
Eine Person anleiten, eine Aufgabe zu lösen und mit Herangehensweisen zu experimentieren
Anwendung und Wirkung
Eine interessante und sehr konzentrierte Übung, mit der jede einzelne Person aus zwei verschiedenen Perspektiven etwas über sich selbst erfahren kann.
Besonders eignet sie sich, wenn Menschen sich darüber austauschen wollen, welche Art und Weise der Anleitung (Führung, Unterstützung, Begleitung, Beratung, Coaching) ihnen entspricht und guttut, bzw. umgekehrt, welche sie eher befremdet. Themen wie Nähe und Distanz, Sicherheit und (Selbst-)Vertrauen, Freiheit, Bindung, Kontrolle tauchen zuverlässig auf und werden zum Gegenstand der Selbstreflexion und des anschließenden Gesprächs.
Vorgehen
Die Übung besteht aus zwei Phasen:
Phase 1: Aufgabe kennenlernen und ausprobieren
Dazu befindet sich die Gruppe an der Stirnseite eines großen, freigeräumten Raums. 5-6 Meter von den TN entfernt liegt ein Stein (etwa walnuss-/limonengroß) oder ein anderer Gegenstand. Aufgabe ist es, die Entfernung zum Stein zu taxieren, dann die Augen zu schließen, blind auf ihn zuzugehen und ihn aufzuheben.
Die erste Person beginnt. Sobald sie die Stelle erreicht, wo sie den Stein vermutet, bückt sie sich, um ihn zu greifen, dann öffnet sie die Augen. Hat sie den Stein verfehlt, was meist geschieht, betrachtet sie kurz seine Lage und räumt dann den Platz. Es startet jetzt das nächste Gruppenmitglied usw., bis alle einmal an der Reihe waren.
Phase 2: Experimentieren: Den Stein finden mit Anleitung
Es werden Paare (A+B) gebildet, die sich einen möglichst ungestörten Platz im Raum oder im Haus suchen. Aufgabe ist nun, die Übung zu wiederholen – allerdings soll nun Person A die blinde Person B zum Stein geleiten – und dabei mit mehreren verschiedenen „Anleitungsstilen“ experimentieren.
Dazu überlegen A+B sich zunächst gemeinsam, welche Herangehensweisen sie ausprobieren möchten. Nicht Extreme, sondern vielmehr Feinheiten sollen dabei im Fokus stehen, z.B. etwas mehr oder weniger Kontakt, freier oder direktiver, fordernder oder abwartender, auf Sicherheit bedacht oder vertrauend, offensiv oder selbst entdecken lassen usw. Die Paare probieren mehrere Varianten aus, spüren nach und reflektieren für sich und danach gemeinsam, wie sie die einzelnen Sequenzen empfunden haben. Anschließend werden die Rollen gewechselt.
Auswertung
Dazu kommt man wieder im Plenum zusammen. Dort überträgt jede Person die Erfahrungen aus der Übung auf das „richtige Leben“ und hält für sich persönlich fest:
Rolle A (Anleitung): Welche Herangehensweise entspricht mir, welche überhaupt nicht? Was bedeutet das für Situationen, in denen ich andere begleite (führe, coache, berate)?
Rolle B (Blinde): Welcher Anleitungsstil tat mir persönlich gut? Welcher war mir unangenehm? Wie möchte ich geführt (begleitet, gecoacht, beraten) werden?
In einer Gesprächsrunde werden nun die Erfahrungen und Erkenntnisse ausgetauscht und abschließend erarbeitet, was getan werden kann, wenn zwei Personen A+B mit sehr unterschiedlichen „Vorlieben“ aufeinandertreffen.
Praxistipps
Die Raumwahrnehmung kann bei geschlossenen Augen erheblich abweichen.
Bei größeren Gruppen und entsprechend Platz können 3-5 Personen Phase 1 der Übung parallel ausführen. Allerdings braucht dann jede Person ihren eigenen Gegenstand und freie Bahn. Sonst gibt es unangenehme Zusammenstöße.
Die Übung lässt sich auch gut im Freien durchführen.
Vertiefendes/Hintergrund
Phase: Zu Beginn eines Austauschs über individuelle Wünsche und Bedürfnisse zum Thema Führung/Begleitung
Situation: Wenn eine symbolische Erfahrung für die (Selbst-)Reflexion in einer Fragestellung förderlich ist
Technische Hinweise
Gruppierung: 4-40 Personen
Setting: Plenum und Kleingruppen
Medien und Material: Pro Kleingruppe ein Stein oder ein anderer Gegenstand
Dauer: Je nach Gruppengröße und gewünschter Tiefe: 45-90 Minuten Vorbereitung: Keine
Variationen
In Phase 2 können auch Dreiergruppen gebildet werden. Die jeweils dritte Person beobachtet.
Quelle
In ähnlicher Form beschrieben in Funcke, A. (2020): Spielend lernen. Haufe Taschenguide.
In einem anderen Leben
Sich andere Lebensszenarien vorstellen und die Auswirkungen daraus auf Erfolg und Misserfolg im Leben erforschen
Anwendung und Wirkung
Menschen lernen (lt. Thiagi) nicht zwingend aus Erfahrungen. Sie können jedoch durchaus neue Erkenntnisse gewinnen, indem sie ihre Erfahrungen reflektieren; beispielsweise durch reale Ereignisse (z.B. ausgeschlossen sein) oder simulierte (z.B. nach einem Rollenspiel). Dies soll mit der folgenden Übung ermöglicht werden.
Die Gruppe untersucht grundlegende kulturelle Unterschiede zwischen den Gruppenmitgliedern und findet heraus, welche persönlichen Bedürfnisse und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen über Erfolg und Misserfolg mitentscheiden. Die Teilnehmenden (TN) entwickeln fantasievolle Geschichten, indem sie sich wesentliche Erfolge und Misserfolge aus ihrem privaten und beruflichen Leben vor Augen führen, dann die Charaktere und Lebensumstände ihrer Geschichte verändern und anschließend die Auswirkungen daraus erforschen. Autobiografisches Denken und kulturelle Empathie gehen dabei Hand in Hand.
Die Erkenntnisse daraus können auf die Situation innerhalb des eigenen Teams und/oder der Organisation übertragen werden. So lässt sich auch darüber reflektieren, wie sich gewohnte Denkmuster zugunsten eines erfolgreichen Lebens sowie gleichwertigen Zusammenwirkens verändern lassen.
Vorgehen
Schritt 1: Visualisierung
Bitten Sie die TN, an die Erfolge/Misserfolge in ihrem privaten und beruflichen Leben zu denken (10-15 Minuten): „Erinnern Sie sich zunächst an Ihre Erfolge wahlweise im Privat- oder Berufsleben. Tragen Sie dann drei Dinge zusammen, die Sie erreicht haben und auf die Sie stolz sind. Wiederholen Sie dies anschließend mit Ihren Misserfolgen: Halten Sie drei Dinge fest, die Sie gern vermieden hätten.“
Schritt 2: Karten ziehen
Lassen Sie anschließend jeden TN eine Spiel- oder Bildkarte ziehen und erläutern Sie die folgende Aufgabe, etwa so: „Sie entwickeln gleich eine Science-Fiction-Geschichte, in der Sie selbst die Hauptperson sind. Denken Sie darüber nach, inwieweit Ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn Sie in einem anderen Universum geboren wären. Auf Ihrem Planeten ist alles exakt wie auf der Erde. Sie sind der gleiche Mensch, bis auf einen Unterschied.“
Erklären Sie die Unterschiede anhand der Karten: „Wenn Sie Pik/Schnecke/… gezogen haben, ist Ihr Geschlecht ein anderes. Wenn Sie jetzt ein Mann sind, sind Sie in Ihrem anderen Leben eine Frau. Und umgekehrt. Ansonsten bleibt alles gleich.
Wenn Sie Herz/Bild X/ … gezogen haben, sind Ihre Gesundheit und Ihre körperlichen Fähigkeiten anders. Sie sind von frühester Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen. Ansonsten bleibt alles gleich.
Wenn Sie Karo/Bild Y/ … gezogen haben, haben Sie eine andere sexuelle Orientierung. Wenn Sie heterosexuell sind, sind Sie in Ihrem anderen Leben homosexuell oder lesbisch. Wenn Sie homosexuell sind, dann sind Sie in Ihrem anderen Leben heterosexuell. Ansonsten bleibt alles gleich.
Wenn Sie Kreuz/Bild Z/ … gezogen haben, ändert sich Ihre ethnische Zugehörigkeit. Wenn Sie weiß sind, gehören Sie in Ihrem anderen Leben einer anderen Nationalität an und sind schwarz. Ansonsten bleibt alles gleich.“
Weitere mögliche Kriterien: Ausbildung (Studium/Handwerk) – Alter – Religion/Glaubensrichtung – Staatsform (Demokratie, Diktatur, …) – selbstständig/angestellt – Arbeitgeber/Arbeitnehmer o. Ä.
Sollten Ihnen (z.B. aufgrund der Gruppengröße) die Symbole oder die Veränderungsaspekte ausgehen, können Sie auch für mehrere Personen das gleiche Symbol bereitlegen. Das kann spannend werden …
Schritt 3: Was wäre, wenn …?
Starten Sie nun Ihre Fantasiereise. Fordern Sie die TN auf, sich 10 Minuten Zeit zu nehmen und zu spekulieren, inwieweit ihr Leben durch die Veränderung in der anderen Welt anders wäre. Bitten Sie sie, dabei an die vorher visualisierten Erfolge und Misserfolge zu denken (bei Bedarf können die Augen zur Entspannung geschlossen werden): „Führen Sie sich vor Augen, wie sich der Unterschied auf die Ereignisse ausgewirkt hätte. Zum Beispiel:
Inwieweit wäre Ihr Leben dadurch einfacher oder schwieriger gewesen?
Welche Veränderungen in Ihrem Privat- und Berufsleben würden Sie erwarten?
Was davon wäre für Sie erstrebenswert? Was weniger?“
Schritt 4: Austausch
Nach Ablauf der Zeit bitten Sie um einige Beispiele aus der Gruppe. Ist die Gruppe größer, kann der erste Austausch auch in Kleingruppen erfolgen.
Beispiel einer Teilnehmerin: „Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich, als Erstgeborene, die Firma meines Vaters übernommen. Ich wäre schon früh von meinem Vater darauf vorbereitet worden und hätte zusätzliche Stärken ausgebildet, z.B. pragmatisch sein (die Kirche im Dorf lassen), strategisch denken, transparent führen und Leute fair behandeln – weil das als Firmenlenker dann wichtig wäre. Ich hätte auch mit finanziellen Durststrecken, Umsatzeinbrüchen und möglichen Entlassungen klarkommen müssen. Das wäre hart; es würde viel Veränderung und Leid erzeugen und mich sehr belasten, da mir z.B. Sicherheit und vertrauensvolle Beziehungen, wie in einer Familie, wichtig sind. Dann würde ich auch weniger Zeit mit meiner eigenen Familie, meiner Frau und meinen Kindern, verbringen können … Ich hätte permanent ein schlechtes Gewissen. Andererseits würde ich etwas schaffen, Menschen Arbeitsplätze geben, Werte schaffen für meine Kinder und Arbeitsplätze für die Menschen, die zu uns kommen, was mich mit Stolz erfüllen würde.“
Auswertung
Schritt 5: Reflexion/Auswertung
Wie war die Übung für Sie? Angenehm? Unangenehm?
Welche Phasen der Übung haben bei Ihnen Unbehagen hervorgerufen? Welche haben Sie positiv erlebt?