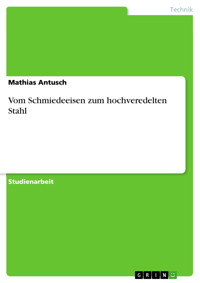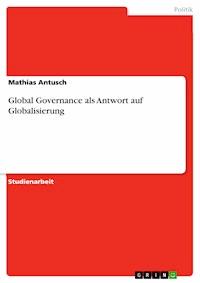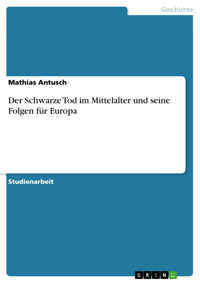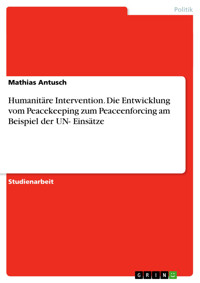36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Note: 1,0, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Institut für Geschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der Arbeit ist die sachliche und möglichst objektive Aufarbeitung des Zwangsarbeitereinsatzes im Stahlwerk Gröditz während des Zweiten Weltkrieges anhand der neuesten Literatur und noch nicht erschlossenem Archivgut. Dafür wurden die Daten der Bilanzen des Stahlwerkes Gröditz ausgewertet, in mehreren Anlagen zusammengefasst und zum Teil grafisch dargestellt. Zusätzlich verschaffen einige Karten, Lagepläne und Fotografien dem nicht ortskundigen Leser einen Eindruck über die Region um den Ort des Geschehens. Des Weiteren werden die Aussagen der Opfer und der Täter gegenüber gestellt und anhand der noch vorhandenen Unterlagen geprüft. Die Arbeit soll zeigen, dass trotz des geringen Umfangs des erhaltenen Archivmaterials eindeutige Aussagen über den Zwangsarbeitereinsatz des Stahlwerkes Gröditz möglich sind. Abschließend wird noch einmal der sowohl regionale, als auch unternehmensbezogene Charakter der vorliegenden Studie betont.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Zwangsarbeit im Stahlwerk Gröditz
Begin: 01.02.2004 Abgabe: 28.07.2004
Vorgelegt von: Mathias Antusch
Page 4
- 4 -1. EINLEITUNG
Der menschenverachtende Einsatz von Zwangsarbeitern zur Finanzierung und Aufrechterhaltung des Krieges, stellt eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte dar. Auf dem Höhepunkt der Rüstungsproduktion im Juli 1944 betrug der Anteil ausländischer Zivilarbeiter an den Arbeitern und Angestellten im Deutschen Reich über ein Viertel. Insgesamt sind etwa acht Millionen Menschen, darunter knapp zwei Millionen Kriegsgefangene und 400.000 KZ- Häftlinge, zur Arbeit in deutschen Fabriken gezwungen worden.1
Auch fast 60 Jahre nach Ende der NS-Diktatur ist diese Epoche noch nicht endgültig aufgearbeitet. Die Tatsache, dass die meisten der Opfer bisher keine Entschädigung für ihre Sklavenarbeit erhalten haben, drang erst Ende der neunziger Jahre auf massiven Druck der Opferanwälte an die deutsche Öffentlichkeit. Es begann ein beschämender Verhandlungsprozess, verschleppt von den großen Konzernen, behindert durch Bürokratie und Verwaltung. Am Ende dieser Entwicklung stand die Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, dotiert mit damals 10 Milliarden DM, zur einen Hälfte durch die Bundesregierung, zur anderen Hälfte durch die Wirtschaft finanziert. Im Sommer 2001 konnten erstmals bescheidene Entschädigungen an einen kleinen Teil der Opfer ausgezahlt werden. Für die meist hochbetagten Geschädigten nur ein kleiner Trost, denn das Geld kann die psychischen und physischen Leiden der ehemaligen Zwangsarbeiter auch nicht heilen.
Auch in Bezug auf die historische Erforschung ist das Thema Zwangsarbeit noch lange nicht vollständig aufgearbeitet, obwohl gerade in den letzten zwei Jahrzehnten die entsprechende Literatur immer umfangreicher geworden ist. Den Anfang der neueren Darstellungen bildet Ulrich Herberts fundamentales Werk „Fremdarbeiter“, das in erster Auflage 1985 erschien.2Das Standardwerk behandelt allerdings nicht den Einsatz von KZ-Häftlingen. Einen seriösen Überblick über die neueste Literatur bietet das im Jahre 2001 aufgelegte Werk „Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz“3von Mark Spoerer. In diesem sind die bekannten Ergebnisse der neueren Forschung zusammengefasst und weitere
1Spoerer, Mark:Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und
Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945. München 2001.
2Herbert, Ulrich:Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer- Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft
des Dritten Reiches. Berlin 1985; vgl. auch die neuere Darstellung:Herbert, Ulrich:Europa und der
„Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene u. KZ-Häftlinge in Deutschland 1938 -
1945. Essen 1991.
3Spoerer, Mark(2001)
Page 5
- 5 -Untersuchungsgebieteaufgezeigt. Mit dem Einsatz von KZ- Häftlingen beschäftigen sich vor allem Karin Orth (1999), Herbert/Orth/Diekmann (1998) und Ulrike Winkler (2000), diese mit aktuellem Bezug auf die Entschädigungsdebatte.4Mark Spoerer analysiert außerdem in einem Artikel für die Historische Zeitung ausführlich den wirtschaftlichen Aspekt des Häftlingseinsatzes.5Gabriele Lofti geht in ihrem Werk „KZ der Gestapo“6speziell auf die Insassen von Arbeitserziehungslagern ein. Den Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen thematisieren außer Ulrich Herbert in seinem oben erwähnten Standardwerk auch Christian Streit (1997), Pavel Polian (2001) und Otto Reinhard (1998).7Aber nicht nur die neuere, sondern auch die Nachkriegsliteratur ist für die Bearbeitung der Thematik aus heutiger Sicht wichtig. Bei der Interpretation sind jedoch die jeweiligen ideologischen Sichtweisen zu beachten. Die DDR- Historiker Dietrich Eichholz und Eva Seeber beschreiben in ihren Werken den Einsatz von Zwangsarbeitern, jedoch stark auf die marxistisch-leninistischen Kernthesen zugeschnitten.8Das Profitstreben und die führende Rolle des deutschen Großkapitals bei den Verbrechen des Dritten Reiches stehen dabei meist im Vordergrund und werden stets über die Kontinuität imperialistischer Politik in Deutschland (vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik) hergeleitet. Die Arbeiten basieren trotzdem auf einer breiten Quellengrundlage und beinhalten viele fundierte Aussagen über die großen Rüstungskonzerne des Deutschen Reiches, die man in der westdeutschen Nachkriegsliteratur vergeblich sucht. Der Historiker Hans Pfahlmann stellt in seinem Werk von 1968 den Einsatz von Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen während des Zweiten Weltkrieges ohne ideologische Formulierungen, aber auch nicht frei von Subjektivität dar,
4Orth, Karin:Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische
Organisationsgeschichte. Hamburg 1999;Herbert, Ulrich/Orth, Karin/Dieckmann, Christoph:Die
nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Band I und II. Göttingen 1998 und
Winkler, Ulrike(Hrsg.): Stiften gehen. NS-Zwangsarbeiter und Entschädigungsdebatte. Köln 2000.
5Spoerer, Mark:Profitierten Unternehmen von KZ-Arbeit? Eine kritische Analyse der Literatur. (in:
Historische Zeitschrift, Jg. 1999, Band 268, S. 61-95).
6Lotfi, Gabriele:KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich. München 2000, vgl. dazu
auch:Gellately, Robert:Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik
1933-1945. Paderborn 1993. (aus dem engl.)
7Streit, Christian:Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945.
Bonn, 4. Auflage 1997;Polian, Pavel:Deportiert nach Hause. Sowjetische Kriegsgefangene im „Dritten
Reich“ und ihre Repatriierung. München 2001. (Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Ludwig
Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen- Forschung, Band 2) undOtto, Reinhard:Wehrmacht, Gestapo und
sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. München 1998. (Schriftenreihe der
Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte, Band 77)
8Eichholtz, Dietrich:Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945. Berlin 1969-1996. (Band I:
1939-1941; Band II/1 und 2: 1941-1943; Band III/1 und 2: 1943-1945) undSeeber, Eva:Zur Rolle der
Monopole bei der Ausbeutung der ausländischen Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Berlin 1961. (in:
Der deutsche Imperialismus und der Zweite Weltkrieg, Bd. 4), vgl. dazu auch:Drobisch,
Klaus/Eichholtz, Dietrich:Die Zwangsarbeit ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland während des
Zweiten Weltkrieges. (in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (1970), Heft 18, S. 626-639) und
Drobisch, Klaus:Die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte im Flick-Konzern während des Zweiten
Weltkrieges. Diss., Leipzig 1964.
Page 6
- 6 -dennauf die Motive der Unternehmen wird kaum eingegangen, deren Rolle beim Zwangsarbeitereinsatz eher verharmlost.9
Die Anzahl der regionalen und unternehmensbezogenen Studien ist gerade in den letzten zwei Jahrzehnten stark angewachsen. Die beiden Arbeiten über den Volkswagenkonzern und über Daimler Benz gehören zu den bekanntesten und umfangreichsten Werken.10Für die vorliegende Diplomarbeit sind die Publikationen über Rüstungskonzerne, Kriegsgefangenenlager der näheren Umgebung von Gröditz sowie regionale Betrachtungen der Thematik besonders bedeutsam. Dazu gehört zum Beispiel die Arbeit von Karl-Heinz Thieleke zum Folgeprozess 5 des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals, die auch eine aufschlussreiche Dokumentensammlung enthält.11Günther Oggers umfassende Biographie Friedrich Flicks gehört zwar eher zur populärwissenschaftlichen Literatur, basiert jedoch auf einer breiten Quellengrundlage und stellt zudem die einzige große Arbeit zum „geheimnisvollsten der deutschen Superreichen“ dar.12Die Thematik der Kriegsgefangenenlager der Region um Gröditz behandelt Jörg Osterloh in seiner sehr detaillierten Untersuchung „Ein ganz normales Lager“ von 1997. Sehr ausführlich ist auch dessen Überblick zu den Forschungen zur Geschichte der sowjetischen Kriegsgefangenen von 1995.13Ein Beispiel für eine regionale Studie bietet die Zusammenstellung einer Arbeitsgemeinschaft um Detlef Ernst.14
Die vorliegende Arbeit ist nicht die einzige Untersuchung des Einsatzes von Zwangsarbeitern im Stahlwerk Gröditz. Schon 1978 befasste sich Hubert Dörr in seiner Dissertation mit dieser Thematik.15Es gibt jedoch trotzdem genügend Motive eine erneute Erforschung zu begründen. Zwar hat sich die Quellengrundlage in den letzten 26 Jahren
9Pfahlmann, Hans:Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945.
Darmstadt 1968. (Beiträge zur Wehrforschung, Band 16/17)
10Mommsen, Hans/Grieger, Manfred:Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich.
Düsseldorf 1996 undHopmann, Barbara/Spoerer, Mark/Weitz, Birgit/Brüninghaus, Beate:
Zwangsarbeit bei Daimler-Benz. Stuttgart 1994. (Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 78)
11Thieleke, Karl-Heinz:Fall 5. Anklageplädoyer, ausgewählte Dokumente, Urteil des Flick-Prozesses, mit
einer Studie über die „Arisierung“ des Flick-Konzerns. Berlin 1965.
12Ogger, Günter:Friedrich Flick der Grosse. Der geheimnisvollste der deutschen Superreichen, aufgespürt
hinter der Mauer des Schweigens. München, 3. Auflage 1971.
13Osterloh, Jörg:Ein ganz normales Lager. Das Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager 304 (IV H)
Zeithain bei Riesa/Sa. 1941 bis 1945. Leipzig, 2. Auflage 1997. (Schriftenreihe der Stiftung Sächsische
Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft, Band 2) undOsterloh, Jörg:
Sowjetische Kriegsgefangene 1941-1945 im Spiegel nationaler und internationaler Untersuchungen.
Forschungsüberblick und Bibliographie. Dresden 1995. (Hannah-Arendt-Institut für
Totalitarismusforschung, Berichte und Studien, Nr. 3)
14Ernst, Detlef:NS-Lager in Finsterwalde und Orte in der Region Südbrandenburg 1939-1945. Herzberg
2001.
15Dörr, Hubert:Zum Vorgehen der faschistischen Betriebsführung des ehemaligen Lauchhammerwerkes
Gröditz im Flick-Konzern gegenüber den Arbeitern und anderen Werktätigen sowie zwangsverschleppten
ausländischen Arbeitskräften, Kriegsgefangenen und KZ- Häftlingen während des zweiten Weltkrieges.
Diss., Dresden 1978.
Page 7
- 7 -nichtgrundlegend geändert. Dennoch konnte eine Vielzahl von Unterlagen verwendet werden, die Dörr nicht zur Verfügung standen. Die Arbeit des Dresdner Historikers, die auf den Werken von Eichholtz und Drobisch16aufbaut, ist zudem geprägt von den DDRüblichen Formulierungen, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema unnötig erschweren. Die vorliegende Arbeit wird daher versuchen, dieses schwierige Kapitel deutscher (Regional-) Geschichte neutral und objektiv aufzuarbeiten.
Zuletzt sei noch einmal auf zwei aktuelle Werke verwiesen. Zum Einen der von Wilfried Reininghaus und Norbert Reiman herausgegebene Tagungsband zur Erschließung und wissenschaftlichen Auswertung von Kriegs- und Kriegsfolgeakten.17In ihm finden sich viele nützliche Hinweise über die Auswertung verschiedener Quellen, die auch für diese Arbeit herangezogen wurden. Zum Anderen die Sonderausgabe der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung „Fremd- und Zwangsarbeit in Sachsen 1939-1945.18In dieser Begleitpublikation zu einer Ausstellung der Sächsischen Staatsarchive werden die neuesten Forschungsergebnisse mit Hilfe vieler erstmals veröffentlichter Dokumente dargestellt.
Die weiterhin verwendeten, hier nicht dargestellten Sekundärquellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. Der Umfang der Primärquellen ist leider stark beschränkt. Die verantwortlichen Täter des Stahlwerkes Gröditz ließen kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee Akten in großem Umfang vernichten. Ausgerechnet KZ- Häftlinge mussten fast zwei Tage lang Beweismaterial verbrennen. Dieser Tat fielen jedoch bei weitem nicht alle Unterlagen zum Opfer. Nach dem Ende des Krieges konnten zahlreiche Schriftstücke sichergestellt werden. Diese wurden unverständlicherweise im Garten des Verwaltungsgebäudes gelagert, wo sie wenig später durch einen Brand vernichtet wurden. Die vorliegende Arbeit basierte daher auf dem kleinen Rest übrig gebliebener Schriftstücke, von denen außerdem ca. zwei Drittel technischer Art sind. Der erhaltene Aktenbestand wird in einem kleinen Teil des Archivs der heutigen Schmiedewerke Gröditz GmbH gelagert.
16Drobisch, Klaus(1964) undEichholtz, Dietrich(1969-1996).
17Reininghaus, Wilfried/Reimann, Norbert(Hrsg.): Zwangsarbeit in Deutschland 1939-1945: Archiv-
und Sammlungsgut, Topographie und Erschließungsstrategien. Bielefeld 2001. Speziell für den
sächsischen Raum bietet Ulrich Heß eine Auswertung der Literatur zur Thematik Zwangsarbeit. (Heß,
Ulrich:Quellen zum Schicksal der Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter und der ausländischen Zivilarbeiter
im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig 1939-1945, in:Nolte, Hans-Heinrich(Hrsg.): Der Mensch gegen
den Menschen. Überlegungen und Forschungen zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941.
Hannover 1992, S. 137-146).
18Sächsisches Staatsarchiv Leipzig:Fremd- und Zwangsarbeit in Sachsen 1939-1945. Beiträge eines
Kolloquiums in Chemnitz am 16. April 2002 und Begleitband einer Gemeinschaftsausstellung der
Sächsischen Staatsarchive. Halle 2002. (Veröffentlichungen der Sächsischen Archivverwaltung: Reihe A,
Archivverzeichnisse, Editionen und Fachbeiträge, Band 2)
Page 8
- 8 -Dieeinzelnen erhaltenen Schriftstücke sind in ihrer Zusammensetzung und Aussagekraft sehr unterschiedlich zu bewerten. Aufschlussreich sind beispielsweise der erhaltene Schriftverkehr des Stahlwerkes mit dem Treuhänder der Arbeit, die Personalakten einiger Betriebsdirektoren und vor allem Rundschreiben und Anordnungen der Werksführung. Ebenfalls erhalten sind Daten zur Rüstungsproduktion sowie die Bilanzen des Stahlwerkes von 1927 bis März 1945. Aus diesen sind wichtige Erkenntnisse zur Anzahl der Zwangsarbeiter, zu Einnahmen und Ausgaben des Werkes oder auch zum Krankenstand zu gewinnen, was weitere Rückschlüsse erlaubt. Eine Auswertung dieser Bilanzen ist bisher noch nicht vorgenommen worden. Des Weiteren existiert die vollständige Personalkartei der Angestellten, unter denen auch 30 ausländische Zwangsarbeiter waren. Da die meisten Unterlagen jedoch vernichtet wurden, muss verstärkt auf Erinnerungsberichte zurückgegriffen werden. Diese liegen in drei unterschiedlichen Variationen vor. Zunächst existieren Berichte von ehemaligen deutschen Werksangehörigen im Archiv des Stahlwerkes Gröditz, jedoch ohne Signatur und Datum. Der Inhalt der Aussagen lässt darauf schließen, dass die Berichte von Arbeitern stammen, die das Naziregime schon während des Krieges ablehnten, zum Beispiel KPD-Mitglieder. Die zweite Form von Aussagen stellen die Vernehmungen des Zusatzprozesses 5 des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals dar. In diesem sind zum Einen die verantwortlichen Betriebsdirektoren, zum Anderen ehemalige KZ-Häftlinge und zivile Zwangsarbeiter vernommen worden. Diese Dokumente liegen dem Institut für Zeitgeschichte in München auf Mikrofilm vor, und stellen den wichtigsten Teil der Erinnerungsberichte dar.19Die dritte Variante von Zeugenaussagen wurde in den Beständen der Landesbehörde der Deutschen Volkspolizei Sachsen im Hauptstaatsarchiv Dresden gefunden.20Hierbei handelt es sich um Befragungen der neu aufgestellten Polizei kurz nach Kriegsende. Auch diese Vernehmungen liefern neue Erkenntnisse, denn neben einfachen Arbeitern und Angestellten wurden auch Teile der Wachmannschaften oder andere direkt Verantwortliche, wie zum Beispiel der Werksarzt befragt. In der Arbeit von Dörr sind diese Dokumente ebenfalls nicht ausgewertet worden. Aussagen ehemaliger Kriegsgefangener stehen hingegen nicht zur Verfügung.
Im sächsischen Hauptstaatsarchiv sind weitere interessante Unterlagen des Stahlwerkes Gröditz erhalten. Aus einer Auflistung der Zwangsarbeiter nach Nationalität geht zum Beispiel hervor, dass Arbeiter aus über 20 Ländern in Gröditz beschäftigt waren.21Des
19Institut für Zeitgeschichte München,NI, Bd. 2, 3, 8, 23, 40 und 54.
20Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden,Nr. 11377, Landesbehörde der Deutschen Volkspolizei
Sachsen, Bestand 4, Bd. 761 und 762.
21Vgl.Anlage 7.3.10,Herkunft der ausländischen Arbeiter.
Page 9
- 9 -Weiterensind einige der monatlichen Beschäftigtenmeldungen an das Arbeitsamt Riesa22, ein Arbeitsbuch eines ausländischen Zwangsarbeiters sowie verschiedene Verordnungen über den Umgang mit Ausländern erhalten.23Neben den Beständen des Stahlwerkes Gröditz, des Hauptstaatsarchivs Dresden und des Instituts für Zeitgeschichte in München gibt es seit einigen Jahren die sog. „Häftlingsdatenbank der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg“.24In dieser wurden die in den historischen Dokumenten vorhandenen personenbezogenen Angaben zu den ehemaligen Gefangenen des Konzentrationslagers Flossenbürg digitalisiert. Somit ist es erstmals möglich, Gefangenentransporte nach Gröditz, Rücküberstellungen von Gröditz, Fluchtversuche und Todesfälle von KZ- Häftlingen auszuwerten. Die Daten sind von den Mitarbeitern der Gedenkstätte 2003, anlässlich einer zentralen Gedenkfeier für die Opfer der Zwangsarbeit in Gröditz, zur Verfügung gestellt worden. Zusätzlich konnten einige Dokumente der Stadt Gröditz, wie zum Beispiel die Personenstandsbücher des Standesamtes, zur Bearbeitung des Themas herangezogen werden.25Erfolglos blieben hingegen die Recherchen in den Archiven der Stadt Riesa, des Stahlwerkes Riesa sowie mehrere Anfragen an verschiedene Heimatvereine und Museen der Region.
Nach einer kurzen Einführung über die Entwicklung des Stahlwerkes Gröditz, den Beginn der Rüstungsproduktion und die Auswirkung derselben auf die deutsche Belegschaft ist der Hauptteil der vorliegenden Arbeit in die drei großen Themenkomplexezivile Zwangsarbeiter, KriegsgefangeneundKZ-Häftlingeunterteilt. Für jeden dieser Themenbereiche werden zunächst Rechtsgrundlagen und Organisation des Arbeitseinsatzes dargestellt. Anschließend wird auf Anzahl und Herkunft der zwangsverpflichteten Ausländer eingegangen, bei den KZ-Häftlingen aufgrund des fehlenden Archivgutes nur in beschränktem Maße. Die darauf folgende Beschreibung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ist untergliedert in einzelne Bereiche wie Unterbringung, Bekleidung, Verpflegung, medizinische Versorgung, Bewachung usw. Am Ende der beiden Komplexe zivile Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wird die Frage nach dem Profit des Unternehmens durch den Arbeitseinsatz thematisiert. Am Schluss des Kapitels über den Einsatz von KZ-Häftlingen steht das schrecklichste Ereignis in der Geschichte des Ortes: die Ermordung der KZ-Häftlinge kurz vor Ende des Krieges.
22Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden,Nr. 13175, Landesarbeitsamt Sachsen.
23Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden,Nr. 11616, Fa. Mitteldeutsche Stahlwerke GmbH Riesa.
24Alle von der Gedenkstätte Flossenbürg zur Verfügung gestellten Dokumente besitzen keine Signatur.
Beim zitieren wird daher nur der Typ und das Datum des jeweiligen Dokuments angegeben. (Bsp.:KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg:Rücküberstellungen, 27.12.1944)
Page 10
- 10 -DasZiel der Arbeit ist die sachliche und möglichst objektive Aufarbeitung des Zwangsarbeitereinsatzes im Stahlwerk Gröditz während des Zweiten Weltkrieges anhand der neuesten Literatur und noch nicht erschlossenem Archivgut. Dafür wurden die Daten der Bilanzen des Stahlwerkes Gröditz ausgewertet, in mehreren Anlagen zusammengefasst und zum Teil grafisch dargestellt. Zusätzlich verschaffen einige Karten, Lagepläne und Fotografien dem nicht ortskundigen Leser einen Eindruck über die Region um den Ort des Geschehens. Des Weiteren werden die Aussagen der Opfer und der Täter gegenüber gestellt und anhand der noch vorhandenen Unterlagen geprüft. Die Arbeit soll zeigen, dass trotz des geringen Umfangs des erhaltenen Archivmaterials eindeutige Aussagen über den Zwangsarbeitereinsatz des Stahlwerkes Gröditz möglich sind. Abschließend wird noch einmal der sowohl regionale, als auch unternehmensbezogene Charakter der vorliegenden Studie betont.
2. Vom Eisenwerk zum Rüstungskonzern
2.1 Die Entwicklung des Eisenwerkes Gröditz bis zum Beginn der Rüstungsproduktion 1933/34
Die Ortschaft Gröditz wurde ca. um 1284 gegründet; ihre Bedeutung blieb jedoch bis ins 18. Jahrhundert gering. Der Bau des Grödel-Elsterwerdaer Floßkanals zwischen 1740 und 1744 leitete die industrielle Entwicklung des Ortes ein. Der Kanal verbindet die Schwarze Elster mit der Elbe und ermöglichte somit den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten. 1779 errichtete Graf Detlef Carl von Einsiedel einen Eisen- oder Zähnhammer als Zweigbetrieb seines Stammwerkes im nahegelegenen Lauchhammer.26Das Werk Gröditz zählte damit mit den Werken Lauchhammer und Riesa zu den drei „Lauchhammerwerken“. 1832 erhält das Eisenwerk eine Werkschule, zu diesem Zeitpunkt gehörten schon etwa 200 Beschäftigte, aus dem Ort selbst und aus den umliegenden Dörfern, zur Fabrik. Bis zum Beginn der Rüstungsproduktion stellte sie als Hüttenwerk mit gemischter und teilweiser Fertigbearbeitung hauptsächlich Stahlgussstücke, Schmiedestücke, Radsatzmaterial, Gussröhren und Temperguss-Fittings aller Art her.27Bereits im Ersten Weltkrieg
25Archiv der Stadt Gröditz:Standesamt, Personenstandbücher, Sterbebücher 1939-45.
26Vgl.Anlage 7.3.1,Karten der Region um Gröditz.
27Betriebsarchiv des Stahlwerkes Gröditz (im folgendenBA Gröditz),Nr. 51, S. 25f.
Page 11
- 11 -produziertedas Eisenwerk Gröditz Rüstungsgüter, ging danach jedoch wieder zur normalen Produktion über. Einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wurde die in Finanznot geratene Lauchhammergruppe von ihrem größten Kunden, der Linke-Hoffmann AG, aufgekauft28. An der neu entstandenen Linke-Hoffmann-Lauchhammer AG, kurz LHL, sicherte sich Friedrich Flick 1923 die Aktienmehrheit. Dieser änderte den Namen der LHL in Mitteldeutsche Stahlwerke und gliederte diese am 1. Juli 1926 in die Vereinigten Stahlwerke ein, an der er später ebenfalls die Aktienmehrheit besitzen sollte.29Die Mittelstahl AG wurde zum Kern der Flick- Unternehmen. 1931 verlegte die Direktion des Konzerns ihren Hauptsitz von Berlin nach Riesa, wo sich das zu diesem Zeitpunkt größte Werk der Mittelstahl-Gruppe befand.30
Das Gröditzer Werk hingegen war seit dem Ersten Weltkrieg in der technologischen Entwicklung und der Investitionstätigkeit deutlich hinter den beiden anderen Lauchhammerwerken zurückgeblieben. Erst mit der von Flick erreichten Besichtigung der Mittelstahlwerke durch den Reichswehrministers Blomberg im Jahre 1934, bahnten sich weitreichende Veränderungen an. Der Beginn der Rüstungsproduktion kann jedoch schon auf das Jahr 1933 datiert werden, ein Schreiben der Werksleitung bestätigt den Start der „S-Fabrikation“ in diesem Jahr.31Aus einem mit „Streng vertraulich!“ gekennzeichneten Bericht über den Schriftwechsel zwischen dem Werk und der Torpedo-Versuchsanstalt der Marine in Kiel-Eckernförde geht hervor, dass die Marine ab 1935 mit Rüstungsgütern beliefert wurde.32Mit der Produktion von Geschützen ist hingegen erst kurz vor bzw. nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges begonnen worden. In den Neubau des „Maschinenbaus“ investierte Flick über 15 Millionen Reichsmark.33
2.2 Die Übernahme des Werkes durch Friedrich Flick
Friedrich Flick (10.07.1883 - 20.07.1972) begann seine Kariere 1915 in der Siegerländer Charlottenhütte GmbH. Nach einigen Firmenübernahmen im Ruhrgebiet weitete er sein Engagement nach Mitteldeutschland und Schlesien aus. 1921 gelang ihm die Übernahme
28Das genaue Datum der Übernahme ist unbekannt. Aus einem Dokument des BA Gröditz geht hervor, dass
das Unternehmen im April 1923 schon „Linke-Hoffmann-Lauchhammer AG“ hieß.(BA Gröditz,Nr.
1048, Lehrvertrag vom 20.04.1923)
29Ogger, Günter(1971), S. 75-84.
30Dörr, Hubert(1978), S. 19.
31BA Gröditz,Bericht vom 15.03.1935; weitere Berichte über die Rüstungsproduktion vom 28.08.1935 und
19.11.1935; Mit „S- Fabrikation“, d.h. „Sonder-Fabrikation“, wurde die Kriegsfertigung bezeichnet
32Ebd.
33Vgl.Anlage 7.3.2,Werksgelände Stahlwerk Gröditz.
Page 12
- 12 -derOberschlesischen Eisenindustrie AG (OEI), dem zweitgrößten Kohle- und Eisenunternehmen des ostelbischen Reviers. Größter Kunde der OEI war der Stahl- und Verarbeitungskonzern Linke-Hoffmann-Lauchhammer AG (LHL). Dieser verfügte zwar über ausreichende Braunkohlevorräte, besaß aber kaum Roheisen. Daher strebte die LHL eine Interessengemeinschaft mit der OEI an. Flick erkannte die Chance zur Übernahme der LHL und schloss im November 1923 einen Interessengemeinschaftsvertrag ab, dessen Einzelheiten nie bekannt wurden. Kurze Zeit später gelang es ihm, die Aktienmehrheit an der LHL zu kaufen. Die vereinigten Gesellschaften bildeten nun den größten Eisenindustriekonzern Ost- und Mitteldeutschlands. Dieser hatte allerdings über 100 Millionen Reichsmark Schulden und schrieb rote Zahlen. In den folgenden zwei Jahren wurde der Konzern daher von Flick reorganisiert und umgegliedert. Die OEI gliederte er wieder aus der Vereinigung aus, die LHL wurde in drei Aktiengesellschaften aufgeteilt. Eines der drei neuen Unternehmen wurde die Mitteldeutsche Stahlwerke AG mit ihren Hauptwerken in Riesa, Gröditz, Lauchhammer, Burghammer und Henningsdorf.34Durch die Reorganisation von OEI und LHL gelang es Flick innerhalb weniger Monate den enormen Schuldenberg abzubauen und die Verluste in Gewinn umzuwandeln.35