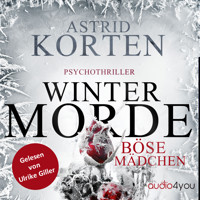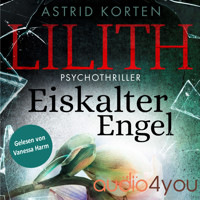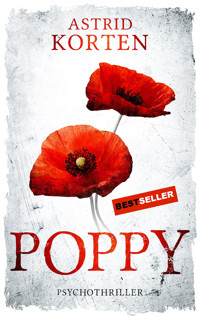4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erste Stimmen: - Die Geschichte traf mich mitten ins Herz - beeindruckend, emotional, berührend und absolut empfehlenswert! - Ein sehr intensives und persönliches Zeitdokument - bewegender Familienroman - Bewegend, aufregend und nah - Auf Spurensuche - Tiefgründig, bewegend und voller Emotionen - ein ganz besonderes Lesehighlight! - Ein mitreißender Roman, der zum Nachdenken anregt - Ein emotionaler Kraftakt - bewegendes Schicksal, uneingeschränkte Leseempfehlung Aachen, 2013. Nach der Trennung von ihrem Mann steht Nora Weiß vor dem Neuanfang, innerlich leer, orientierungslos, voller Fragen. Ihr bisheriges Leben – Ehe, Sicherheit, Vertrauen – liegt in Scherben. Als auch noch ihre geliebte Großmutter Xanna stirbt, wird Nora jäh mit einer weiteren Leere konfrontiert. Beim Ausräumen des alten Familienhauses, das voller Erinnerungen und Schweigen steckt, entdeckt Nora auf dem staubigen Dachboden eine unscheinbare Holzschatulle. In ihr: ein alter Ausweis mit einem fremden Namen, ein Davidstern, ein schlichter Metallring. Stumme Zeugen, die ein verborgenes, ein anderes Leben andeuten. Getrieben von Fragen über ihre Großmutter, begibt sich Nora gemeinsam mit dem Journalisten Andreas Schwarz auf eine Reise in die Vergangenheit, eine Spurensuche, die sie bis nach Belarus führt. Was sie dort über die geliebte Großmutter entdeckt, erschüttert Nora zutiefst. Wer war Xanna wirklich? Und warum hat sie ein Leben lang geschwiegen? Zwischen den Schatten des Zweiten Weltkriegs, den Narben verlorener Identitäten und den Fragen nach Schuld und Vergebung entdeckt Nora nicht nur die wahre Geschichte einer Frau, die sie zu kennen glaubte, sondern findet allmählich auch zu sich selbst zurück. Ein fesselnder Familienroman über ein erschütterndes Geheimnis, verdrängte Erinnerungen und die Suche nach der Wahrheit, tiefgründig, bewegend und voller Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für meine Großeltern
Über das Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Impressum
Über die Autorin
Für meine Großeltern
Durch die Dunkelheit zweier Kriege gegangen,
mit Mut und Liebe, als alles zerbrach,
den Schmerz mit stiller Kraft ertragen.
Eure Liebe gab mir den Mut, das Leben zu meistern und an die Kraft der Freiheit zu glauben.
ZWEI LEBEN ist Euch gewidmet, getragen von Erinnerungen und Dank.
Über das Buch
Aachen, 2013. Nach der Trennung von ihrem Mann steht Nora Weiß vor dem Neuanfang, innerlich leer, voller Fragen, orientierungslos. Ihr bisheriges Leben, Ehe, Sicherheit, Vertrauen liegt in Scherben. Als auch noch ihre geliebte Großmutter Xanna stirbt, wird Nora jäh mit einer weiteren Leere konfrontiert.
Beim Ausräumen des alten Familienhauses, das voller Erinnerungen und Schweigen steckt, entdeckt Nora auf dem staubigen Dachboden eine unscheinbare Holzschatulle. In ihr: ein alter Ausweis mit einem fremden Namen, ein Davidstern, ein schlichter Metallring. Stumme Zeugen, die ein verborgenes, ein anderes Leben andeuten.
Getrieben von Fragen über ihre Großmutter begibt sich Nora gemeinsam mit dem Journalisten Andreas Schwarz auf eine Reise in die Vergangenheit, eine Spurensuche, die sie bis nach Belarus führt. Was sie dort über die geliebte Großmutter entdeckt, erschüttert Nora zutiefst. Wer war Xanna wirklich? Und warum hat sie ein Leben lang geschwiegen?
Zwischen den Schatten des Zweiten Weltkriegs, den Narben verlorener Identitäten und den Fragen nach Schuld und Vergebung entdeckt Nora nicht nur die wahre Geschichte einer Frau, die sie zu kennen glaubte, sondern findet allmählich auch zu sich selbst zurück.
Ein fesselnder Familienroman über eine erschütternde Vergangenheit, verdrängte Erinnerungen, das Schweigen und die Kraft der Liebe. Tiefgründig, bewegend und voller Spannung.
Prolog
Dezember 1941
„Ist sie noch am Leben?“
„Wer kann das schon sagen? Hallo, können Sie mich hören?“
Ich höre sie. Zwei Männerstimmen, eine ältere und eine junge Stimme. Ich konnte sie kommen hören: das helle Knirschen des Schnees unter ihren Stiefeln. Ich spüre, wie mir jemand auf die Schulter klopft, aber ich bewege mich nicht.
Noch vor wenigen Augenblicken, vor einer Stunde oder einem Tag?, lief ich um mein Leben, angespornt vom Überlebensinstinkt. Jetzt ist dieses Gefühl weg. Ich bin erschöpft, abgestumpft, erstarrt. Jetzt würde ich den Tod als meinen besten Freund annehmen.
„Ihr Mantel ist voller Blutflecken, vielleicht ist sie tot.“
Die jüngere Stimme.
Ich verstehe sie, also sprechen sie Russisch. Aber ich verstehe auch Deutsch und Französisch; ich bin die Erste in unserer Familie, die an der Universität in Minsk studiert. Papa ist so stolz auf mich. Meine Familie …
Ich spüre, wie eine Träne aus dem Augenwinkel kullert und in der Kälte auf halber Strecke an meiner Wange festfriert.
„Hallo, sieh mich an!“ Die ältere Stimme.
Ich tue, was er sagt. Solange sie mich in Ruhe lassen.
Zwei Männer in grauen Mänteln stehen neben mir. Der Ältere von ihnen trägt eine Uschanka mit einem roten Stern darauf. Der Jüngere hält ein Gewehr in der Hand.
„Wer sind Sie?“
Ich schließe meine Augen wieder. Denn: Wer bin ich?
Kapitel 1
August 2013
Nora
Der Andrang zur Beerdigung von Großmutter Xanna ist größer, als wir je vermutet hätten. Schon am Buffet für Kaffee und Kuchen beginnt das endlose Kondolieren. Die Schlange zieht sich wie ein träger, schwarz-grauer Lindwurm durch den Empfangsbereich des Beerdigungsinstituts: gedämpftes Gemurmel, leiser Husten, das feuchte Rascheln von Taschentüchern.
Mama und ich hatten Stunden damit verbracht, ihr altes Adressbuch zu durchforsten, Karte um Karte zu schreiben, als Geste, aus Pflichtgefühl, mit einem Hauch echter Zuneigung. Aber dass so viele kommen würden, all diese Menschen mit ihren grauen Köpfen und der würdevollen, dunklen Kleidung, das hätten wir nicht erwartet. Manche sind aufwendig zurechtgemacht, als wollten sie ihr Trauergewand noch einmal ausführen, andere stehen mit verweintem Blick und krampfhaft umklammerter Serviette in der Hand da.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie meine Mutter mit leicht gerunzelter Stirn zur Anrichte mit den belegten Brötchen blickt.
„Ich schau mal nach dem Catering, Nora. Ob’s reicht für alle?“
Sie verschwindet, lässt mich zurück mit Papa und Thomas, der ungeduldig sein Jackett zurechtrückt.
„Es tut mir leid, Nora. Deine Großmutter war eine bemerkenswerte Frau.“
„Viel Kraft, mein Kind. So jemand hinterlässt eine große Lücke.“
„Xanna war meine Lieblingslehrerin. Ihretwegen habe ich Französisch studiert, jetzt unterrichte ich selbst.“
„Deine Großmutter war die Einzige, die an mich geglaubt hat. Ohne sie hätte ich mein Studium nie geschafft.“
Es sind gut gemeinte Worte, dennoch klingen sie für mich wie aus einer anderen Welt. Großmutter Xanna, wie sie in diesen Geschichten erscheint, klug, inspirierend, zugewandt, ist nicht die Frau, die ich kannte. Als Lehrerin war sie offenbar leidenschaftlich und einfühlsam. In meinem Leben war sie zwar da. Freundlich, ja. Aber nicht warm. Nie wirklich offen.
Wenn ich sie als Kind besuchte, gab es stets Kekse und Schokolade. Sie hörte mir zu, stellte gelegentlich eine Frage, lächelte höflich, doch sie wirkte nie ganz anwesend. Wie eine Schauspielerin, die ihre Rolle gelernt hat, aber nicht ganz in ihr aufgeht.
Ich erinnere mich an keine Umarmung, die aus dem Impuls kam, mich zu halten. An keine Geschichte aus ihrer Jugend. An kein Wort, das mir das Gefühl gab, besonders für sie zu sein. Sie war zufrieden, wenn wir kamen und, noch zufriedener, wenn wir wieder gingen.
Als ich erwachsen wurde, hatten wir kaum Kontakt. Ein paar Anrufe im Jahr, ein flüchtiger Gruß zu Weihnachten. Ich glaube nicht, dass sie es vermisste. Vielleicht war sie einfach eine Frau, die gelernt hatte, allein zu sein und im Schweigen nicht nur Zuflucht fand.
„Deine Großmutter hat in der Schule Spanisch unterrichtet, wusstest du das?“, sagt eine ältere Frau in einem streng geschnittenen Anzug und schüttelt mir die Hand. Ihre Stimme ist brüchig, aber bestimmt. „Ich hätte Probleme. Xanna hat mir in ihrer Freizeit Nachhilfe gegeben, bis ich die Prüfung bestand.“
Spanisch? Ich starre sie einen Moment lang an. Ich hatte keine Ahnung, dass Großmutter überhaupt Spanisch sprach, geschweige denn so gut, dass sie darin unterrichten konnte.
„Schön, das zu hören. Danke.“ Meine Stimme klingt fern.
„Es ist unvorstellbar, dass sie nicht mehr da ist.“ Die Frau hält meine Hand länger als nötig, mit einer Wärme, die mich beinahe beschämt. Als sie sich schließlich abwendet und in Richtung der Schnittchen geht, atme ich leise auf.
Unvorstellbar? Nein. Großmutter war neunzig. Ich hoffe, ich werde dieses Alter erreichen, bei all dem Tempo, dem Lärm, dem ständigen Drängen unserer Gegenwart. Früher, als sie so alt war wie ich heute, gab es zwei Fernsehkanäle, eine Tageszeitung und vielleicht ein Telefongespräch am Abend. Heute wird man überrollt von Bildern, von Meinungen, Nachrichten, Push-Benachrichtigungen. Apps wollen sofortige Antworten, Freunde erwarten Likes, Aufmerksamkeit, sofortige Reaktionen. Alles muss schneller gehen, effizienter, direkter, durchgeplant.
Damals ließ man Kinder nach dem Abendessen draußen spielen. Heute braucht man dafür beinahe eine schriftliche Genehmigung. Geburtstagskuchen in der Schule? Undenkbar: zu viel Zucker, zu viel Verantwortung. Kein Wunder, dass sie so alt wurde. Sie war unberührt von diesem permanenten Rauschen.
„Mein herzliches Beileid, Nora. Geht es dir gut?“ Ella tritt an mich heran, ihre Umarmung duftet nach Vanille, Sandelholz und etwas Eigenem, das sich nicht benennen lässt.
„Wir sind traurig“, sagt Thomas an meiner Stelle, nüchtern wie immer. „Aber mal ehrlich, sie war uralt. Kein Kindstod.“
Ella wirft ihm einen scharfen Blick zu. „Du redest von Noras Großmutter.“
Ich schiebe mich zwischen die beiden. „Kommt, wir trinken einen Kaffee. Meine Eltern sind schon am Buffet.“
Ella und Thomas, ein unlösbarer Knoten. Ihre Abneigung ist alt, verlässlich und nie ganz zu entwirren. Heute ist nicht der Tag für das nächste Gefecht.
„Ich gehe zurück ins Büro“, sagt Thomas und schaut auf seine Uhr. Dann ein kurzer Klaps auf meinen Oberarm.
„Vielleicht besser so“, murmelt Ella.
Er verschwindet in Richtung Ausgang, seine Schritte hart auf dem Steinboden. Ich spüre, wie sich meine Schultern unmerklich senken. Wenn die beiden sich begegnen, ist Spannung garantiert. Im Büro funktionieren sie nebeneinander, professionell, regelkonform. Privat: ein Minenfeld.
Thomas glaubt, Ella sei eifersüchtig auf unsere Beziehung. Vielleicht hat er recht. Ella ist eine atemberaubende Frau, groß, schlank, mit dunkler Haut und einem sicheren Gespür für Präsenz. Sie ist Single, wenn man ihre Tinder-Geschichten ausklammert. Ich glaube eher, sie kann seine Selbstdarstellung nicht ausstehen. Seinen Ehrgeiz. Seine Selbstsicherheit.
Ich liebe sie beide. Und ich bin die, die versucht, das Gleichgewicht zu halten.
„Ich habe nie verstanden, was du an ihm findest“, sagt Ella, als wir uns hinten in die Schlange für Kaffee und Kuchen einreihen.
Es sollte offensichtlich sein. Thomas ist der attraktivste Mann, den ich je gesehen habe: dunkelblondes Haar, klare blaue Augen, hohe Wangenknochen, ein athletischer Körper, der in jedem Raum auffällt. Auf dem Schulhof hängen die Mütter an seinen Lippen, wenn er unseren Sohn bringt. Im Supermarkt folgen ihm verstohlene Blicke.
Er weiß das und pflegt sich entsprechend. Jede Unebenheit auf seiner Haut wird sofort begutachtet, kein Pickel, den er nicht vom Hautarzt prüfen ließe. Ich finde das beruhigend. Lieber eitel und gepflegt als nachlässig und stumpf. Dazu kommt: Er ist klug, ehrgeizig und organisiert. Ein Mann mit einem Plan.
„Zum Glück musst du nicht mit ihm zusammenleben“, sage ich halb im Scherz. „Komm, trink einen Kaffee mit mir. Ich habe jetzt Lust auf Koffein.“
„Habt ihr nichts Stärkeres? Ich wünsche mir für mein Goodbye Caipirinhas und Samba. Laut, fröhlich, wild.“ Ella greift nach einer Tasse Kaffee und wir ziehen uns mit zwei Tellern zu einem Stehtisch zurück. „Eine Feier des Lebens. Prost.“
„Für dich wäre das perfekt“, sage ich und stoße mit meiner Kaffeetasse an. „Aber meine Großmutter war nicht so. Sie mochte keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich hätte sie sich eine stille, kleine Beerdigung gewünscht, ohne viel Aufhebens.“
„Hast du sie nie danach gefragt?“
„Nein. Wir haben nie darüber gesprochen. Sie war noch so fit, hat jeden Tag eingekauft, selbst gekocht, keine Fertiggerichte. Sie verabscheute Tiefkühlkost. Dann kam der Anruf vom Gemüsehändler. Sie war zwei Tage lang nicht bei ihm. Mama ist sofort zu ihr gefahren. Großmutter lag im Bett. Sie ist friedlich im Schlaf gestorben.“
„Wo kann man sich für einen solchen Abschied anmelden? Ich meine es ernst.“
„Themenwechsel. Wie hast du es eigentlich geschafft, dich freizunehmen? Alle sind im Urlaub.“
„Ich habe Theo gesagt, du brauchst mich. Er hatte keine Wahl.“
Ich lächle. Sie ergreift jede Gelegenheit, dem Büro zu entkommen. Ihr Herz schlägt für anderes, für Mode, Stoffe, Entwürfe. Ihr eigener Online-Shop für Dessous läuft gut. Die Logistik war immer nur eine Zwischenlösung.
Als sie mir eine frische Tasse Kaffee bringt, dazu ein gesund aussehendes Sandwich, drehen sich selbst die älteren Herren nach ihr um. Wir sind beide fünfunddreißig. Aber Ella sieht jünger aus. Ihre Figur ist wie aus einem Guss, ihre Haltung stolz. Heute trägt sie ihr Haar im Dutt, morgen vielleicht offen, im Afrolook. Sie wechselt ihren Stil wie andere ihre Stimmung. Unsere Freundschaft begann spät, aber wurde tief. Ich bin unendlich dankbar dafür.
„Noch einen Kaffee, dann bin ich weg“, sagt sie und reicht mir die Tasse.
„Theo ist nett, aber du überreizt sein Wohlwollen besser nicht“, murmele ich.
Sie trinkt kaum einen Schluck, wirft einen Blick auf ihre Uhr, küsst mich auf die Wange.
„Ich sehe dich morgen im Büro. Viel Spaß noch mit den Greisen.“
Und schon ist sie verschwunden. Zurück bleibt nur ihr Duft, der sich langsam in der Luft verliert.
Morgen beginnt der Alltag wieder. Früh aufstehen, Frühstück, Oliver zu meinen Eltern bringen. Acht Stunden im Büro. Daten, Fahrpläne, Lieferketten. Und abends das Sofa mit Thomas, ein Auge auf dem Fernseher, das andere auf dem Handy.
Ich seufze und weiß nicht, ob mich das tröstet oder erschöpft.
Kapitel 2
Nora
Eine Woche frei wegen einer Beerdigung ist kein richtiger Urlaub. Und doch fühlt sich der erste Arbeitstag danach genauso an, fremd und schwer, wie mit einer dumpfen Glocke über dem Kopf.
Ich vergesse meine Log-in-Codes. Der Kaffee aus der Maschine schmeckt bitterer als sonst. Und die Stunden bis Dienstschluss ziehen sich dahin wie ein miserabler Actionfilm: laut, endlos, von jemand anderem geliebt, aber ganz sicher nicht von mir.
Während ich Zahlen aus einem Arbeitsauftrag in die endlose Zeile einer Tabelle tippe, gleitet mein Blick immer wieder hinüber zu Thomas. Er sitzt an seinem Schreibtisch, ganz in seinem Element, als wäre die Welt da draußen nie ins Wanken geraten. Telefon am Ohr, Laptop vor sich, das Handy vibrierend daneben. Ein Griff hier, ein kurzes Nicken dort, alles läuft bei ihm in flüssigen Bewegungen, als hätte er einen inneren Takt, dem ich längst nicht mehr folge.
Mein Mann. Endlich darf ich ihn so nennen. Nach zehn gemeinsamen Jahren, nach einem Kind. Und doch war er in der Vergangenheit nur „mein Freund“, ein Wort, das zu flüchtig klang, nach Unverbindlichkeit, nach Warten. Wie etwas, das jederzeit enden kann. Es hat mich zunehmend gestört.
Da waren die Mütter auf dem Schulhof, die von „ihren Ehemännern“ sprachen, wogegen ich immer von „meinemFreund“ erzählte. Zwei Nachnamen in einer Familie. Und meine Mutter, die eines Tages aufhörte, zu fragen, ob wir heiraten würden.
Jetzt haben wir es getan, vor einem halben Jahr, endlich. Ein leiser Tag, keine große Geste, aber offiziell genug, damit ich sagen kann: „Mein Mann.“
Nur schade, dass ich ihn seither seltener sehe. Er ist oft unterwegs. Neue Kunden, neues Gebiet. Und oft die Hotelübernachtung, angeblich, um morgens pünktlich vor Ort zu sein.
Der Gedanke daran, ein fremdes Bett, ein flüchtiges Lächeln an
der Rezeption, sein Handy auf dem Nachttisch, schnürt mir jedes Mal kurz die Kehle zu.
Auch wenn er zu Hause ist, scheint Thomas manchmal abwesend. Als hätte er sich in gewisser Weise zurückgezogen in ein Leben, das ich nicht mehr ganz mit ihm teile. Schweigsamer ist er geworden. Und immer in sein Handy vertieft.
Unsere Ehe war für mich ein Versprechen. Etwas, das bleibt, selbst wenn die Leichtigkeit verschwindet. Und doch habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns auf leisen Sohlen davonschleichen, jeder in eine andere Richtung, dass uns der Alltag Stück für Stück voneinander trennt, dass wir nicht mehr dieselben füreinander sind, dass er nicht mehr derselbe für mich ist. Nicht aus Feindseligkeit, sondern aus Ermüdung.
Wir sind nicht mehr dieselben wie vor zehn Jahren. Damals war alles leicht. Heute haben wir Zeitpläne. Pflichten. Verantwortung. Vielleicht brauchen wir einen Moment nur für uns. Ein Wochenende. Oliver, zu meinen Eltern und wir zurück zu den Tagen, als wir nicht voneinander lassen konnten. Ich vermisse unsere Nähe, unsere Gespräche und Zärtlichkeiten.
Der Gedanke hebt meine Stimmung sofort. Wenn ich Oliver heute Abend abhole, frage ich Mama gleich nach einem Babysitter-Wochenende.
*
Am Schreibtisch gegenüber klappt Thomas den Laptop zu, steckt das Handy ein und steht auf. Eine Minute später sehe ich durchs Fenster, wie er ins Auto steigt und losfährt: ein Termin, der nächste Kunde.
Mit dem eigenen Mann in derselben Firma zu arbeiten, hat seine Vorteile. Ich weiß immer, wo er ist, glaube ich zumindest. Ella hatte mich damals für verrückt erklärt, als ich ihm das Vorstellungsgespräch in der Firma vermittelt habe.
„Paare sollten nicht den ganzen Tag aufeinander hocken“, hatte sie gewarnt.
Aber Thomas brauchte Arbeit und wir brauchten das Geld. Es war ein Kompromiss, wie so vieles. Vier Jahre ist das jetzt her.
Ich halte meine rechte Hand über die Tastatur. Mein Ehering fängt das Sonnenlicht ein, ein winziges Funkeln auf meiner Haut. Thomas hat immer gesagt, die Ehe sei nur ein Symbol. „Wir sind doch längst verbunden. Durch Oliver, durch das Haus, durch unser Leben.“
Für mich war sie mehr. Ein stiller Traum. Ein Zeichen, dass er mich will, nicht nur im Alltag, sondern auch im Namen. Sein Antrag war kein Hollywood-Moment, aber ich hatte zu lange gewartet, um mich noch über fehlende Romantik zu beschweren.
*
Ein leises Räuspern. Ella, zwei Schreibtische weiter. Ich folge ihrem Blick und sehe Theo neben mir stehen, unseren Geschäftsführer, der wie ein Jagdhund jede Sekunde der Unproduktivität wittert.
Ich beginne hektisch zu tippen.
„Mein Beileid zu deiner Großmutter, Nora. Geht es dir gut?“
„Danke. Sie war sehr alt. Und trotzdem ist es seltsam.“
„Der Alltag wird dir guttun. Schaffst du’s, heute noch diese Akten zu erledigen?“ Er legt einen dicken Stapel auf meinen Schreibtisch.
Ich nicke. „Wird gemacht.“
Theo zieht weiter, durch das offene Büro mit seinen sechs Plätzen, willkürlich verstreut wie Spielfiguren auf einem übergroßen Brett: Ella und ich sitzen am Fenster zum Parkplatz. Thomas' Platz liegt gegenüber, mit Blick auf die Straße. Zwei leere Schreibtische an der Wand. Und Christels Schreibtisch, direkt vor der Tür zum Chef.
Theo verschwindet hinter seinem Monitor, vertieft sich in Tabellen und Kalkulationen. Ella lehnt sich zurück, wirft mir einen Blick zu und dann einen auf die Uhr.
„Ist es schon fünf?“
Ich verkneife mir ein Lächeln. „Viertel nach eins.“
Sie seufzt leise.
Für Ella wird es ein sehr, sehr langer Tag.
Kapitel 3
Nora
Während der kurzen Autofahrt von meinen Eltern zu unserem Haus lausche ich Olivers Geschichten. Begeistert erzählt er von zwei Schwänen, die sich direkt vor dem Haus der Großeltern im Graben ein Nest gebaut haben. „Wenn man sie jeden Tag mit Brotresten füttert, werden sie zu Freunden, dann sind sie gar nicht mehr unheimlich“, erklärt er fröhlich. Dann erzählt von den süßen, köstlichen Pfannkuchen, die Großmutter mittags macht. Vom Angeln mit Großvater am selben Teich. „Langweilig“, gesteht er mir flüsternd, „aber das sage ich Großvater nicht, weil er so lieb ist.“
Sein Geplapper berührt mich. Zutiefst sogar.
Oliver ist acht und verbringt die meisten seiner Sommerferien bei meinen Eltern, weil wir dieses Jahr nicht verreisen können. Eine Entscheidung, die mir noch immer Schuldgefühle bereitet.
Doch die Hochzeit, das sündhaft teure Kleid, das Schloss als Location und das Abendessen für die Gäste haben unser Budget strapaziert. Schlichter und bescheidener wäre besser gewesen. Doch ich hatte so lange auf diese Hochzeit gewartet, ich wollte alles richtig machen. Schließlich heiratet man nur einmal. Nächstes Jahr, schwöre ich mir, werden wir wieder verreisen. Doch genau jetzt, in diesem Moment, wirkt Oliver bei meinen Eltern vollkommen glücklich.
Als ich in unsere Straße einbiege, sehe ich Thomas’ Auto bereits in der Einfahrt stehen.
„Schau mal, Papa ist da“, sage ich zu Oliver.
Doch er reagiert kaum, springt beim Öffnen der Haustür aus dem Auto, eilt sofort in sein Zimmer und startet seine Playstation.
„Du darfst aber nur fünfzehn Minuten spielen!“, rufe ich ihm hinterher.
Ich gehe langsam die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Ich möchte raus aus der Bürokleidung, raus aus dem Alltag, raus aus allem. Als ich das Schlafzimmer betrete, bleibe ich abrupt stehen. Mitten im Raum steht ein geöffneter Koffer. Daneben ein zweiter, beklebt mit Erinnerungen an unsere gemeinsamen Reisen. Auf dem Bett liegt Thomas’ Kleidung, ordentlich gefaltet und akribisch sortiert.
„Was machst du da? Hast du einen Geschäftstermin?“, frage ich, obwohl ich instinktiv spüre, dass da mehr ist, viel mehr.
Thomas antwortet nicht. Stattdessen taucht er tiefer in den Kleiderschrank ein, wirft einen weiteren Stapel Poloshirts in den Koffer. Eisige Angst breitet sich in meiner Brust aus. Nicht schon wieder. Bitte, nicht schon wieder.
„Thomas! Was machst du denn da?“, herrsche ich ihn an.
Mit einem tiefen Seufzen schließt er die Schranktür. „Genau das wollte ich vermeiden: eine Szene. Ich ertrage das nicht mehr.“
„Welche Szene?“ Meine Stimme bebt.
„Hör zu. Ich habe lange darüber nachgedacht. Unsere Beziehung funktioniert einfach nicht mehr. Ich bin nicht glücklich. Ich bin vierzig, erst vierzig. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens unglücklich verbringen. Es ist nicht zu spät, neu anzufangen. Für keinen von uns. Glaub mir, es ist besser so.“
„Aber ich bin glücklich! Thomas, bitte tu das nicht!“
„Es geht immer nur darum, was du möchtest, oder? Du wolltest zusammenziehen. Ein Kind. Ein Haus kaufen. Heiraten. Immer geht es nur darum, was Nora möchte. Aber ich will das nicht mehr! Ich wünsche mir ein anderes Leben, bevor es zu spät ist.“
„Hast du eine andere?“, frage ich mit erstickter Stimme.
„Nein. Es gibt niemanden sonst. Ich weiß, das übersteigt vermutlich deine Vorstellungskraft, aber ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich einfach so treffen, ohne jeden Satz in ein schlüpfriges Kichern zu verwandeln. Nicht alle Gespräche finden auf dem geistigen Niveau deiner Stammtischrunde statt. Ich bin einfach nicht glücklich mit diesem Leben. Das ist ein viel triftigerer Grund als ein Seitensprung. Und meine Eltern unterstützen mich übrigens vollkommen dabei.“
Mir bleibt die Luft weg. „Deine Eltern! Natürlich. Die mochten mich noch nie. Daher also der Wind. Wie kannst du nur so grausam sein?“
Er tritt näher, so nah, dass ich jedes Detail in seinen Augen sehen kann, sogar die kleinen Sprenkel im Blau. Aber vor allem sehe ich
Eisige Kälte.
„Das ist meine Entscheidung. Und ich bin froh, dass sie hinter mir stehen.“
„Aber Thomas, wir sind doch erst seit sechs Monaten verheiratet! Wie kannst du da behaupten, du wärst nicht glücklich?“
„Du weißt, dass ich die Hochzeit nicht wollte. Aber du musstest unbedingt heiraten, deine Liste abarbeiten. Ich hatte genug von deinem ständigen Drängen, also habe ich zugestimmt. Jetzt bereue ich es. Uns bleibt nur die Scheidung.“
Er wendet sich ab. Dieser Mann, der zehn Jahre lang jede Nacht neben mir lag. Der mir erst vor sechs Monaten in der Kapelle das Jawort gab. Der Vater meines Sohnes. Der jetzt alles als Fehler bezeichnet.
„Und was ist mit Oliver?“, frage ich leise, beinahe flüsternd.
„Es ist besser für den Jungen, Eltern zu haben, die getrennt und glücklich sind, als in einem Haus aufzuwachsen, in dem beide nur noch nebeneinanderher leben. Wir fliegen wie zwei Vögel um ein Körnchen Glück.“
„Thomas, wir machen doch alles gemeinsam! Wir sind eine normale Familie. Bitte, triff keine voreiligen Entscheidungen!“
Er sieht mich fest an. „Weißt du, was das Problem ist, Nora?“ Er legt seinen blauen Lieblingspullover in den Koffer und klappt ihn mit Nachdruck zu. „Du langweilst mich. Als ich dich mit fünfundzwanzig kennenlernte, warst du süß und offen. Aber heute? Heute hast du keinen Ehrgeiz mehr. Du gibst dich mit allem zufrieden. Zehn Jahre im selben Job ohne Gehaltserhöhung? Kein Problem. Jedes Jahr dasselbe All-inclusive-Hotel in Spanien? Nora nennt es vertraut. Neue Möbel? Nur wenn die Alten zusammenbrechen. Selbst unser Sex ist vorhersehbar bis ins Detail. Weißt du, wie müde das macht? Schau dich doch an. Du bist nicht mehr sexy. Du bist so übertrieben mütterlich.“
Meine Atmung setzt aus. Die Luft bleibt mir stecken, irgendwo zwischen Hals und Brust. Das Blut rauscht in meinen Ohren, alles andere klingt weit entfernt.
Ich sehe, wie Thomas mir einen letzten, flüchtigen Blick zuwirft, als wäre ich ein streunender Hund am Eingang eines Supermarkts. Er dreht sich um, nimmt den Koffer, zieht ihn über den Flur zur Treppe. Ich höre das Quietschen der Rollen, die zuschlagende
Haustür und das vertraute Geräusch seines startenden Autos.
Ich bete noch immer, dass alles nur ein schlechter Scherz ist.
Doch als Oliver mit großen, verängstigten Augen oben an der Treppe steht, begreife ich, dass es keiner ist.
„Mama, wo ist Papa denn hin?“
Kapitel 4
Nora
Noch nie habe ich dieses verdammte Sofa so sehr bereut wie jetzt. Unser solides Ledersofa, flankiert von zwei Sesseln. Pflegeleicht, praktisch. Hätte ich es nur nie ins Haus geholt.
Damals, in unserer ersten Wohnung, stand ein grünes Sofa, unbequem, aber voller Erinnerungen. Wir liebten uns überall, jeden Tag. Als Oliver kam, musste es weichen. Thomas verliebte sich in ein riesiges Lounge-Modell, halbes Wohnzimmer groß. Ich legte ein Veto ein. Am Ende wurde es das Ledersofa.
Vielleicht säße Thomas noch hier, hätte ich damals ja gesagt. Aber ich bin nicht abenteuerlustig. Und so sitzt mir nun Ella gegenüber. Glas Wein, mürrischer Blick.
„Was hast du Oliver gesagt?“
„Dass sein Vater verreist. Was soll ich ihm sonst sagen, wenn Thomas wortlos verschwindet?“
„Gut, dass deine Eltern ihn gleich nehmen konnten.“
„Ja, aber du weißt, er ist der Richtige.“
„Wer? Oliver?“
„Thomas.“ Ich stelle mein Glas zu hart ab. „Ich bin langweilig. Ich mag keine Veränderungen. Er wollte Roadtrips durch Italien und Südfrankreich, ich sagte immer nein. Stattdessen: Marbella. Sechs Jahre.“
„Warum?“
Ella reist jedes Jahr allein nach Asien. Angst kennt sie nicht.
„Ich mag keine Autofahrten. Zu lang, zu viele Irre auf der Straße. Und keine Tankstelle in Sicht, wenn man dringend muss.“
Ella gluckst. Ich sehe es. Und kann heute nicht mitlachen.
„Lach ruhig. Es ist lächerlich.“ Ich atme tief. „Ich werde mich ändern. Wenn Thomas zurückkommt.“
„Glaubst du, er kommt zurück?“
„Ja.“ Ich klinge entschlossener, als ich mich fühle. Zu siebzig Prozent glaube ich es. Die restlichen dreißig zerreißen mir den Magen.
„Nora, ich meine es nur gut. Aber…“
„Dann sag’s nicht.“ Ich unterbreche sie. „Er hat das schon einmal getan. Nach Olivers Geburt. Nach der Kündigung. Er ist impulsiv. Kommt mit Druck nicht klar.“
Ich trinke einen Schluck lauwarmen Wein. Ich will glauben, dass er zurückkommt. Aber heute war etwas anders. Härter. Kälter.
„Und was ist dieses Mal der Auslöser?“
„Vielleicht eine Midlife-Crisis. Alte Klassenkameraden, Erfolge, Statussymbole. Es nagt an ihm.“
„Und du? Hast du nie gedacht, du wärst ohne ihn besser dran?“
„Ich brauche keinen besseren Mann. Ich will Thomas.“
Wie ich das Ledersofa wollte. Und das Resort in Marbella. Ich mag mein Leben. Ich möchte Normalität für Oliver. „Was ist daran falsch?“
„Gar nichts. Solange du dich dabei nicht verlierst.“ Sie stellt das Glas ab, steht auf. „Wenn du mich brauchst – du weißt, wo ich bin.“
Beim Hinausgehen berührt sie meinen Arm. Ein stilles: „Ich bin da.“
Ich schlucke. Dann überfällt mich ein Gedanke. „Ella?“
Sie dreht sich um. „Ja?“
„Wie sieht’s morgen im Büro aus?“
Sie zuckt die Schultern. „Thomas ist unterwegs. Und selbst wenn, ihr redet ja kaum.“
„Soll ich Theo einweihen?“
Sie verzieht das Gesicht. „Tu’s nicht. Wenn er’s weiß, wird er dich beobachten. Und das willst du nicht.“
Ich schweige. Aber Ella weiß es ohnehin.
*
Meine Eltern sind in sechsunddreißig Ehejahren achtmal umgezogen. Jetzt wohnen sie in einer Neubausiedlung, Erdgeschoss, kleiner als je zuvor. Der Garten ist groß genug für vier Kinder.
Ich schiebe den Vorhang in Mamas Küche zur Seite. Draußen warten Schwäne auf Brot. Oliver angelt mit meinem Vater am Steg.
„Wann redest du mit Thomas?“, fragt Mama, während sie Gurken schneidet.
„Keine Ahnung.“
Das Messer verstummt.
„Was heißt das? Was habt ihr besprochen?“
Ich lasse mich auf einen Küchenstuhl sinken. Greife nach einer Gurkenscheibe.
„Ich möchte es gar nicht wissen.“
Eine Lüge. Der Teil von mir, der hofft, möchte es genau wissen. Der andere fürchtet sich. Hoffnung tut weniger weh als Wahrheit.
„Nora…“ Mama nimmt die Brille ab. Ihre Augen: blau. Meine: dunkel wie Papas oder Großmutters Augen.
„Wir haben dich nie bevormundet. Aber du bist fünfunddreißig. Noch ist alles offen. Aber das hängt von deinen Entscheidungen ab.“
Ich stehe auf. Trete ans Fenster. Warum machen sich alle Sorgen? Warum kann mein Leben nicht so einfach sein wie das der Schwäne?
„Setz dich, Nora.“ Ihre Stimme klingt wie früher, wenn ich ungezogen war.
„Da gibt’s nichts zu besprechen.“
Ich beobachte, wie sie das Brett abspült.
„Thomas wird sich beruhigen. Er kommt zurück. Du kennst ihn.“
„Eben deshalb sage ich etwas dazu. Wie oft willst du ihn noch zurücknehmen? So jemand ist kein Fels, kein Fundament. Willst du in ständiger Unsicherheit leben?“
Ihr Gesicht ist gerötet, ungewohnt. Normalerweise ist sie beherrscht. Krankenschwester eben.
„Mama…“
„Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Zehn Jahre hast du hinter ihm gestanden. Immer verständnisvoll. Wann stellst du dich endlich an erste Stelle?“
„Ich liebe Thomas. Er ist Olivers Vater. Zweifel gehören dazu.“
Ich lüge. Sie merkt es. Sagt nichts.
„Wie du dich entscheidest, wir stehen hinter dir. Aber diesmal wollte ich es sagen. Übrigens: Morgen räumen wir Großmutters Haus aus. Neun Uhr.“
Ein Samstag voller Gerümpel? Ich finde keine gute Ausrede.
„Okay.“
„Mama, Oma! Wir haben einen riesigen Fisch gefangen!“ Oliver steht strahlend in der Tür, zeigt mit beiden Armen die Größe.
Ich schmunzle, hole die Teller.
„Wasch dir die Hände, Schatz. Ruf Opa, es gibt Essen.“
Kapitel 5
Nora
„So, das brauchte ich jetzt mal kurz.“
Mit einem dumpfen Schlag stellt meine Mutter ihre leere Tasse auf den Tisch. Großmutters alter Holztisch. Noch vor wenigen Wochen saß sie hier, nahm ihre kargen Mahlzeiten ein, las, schaute aus dem Fenster, ein stiller Schatten, der das Leben betrachtete, ohne selbst darin stattzufinden.
Dieses Haus war immer leise. Der Fernseher seit Jahren defekt, das Radio vermutlich nie eingeschaltet. Großmutter liebte die Ruhe. Vielleicht mehr als jede Gesellschaft.
Ich kippe den letzten kalten Rest Kaffee in meine Tasse und versuche, mich zu erinnern, wann ich sie zuletzt gesehen habe. Wahrscheinlich am Tag meiner Hochzeit. Sie sah mich an, als würde sie einen Geist erblicken. War das ein Zeichen?
Ich hatte mir oft vorgenommen, sie zu besuchen. Doch dann kam immer etwas dazwischen: Elternabend, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder schlicht keine Lust. Und weil Großmutter nie etwas sagte, wuchs die Schuld still wie Staub in den Ecken.
Die Stimme meiner Mutter holt mich zurück: „Sollen wir weitermachen? Ich möchte bis vier fertig sein. Vielleicht noch etwas Sonne im Garten, grillen. Oliver liebt Dads Speckstreifen.“
Draußen zieht Oliver gerade einen kleinen Hocker aus dem Haus, jenen, der immer neben Großmutters Bett stand. Er stellt ihn neben den Müll.
Seufzend erhebe ich mich. Ich habe kaum geschlafen, könnte eine weitere Tasse Kaffee vertragen. Aber wenn Mama entschlossen ist, gibt es kein Entrinnen.
Im Sonnenlicht wirkt Großmutters Schlafzimmer fremd. Die Vorhänge fehlen, die Tapete blättert, ein Wasserfleck zieht sich durch die Decke. Der Teppich ist ein fleckiges Archiv.
„Nächste Woche kommt der Makler.“ Mama reißt das Fenster
auf. Die Scharniere ächzen. „Ich hoffe, er kann das Haus loswerden.
Renovieren lohnt nicht. Die Käufer reißen ohnehin alles raus.“
Ich nicke. Seltsam, in diesem Zimmer zu stehen. Noch seltsamer: der Gedanke, dass es einer der letzten Momente in diesem Haus sein wird. Wer wird es kaufen? Ein junges Paar? Eine geschiedene Mutter? Der Gedanke kriecht kalt über meinen Rücken.
Während Mama systematisch den Kleiderschrank räumt, wachsen drei Haufen: Heilsarmee, Müll, Unentschieden. Der letzte ist der größte, ein Berg aus Zweifeln.
„Warte!“ Ich entreiße ihr eine braune Strickjacke. Ich drücke sie an mich. Diese Jacke war Großmutter. Ich sehe sie vor mir, am Küchentisch, emotionsloses Lächeln.
Der Wasserkocher pfeift. Wir haben nie tief gesprochen, bis zu diesem einen Moment vor meiner Hochzeit. Ich weinte. Sie umarmte mich. Still. Wortlos.
Ich versuche, mich an ihren Geruch zu erinnern. Nichts. Kein Parfüm. Kein Waschmittel. Nicht mal der Duft alten Lebens. Als wäre sie nie ganz da gewesen.
„Jesus, Nora, wir haben nicht ewig Zeit.“
Mamas Blick ist genervt. Er sagt: „Du warst ihr fern, warum jetzt Nähe heucheln?“ Ich lege die Jacke neben meine Tasche. Sie schweigt.
„Ich frage mich, wieviel das Haus aufbringen wird.“ Sie wirft Baumwollunterwäsche in einen Müllsack. „Zu klein, zu alt. Wer will sowas?“
„Ist es abbezahlt?“ Ich hebe einen alten Wintermantel auf, lege ihn zum Zweifel-Stapel.
„Schon lange. Großmutter konnte mit Geld umgehen. Kannst du auf dem Dachboden nachsehen?“
Ich nicke und verlasse den Raum. Die Bodentreppe klemmt, ächzt beim Ausklappen. Niemand war seit Jahrzehnten hier oben. Zu staubig, zu dunkel. Ich niese. Ein Lichtstrahl durch das kleine Fenster zeichnet geisterhafte Konturen. Und doch, ich muss schmunzeln.
Spielzeug. Ein Teddy mit nur einem Ohr, Spielzeugautos, alte Schulbücher. Ich bin Großmutter ähnlicher, als ich dachte. Während Mama wegwirft, bewahre ich. Für später. Für das Gefühl.
Unter der Schräge: Großvaters Kleidung. Ordentlich gefaltet. Sie konnte sich nicht trennen. Zwischen vergilbten Papieren entdecke ich ein Möbelstück, einen alten Schminktisch ohne Spiegel. In den Schubladen: Schulzeugnisse, Kinderzeichnungen meines Vaters. Ruhige Linien. Der spätere Architekt kündigt sich an.
Dann sehe ich es. Ein schmales Holzkästchen. Verwittert, fast vergessen. Ich nehme es in die Hand. Ein leises Klirren darin, wie ein flüchtiger Atemzug der Vergangenheit. Das Schloss springt auf. Ein schmaler Metallring. Ein silberner Davidstern. Ein vergilbtes Dokument. 1923. Eine Sprache, die ich nicht lesen kann. Ich nehme alles mit nach unten.
Der Schrank ist leer, seelenlos. Müllsäcke stapeln sich an der Wand. Mama sitzt auf dem Bett, sortiert den Nachttisch.
„Schau mal, was ich gefunden habe.“ Ich reiche ihr das Kästchen.
„Modeschmuck? Kann weg.“
„Und der Stern? Der Ring?“ Ich ziehe das Dokument hervor. Die Schrift wirkt fremd, geschwungen. Kyrillisch?
„Vielleicht gehörte es jemandem, der hier mal war. Ich habe auch noch Bücher einer ehemaligen Kollegin im Haus.“
Sie nimmt eine Lesebrille vom Nachttisch und wirft sie samt Paracetamol-Streifen in den Müll.
„Wenn ich nur lesen könnte, was da steht…“
„Nora.“ Ihre Stimme ist müde. „Können wir abschließen? Ich möchte einfach nur einen stillen Abend auf der Terrasse. Rosé. Sonne. Kein Gerümpel.“
Ich weiß, Protest ist sinnlos. Ich schnappe mir eine neue Rolle Müllsäcke und gehe zurück auf den Dachboden.
Das Kästchen schiebe ich unter Großmutters Strickjacke. Die liegt neben meiner Tasche. Wartend. Wie eine Erinnerung, die nicht vergeht.
Kapitel 6
Juni 1941
Hannah
Der klapprige Lieferwagen schnauft und ächzt auf den letzten Kilometern nach Glusk. Jedes Mal, wenn eines der Räder ein Schlagloch erwischt, sieht es aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Ich denke kurz, dass es schneller wäre, auszusteigen und zu Fuß zu gehen, und muss bei dem Gedanken lächeln.
Die Sonne, die durch das schmutzige Fenster scheint, wärmt mein Gesicht. Ich bin müde, ja, erschöpft. Das monatelange Pauken für die Prüfungen hat seinen Tribut gefordert. Jetzt, da die Prüfungszeit vorbei ist, fühle ich mich ausgelaugt, leer, aber stolz.
Trotz der Judenquote wurde ich zum Studium zugelassen und habe mit Auszeichnung bestanden. Für mich bedeutete das Leben als Studentin in Minsk keine Feiern, keinen Wohnheimspaß, keine Spickzettel und keine Dozenten, die mal ein Auge zudrücken. Was für die anderen selbstverständlich war, war für mich verboten oder unerreichbar.
Jetzt, zehn Stunden Fahrt von der Hauptstadt entfernt, scheint dieses Leben wie aus einer anderen Welt. Ich sehe auf die Wälder, die sich allmählich lichten, auf die Felder, auf die vertrauten Kurven der Straße und fühle mich plötzlich leicht.
Heimkommen. Endlich. Maisfelder und grüne Wiesen ziehen vorbei, Kühe grasen, mein Herz klopft schneller. Glusk ist nah. Die alte Frau neben mir, die stundenlang schweigend verharrt hat, beginnt nun, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzuraffen. Noch bevor der Wagen ganz zum Stehen kommt, habe ich meine Reisetasche gegriffen und stehe erwartungsvoll an der Tür. In der Ferne erkenne ich Maikas Gesicht: vertraut, geliebt, lange vermisst.
Mein Herz wird leicht. „Maika! Herzlichen Glückwunsch! Warum hast du mir nicht geschrieben?“ Ich umarme meine Schwester vorsichtig. Ihr Bauch ist noch klein, kaum sichtbar, aber ihr Lächeln verrät alles.
„Ich wollte dich überraschen.“ Sie strahlt.
Ich halte sie an den Schultern, betrachte sie. Als ich letzten August nach Minsk ging, war sie frisch verheiratet, schlank wie ein Schwanenhals. Jetzt ist sie weich geworden, rund um die Hüften, das Gesicht voller, pralle Brüste.
Vor Rührung breche ich in Tränen aus, vergrabe mein Gesicht in ihren Locken.
„Na, na, das ist doch kein Grund zu weinen“, sagt Maika, doch ich spüre, wie auch sie zittert.
„Wann bist du fällig?“
„Ende Dezember.“
„Mark und du habt euch nicht viel Zeit gelassen.“
„Nein, bestimmt nicht.“ Sie zwinkert mir zu. Maika kennt meine Neugier auf alles, was mit Eheleben zu tun hat. Vielleicht erzählt sie mir ja später mehr.
„Komm, lass uns gehen. Mama macht deine Lieblingsspeise: Kartoffelpuffer. Und du weißt: Die muss man heiß essen, direkt aus der Pfanne.“
Ich bin hungrig. Die lange Reise steckt mir in den Knochen. Ich werfe mir die Tasche über die Schulter. Maikas Angebot, sie zu tragen, lehne ich entschieden ab. Eine Stunde später sitzen wir am Tisch meines Elternhauses. Ein Berg Kartoffelpuffer steht vor mir. Ich bin umgeben von Menschen, die ich zehn Monate lang schmerzlich vermisst habe.
Mama sitzt neben Maika und schaut mich immer wieder an, als könne sie nicht glauben, dass ich wirklich hier bin. Meine Brüder, zwei pickelige Halbwüchsige mit eckigen Armen, benehmen sich so, als sei ihr Essen spannender als meine Rückkehr. Aber ich merke, wie sie mir verstohlene Blicke zuwerfen. Vor allem starren sie auf die Tasche mit den Geschenken aus der großen Stadt.
Anouschka, unsere kleine Nachzüglerin, sitzt neben mir. Drei Jahre alt, große blaue Augen. Sie kann sich nicht an mich erinnern, als ich fortging. Für sie bin ich eine Fremde, aufregend und fremd zugleich. Großvater sitzt wie immer im Stuhl am Fenster zum Garten, die Hände im Schoß gefaltet. Der Garten ist seine Welt. Vom Frühling bis in den späten Herbst werkelt er dort, versorgt uns mit Obst und Gemüse. Großmutter war für die Blumen zuständig. Und für die Erdbeeren.
Ich erinnere mich noch genau an die Abende meiner Kindheit: Großmutter pflückte Erdbeeren, stellte sie in einer großen Schale auf den Tisch. Die Küche duftete süß und warm. Wir rissen die grünen Kronen ab und schlangen sie hastig herunter. Die Jungs wollten immer die Größten, Maika und ich hingegen wussten: Die Kleinen sind die Süßesten. Früher sagte Großvater oft, dass er am liebsten eines Tages im Garten tot umfallen würde. Heute macht er keine Witze mehr. Seit Großmutters Tod ist seine Lebensfreude verschwunden, zusammen mit seinen Tränen.
Papa ist noch bei der Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, ihm mein Prüfungsheft zu zeigen. Er war es, der Mama überredet hat, mich nach Minsk ziehen zu lassen. Jetzt möchte ich ihm beweisen, dass seine Entscheidung richtig war.
„Hannah, warum hast du dir denn den Zopf abschneiden lassen?“ Mama tadelt. Sie trägt ihr Haar noch immer wie eine Krone, wie damals, als sie noch achtzehn war. Papa sagt oft, er habe sich in ihren Zopf verliebt.
Ich sehe in ihren Blicken, dass sie mein schulterlanges Haar insgeheim mag. Sie möchte es nur nicht zeigen. Trotz ihrer 43 Jahre und fünf Geburten ist sie die schönste Frau, die ich kenne. Eine Schmiedetochter, die es nur bis zur Mädchenschule geschafft hat, aber mit der Eleganz einer Professorin.
„Da ist sie ja, meine kluge Hannah.“ Papa steht in der Tür. Sein Lächeln ist breit wie immer, aber die grauen Schläfen und die Falten auf seiner Stirn erschrecken mich.