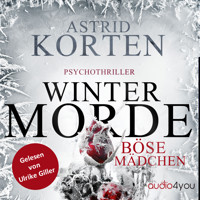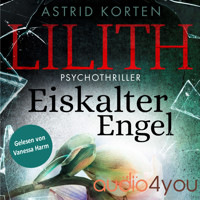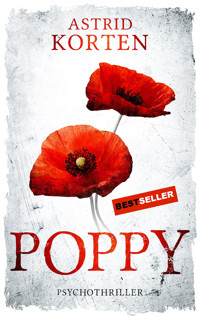4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erste Stimmen zu ZWEI LEBEN - Das Versprechen: „Überwältigend.“ „Eine Geschichte voller Hoffnung.“ „Tiefgehend und unvergesslich.“ „Mitreißend erzählt.“ „Authentisch und berührend.“ „Meisterhaft verwobene Zeitstränge.“ „Geht direkt ins Herz.“ 2014. Ein Winter in Brügge. Auf dem Kopfsteinpflaster, den Kanälen und den alten Fassaden haucht der Frost seinen Atem. Die Stadt schweigt. Juna auch. Sie ist erschöpft. „Ein Burn-out“, sagen die Ärzte. „Ein Zusammenbruch“, sagt Juna. Alles um sie herum ist still. Das Jetzt: kalt und unbewegt. Um sich nicht zu verlieren, beginnt sie, als ehrenamtlicher Buddy zu arbeiten. So trifft sie Vincent Molen, einen alten Mann, wortkarg und verschlossen. Ihre Begegnungen sind flüchtig: ein Spaziergang, eine Tasse Tee, ein paar brüchige Worte. Doch die Stille zwischen ihnen ist dicht und allmählich entsteht eine leise Verbindung: ein Blick, ein vergilbtes Foto, ein Satz, der bleibt. Mit jedem Ausflug wächst Junas Zuneigung für Vincent. Während sie ihm zuhört, entfaltet sich Stück für Stück Vincents Leben, das von Mut geprägt, von Verlust gezeichnet und von einer großen Liebe getragen ist. Etwas in seiner Geschichte ruft auch in Juna Erinnerungen wach. Sie spürt, dass da noch mehr ist. Etwas Ungesagtes, ein Schatten in seinem Blick. Eine Wahrheit, die ans Licht will. Juna stößt auf die Spuren eines gebrochenen Versprechens… Ein Roman gegen das Vergessen, leise wie ein Flügelschlag und doch so berührend wie die stille, unerschütterliche Kraft der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
2014. Ein Winter in Brügge. Auf dem Kopfsteinpflaster, den Kanälen und den alten Fassaden haucht der Frost seinen Atem. Die Stadt schweigt. Juna auch. Sie ist erschöpft.
„Ein Burn-out“, sagen die Ärzte.
„Ein Zusammenbruch“, sagt Juna.
Alles um sie herum ist still. Das Jetzt: kalt und unbewegt. Um sich nicht zu verlieren, beginnt sie, als ehrenamtlicher Buddy zu arbeiten. So trifft sie Vincent Molen, einen alten Mann, wortkarg und verschlossen. Ihre Begegnungen sind flüchtig: ein Spaziergang, eine Tasse Tee, ein paar brüchige Worte. Doch die Stille zwischen ihnen ist dicht und allmählich entsteht eine leise Verbindung: ein Blick, ein vergilbtes Foto, ein Satz, der bleibt. Mit jedem Ausflug wächst Junas Zuneigung für Vincent.
Während sie ihm zuhört, entfaltet sich Stück für Stück Vincents Leben, das von Mut geprägt, von Verlust gezeichnet und von einer großen Liebe getragen ist. Etwas in seiner Geschichte ruft auch in Juna Erinnerungen wach. Sie spürt, dass da noch mehr ist. Etwas Ungesagtes, ein Schatten in seinem Blick. Eine Wahrheit, die ans Licht will.
Juna stößt auf die Spuren eines gebrochenen Versprechens…
Ein Roman gegen das Vergessen, leise wie ein Flügelschlag und doch so berührend wie die stille, unerschütterliche Kraft der Liebe.
Für meine Mutter Elisa
Die aus jedem Bruchstück ihres Lebens
ein Mosaik aus Glück machte.
Vorwort der Autorin
Ich habe Esther, meine Großmutter mütterlicherseits, nie gekannt.
Ihr Gesicht kenne ich nur von einem verblassten Foto, das meine Mutter in einem Tagebuch aufbewahrt hat, zusammen mit einem Brief, dessen Tinte an manchen Stellen so blass geworden ist, dass die Worte wie ein ferner Hauch wirken, kaum mehr greifbar.
Dies ist nicht nur Esthers Geschichte. Die Geschichte gehört auch zu meiner Mutter Elisa. Sie hat sie mir erzählt, manchmal stockend, als müsste sie die Sätze vorsichtig aus der Erinnerung lösen, manchmal in einem plötzlichen Fluss, als könne das Erzählen die Jahre zurückholen. Mom starb vor vielen Jahren. Sie machte aus jedem Bruchstück ihres Lebens ein Mosaik aus Glück.
„ZWEI LEBEN-Das Versprechen“ ist die Geschichte dessen, was bleibt, wenn ein Leben gewaltsam unterbrochen wird: Fragmente, Bilder. Und die Stimme einer Großmutter, einer Tochter und einer Enkelin, die sie weitergeben, damit sie niemals verstummt.
Und so beginnt, was von ihr geblieben ist…
PROLOG
„Esther, wach auf!“
Die Worte dringen leise durch die Dunkelheit meiner Träume, und doch tragen sie das Gewicht einer nahenden Katastrophe. Ich spüre den starken Ruck an meiner Schulter, so abrupt, dass mein Herz beinahe stillsteht. Mein Blick ist verschwommen, mein Körper träge vom Schlaf.
Da ist ein unangenehmes Ziehen in meinem Nacken, dann wieder dieses Rütteln an meiner Schulter, heftig und panisch. Ich öffne die Augen.
Habe ich verschlafen? Nein, das Zimmer liegt noch im Dunkeln. Der Mondschein dringt schwach durch das Fenster und zeichnet blasse Silhouetten an die Wände.
Dann sehe ich sie: Lena, eine stille, fast unwirkliche Präsenz im Türrahmen. In ihrem langen weißen Nachthemd erinnert sie mich an einen verlorenen Geist, doch ihr Blick sagt alles: eine funkelnde, klaustrophobische Angst und die lauernde Gewalt vor dem Haus. In diesem Moment ist sie mehr als nur eine Verwandte. Sie ist mein einziger Halt in einer Welt, die sich ihrer Schrecken und Dunkelheit zusehends bewusst wird.
„Sie sind hier. Du musst sofort von hier verschwinden, Esther! Jetzt.“
Die Worte stürzen über mich herein und rauben mir beinahe den Atem. Noch wehrt sich mein Geist gegen diese unvorstellbare Realität, aber mein Körper gerät bereits in Alarmbereitschaft.
Ich will fragen: „Wer?“, doch meine Stimme verweigert sich, die Worte werden in der Angst erstickt.
Mit zittrigen Händen greift Lena nach meinem Kleid und dem Schal auf dem Stuhl und drückt mir beides in die Hand, während der Klang eines tiefen, unheilvollen Grollens meine Sinne durchdringt. Es ist das Dröhnen von Motoren, ein Klang, der nicht nur eins, sondern mehrere Fahrzeuge ankündigt. Zwei, drei oder vielleicht noch mehr. Ein flüchtiger Gedanke an die bedrückende Propaganda, die wir aus den Lautsprechern gehört hatten, jagt mir eine Schauerwelle über den Rücken.
„Schnell, Esther!“
Lenas Stimme ist fest und klar, als wäre sie der Gegner in einem Albtraum, der jeden Moment zuschlagen könnte.
Ihre Worte hallen in mir nach: ein Aufruf zu einem Fluchtversuch, der ebenso verzweifelt wie entschlossen klingt.
„Bevor sie das Haus umstellen“, sagt sie. Hastig wirft sie mir das Kleid über den Körper und zieht mir fast unmerklich die Schuhe an. Jeder Schritt kommt mir vor wie der Bruchteil einer Ewigkeit, während wir die knarrende Treppe hinabeilen. Der Klang des alten Holzes erinnert mich an vergangene Zeiten, in denen solche Geräusche vielleicht noch von einem einfachen Leben zeugten, ohne die schwere Last dieser grauenvollen Zeit. Unten wird die Haustür aufgestoßen, das Licht trifft uns mit blendender Wucht, ein grelles, unerbittliches Licht, das uns wie Zielscheiben entblößt. In diesem Augenblick ist alles eingefroren.
Während Lena mit einer Hand noch an der Klinke steht, drängt sich mein Blick ins Scheinwerferlicht, das uns regelrecht zerlegt. Ein Auto rollt in den Hof, seine Scheinwerfer durchdringen die finstere Nacht. Ihm folgt ein massiver Transporter, der die schiere Brutalität und Organisation der nationalsozialistischen Macht verkörpert. Die Reifen quietschen, Türen schlagen auf. Schatten reißen sich los und stürmen auf das Haus zu. Ich sehe Uniformen, schwere Stiefel, Waffen und kalte, kampfbereite Blicke. Die Geräusche um uns herum, die stampfenden Schritte, das Krachen splitternden Holzes und das ferne Jaulen eines Hundes vermischen sich mit den gespenstischen Stimmen der Vergangenheit.
„Komm.“ Lena zieht mich unaufhaltsam in die Küche, vorbei an einem Tisch, an dem wir erst gestern in Geborgenheit gesessen haben. Die Teetassen, stumme Zeugen eines ruhigen Moments, kippen um und zerspringen; jeder Klang ist ein Symbol für die zerbrechende Ordnung unserer kleinen Welt. Im Hinterzimmer reißt sie das Fenster auf und die kalte Nachtluft strömt herein, als wollte sie die letzten Reste unserer Zivilisation herausfordern.
„Lauf so tief wie möglich in den Wald. Bitte kein Licht. Gib keinen Laut von dir. Ich werde sie aufhalten, solange ich kann.“
In mir tobt ein innerer Konflikt: Einerseits ist da der Wunsch, zu bleiben und zu kämpfen, andererseits die vernichtende Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich schüttle den Kopf, unfähig, auch nur ein Wort zu formen, obwohl mein Geist laut protestiert.
Lena fasst mein Gesicht, drückt ihre Stirn an meine, und für einen kurzen, schmerzvollen Moment verweben sich Vergangenheit und Zukunft in einem stummen, letzten Kuss. In diesem Moment fließen alle Hoffnung und Verzweiflung in einem einzigen Atemzug zusammen.
Dann stößt sie mich behutsam, aber mit der Unausweichlichkeit eines Schicksals zum offenen Fenster. Hinter uns hören wir das Bersten von Holz und Stimmen, die unaufhörlich näherkommen. Instinktiv und doch von unendlicher Traurigkeit erfüllt, klettere ich hinaus.
Der Boden ist feucht, kalt und geradezu feindselig. Jeder Schritt, jeder Sturz ist ein weiterer Schwur in diesem ungewissen Tanz zwischen Überleben und Untergang.
„Lauf, Esther!“, höre ich ihre letzte Aufforderung, während ich mich weiter antreibe. „Bitte Gott, steh ihr bei!“
In diesem Moment, in dem ich zwischen den Schatten der Vergangenheit und der ungewissen Zukunft hin und hergerissen werde, bleibt mir nur die bittere Erkenntnis: Gott hört ihre Worte nicht.
Kapitel 1
Brügge, 2014
Juna
Die Koordinatorin der ehrenamtlichen Mitarbeiter heißt Katja Wessels. Sie trägt das freundliche Lächeln einer Großmutter, die ihre Enkelin zum Tee einlädt. Nur bin ich nicht ihre Enkelin und fühle mich in dem kleinen Büro des Gemeindezentrums, von dem ich bis vor ein paar Tagen noch nie gehört hatte, ein wenig fehl am Platz.
Büro ist vielleicht ein zu imposantes Wort für diesen Raum, mit einem Fenster, das auf einen Sportplatz hinausgeht. Es steht einen Spalt offen, lässt frische Luft herein und ein Crescendo aus Kinderstimmen. Katja scheint das nicht zu stören. Mit ruhiger Selbstverständlichkeit klappt sie einen Notizblock auf und legt einen sorgfältig gespitzten Bleistift bereit.
„Können Sie mir etwas über sich erzählen, Frau Fischer? Was führt Sie zu uns?“
Ihre Stimme ist warm, ihr Lächeln aufmunternd. Ich lächle zurück, immer noch überrascht, dass ich mich tatsächlich auf dieses unerwartete Vorstellungsgespräch eingelassen habe.
„Ich bin Juna Fischer, zweiunddreißig Jahre alt und“, ich zögere, „bin momentan aus gesundheitlichen Gründen nicht berufstätig.“
„Nichts Ernstes, hoffe ich?“ Katja runzelt besorgt die Stirn.
„Nicht wirklich“, antworte ich. „Ein Burn-out – die Krankheit unserer Zeit.“
Sie nickt verständnisvoll, obwohl ich bezweifle, dass sie je denselben Druck erlebt hat wie ich. Ich frage mich, ob sie mal in einem Großraumbüro saß, mit Meetings im Minutentakt und einem Postfach, das nie schlief.
„Geht es Ihnen jetzt besser?“, fragt sie sanft.
„Viel besser. In ein paar Monaten werde ich wieder arbeiten, aber bis dahin möchte ich die Zeit sinnvoll nutzen.“
Ich verschweige, dass es nicht meine Idee war. Mein Bruder hatte mir diese Tätigkeit nahegelegt, in einem jener Gespräche, die aus Sorge geboren werden. Ich hatte tagelang allein zu Hause gesessen und auf mein Handy gestarrt, das stumm blieb. Schließlich wählte ich die Nummer einer Stiftung, die Ehrenamtliche vermittelt. Und jetzt bin ich hier und frage mich, ob es ein Fehler war. Ob ich ein Buddy sein kann oder ob nicht vielmehr ich diejenige bin, die einen Buddy braucht, um wieder vor die Tür zu gehen.
„Was sind Ihre Beweggründe, sich ehrenamtlich zu engagieren?“, fragt Katja und macht sich eine Notiz.
„Meine Gründe?“ Ich zucke mit den Schultern. „Ich habe Zeit, und ich möchte sie sinnvoll nutzen, etwas für die Gesellschaft tun.“ Es klingt hohl, wie das Geplänkel eines Lokalpolitikers in Wahlkampfzeiten.
Doch Katja nickt anerkennend. Sie tippt mit dem Stift auf die Tischplatte, während draußen das Gekreisch der Kinder weiter durch das geöffnete Fenster dringt.
Sie legt den Bleistift beiseite. „Der Wunsch, zu helfen, ist ein lobenswerter Anfang, Juna. Es gibt viele, die unsere Unterstützung brauchen, wegen Krankheit, Alter oder einfach, weil sie allein sind. Wenn man nicht mehr Teil des Arbeitslebens ist, droht die Isolation, besonders ohne Familie in der Nähe. Das ist traurig und oft vermeidbar. Deshalb haben wir das Buddy-Programm ins Leben gerufen. Als Buddy begleiten Sie jemanden, der Hilfe oder Gesellschaft braucht. Manchmal ist es eine Autofahrt ans Meer oder zum Grab eines Angehörigen. Manchmal ist es eine Tasse Kaffee oder Tee, ein Spaziergang, ein Einkauf. Für viele ist schon die Aussicht auf ein Gespräch ein Lichtblick.“
Ich nicke. Ihre Worte holen Erinnerungen in mir hervor. Noch vor einem Jahr war mein Kalender vollgestopft mit Verabredungen für Wochen, Drinks nach Feierabend, Einladungen, Partys. Stets war jemand anwesend. Immer war ich jemand. Nach meinem Zusammenbruch erhielt ich zunächst zahlreiche Genesungswünsche, aber nach ein paar Wochen wurde es still. Und dann ganz still. Die Welt drehte sich weiter, nur ohne mich.
„Wir haben momentan drei Personen, für die wir Buddys suchen“, sagt Katja und wirft einen Blick auf ihren Bildschirm. „Es ist wichtig, dass es menschlich passt.“
Sie tippt leise, murmelt Namen, dann schaut sie mich an. „Einer der drei Kandidaten scheidet aus, da habe ich bereits jemanden im Auge. Bleiben zwei. Die erste ist eine junge Frau, etwa in Ihrem Alter. Sie ist unheilbar krank. Ihr Mann kümmert sich rührend. Allerdings ist er der Meinung, dass sie Unterstützung außerhalb der Familie benötigt. Eine Freundin. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt.“
Katjas Blick wird ernst, prüfend. Ich weiß nicht, was sie in meinem Gesicht zu lesen versucht. Ich weiß nur, dass mich diese Vorstellung lähmt. Noch ein Abschied. Bin ich dafür bereit?
„Und der dritte?“, frage ich leise.
„Ein älterer Herr. Dreiundneunzig. Er hat keine Angehörigen mehr. Er schätzt Spaziergänge, den Austausch von Gedanken, vielleicht eine Tasse Tee. Nichts Großes.“ Sie zögert, schaut mich an, als sei sie nicht sicher, ob ich die Geduld für diese einfache Aufgabe aufbringe. „Herr Molen hatte bereits mehrere Begleitpersonen. Es hat nie wirklich gepasst. Er ist speziell. Aber wir geben nicht auf.“ Sie lächelt und legt den Block zur Seite. „Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Wir speichern Ihre Daten und melden uns, wenn es etwas Passendes gibt. Einverstanden?“
Ich zögere. Begeisterung fühlt sich anders an. Aber ich habe Zeit und muss mich sinnvoll beschäftigen. „Ich mache es“, sage ich schließlich. „Ich versuche es mit Herrn Molen. Vielleicht klappt es ja.“
Sie nickt. „Ich rufe ihn später an und frage nach. Sie hören dann von mir. Übrigens, ich bin Katja, wir sind hier alle per Du.“
Wenig später sitze ich im Auto und fahre nach Hause. Ich hoffe, dass Vincent Molen mich nicht ablehnt. Ich bin neugierig. Vielleicht war es doch eine gute Entscheidung.
Kapitel 2
Brügge, 2014
Juna
Vincent Molen wohnt in der Nähe vom Beginenhof, in einer ruhigen Seitenstraße, die durch die vielen Bobbycars kinderfreundlich wirkt. Ich finde fast sofort einen Parkplatz und bin zu meiner eigenen Überraschung erstaunlich gut gelaunt, als ich vor seiner Haustür stehe. Bis ein rotes Fellknäuel mit atemberaubender Geschwindigkeit auf mich zurast. Im Schlepptau sein Herrchen, fast von der Leine gerissen.
„Sie ist harmlos“, ruft der Mann aus viel zu großer Entfernung. „Das macht sie sonst nie.“
Ich bleibe stehen. Doch statt sich an mein Bein zu lehnen oder mich anzuspringen, lässt sich das rote Fellbündel direkt vor meinen Füßen nieder, rollt sich mit gespreizten Pfoten auf den Rücken und… miaut.
Es ist eine Katze!
„Ginger, du bist eine Schlampe“, sagt der Mann atemlos.
„Ginger ist die störrischste Katze, die ich je hatte“, erklärt der Mann mit einem schiefen Lächeln. Er ist attraktiv, Mitte dreißig und hat ein offenes, angenehm entspanntes Gesicht. Als er von Ginger zu mir aufblickt, lächelt er wieder.
„Ich dachte, es wäre ein Hund“, erwidere ich. „Wegen der Leine.“
„Man kann Ginger nicht trauen. Ohne Leine wäre sie bereits am Meer. Ich mag ihre Gesellschaft zu sehr, um das zu riskieren.“ Dann schaut er zur Haustür. „Werden Sie erwartet?“
„Ja. Ich besuche Vincent Molen.“
Sein Lächeln wird breiter. „Wunderbar. Der alte Vincent bekommt selten Besuch. Gehören Sie zur Familie?“
„Nein…“ Ich zögere. Es fühlt sich plötzlich seltsam an, zu sagen, dass ich ehrenamtlich hier bin, als hätte ich mich für eine Aufgabe gemeldet, die von anderen gemieden wird. „Wir gehen nur eine Weile spazieren. Wenn es gut läuft, schaue ich jede Woche vorbei.“
„Aha.“ Der Mann streckt die Hand aus. „Ich bin Florent Schubert. Ich wohne in der Wohnung über Vincent.“
„Juna Fischer.“ Ich schüttle seine Hand. Trotz der Hitze und der kleinen Verfolgungsjagd hinter Ginger ist sie angenehm trocken.
„Ich öffne Ihnen die Tür. Ginger, komm!“
Ginger bleibt demonstrativ auf dem Rücken liegen, die Pfoten zum Himmel gestreckt. Florent seufzt, bückt sich und hebt die Katze hoch.
„Vielleicht hätte ich einen Goldfisch kaufen sollen. Oder einen Kaktus“, sagt er und streichelt liebevoll das dichte, rote Fell. „Bis dann, Juna.“ Er geht die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Ich klingele bei Vincent Molen. Keine Reaktion. Beim zweiten Versuch höre ich Schritte, dann eine krächzende Stimme: „Ich komme! Bitte warten Sie!“
Es dauert eine Weile, dann ein metallisches Klirren, ein tiefes Seufzen. Schließlich ruckelt das Schloss, die Tür springt auf.
Im Türrahmen steht ein kleiner alter Mann. Glänzender Schädel mit ein paar trotzig überlebenden Haarbüscheln, als hätte der Wind nur an ausgewählten Stellen gewirkt. Seine Augenbrauen sind sehr lang und ungezähmt, ähneln zwei übersehenen Raupen. Der Blick ist misstrauisch, mürrisch.
„Ich habe gerade an meiner Windel gearbeitet“, sagt er trocken und zeigt wortlos auf einen Raum. „Warten Sie da drüben. Ich bin gleich wieder da.“
Sprachlos stehe ich im Flur und ahne, was Katja mit „etwas eigen“ gemeint haben könnte. Der Impuls, es bei diesem einen Besuch zu belassen, ist stark. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich trete ein und schließe die Tür.
Rechts ein Fenster, davor ein schwarzes Sofa, das den Eindruck erweckt, Bequemlichkeit sei kein Kriterium gewesen. Das Parkett knarrt unter meinen Schritten. Ich setze mich auf die Kante des wackeligen Zweisitzers und lasse den Raum auf mich wirken.
Eine Einzimmerwohnung. Keine weiteren Türen. Ein Vorhang trennt das Bett auf der gegenüberliegenden Seite vom Rest des Zimmers. Links neben dem Sofa ein schwarzer Ledersessel, das Leder an mehreren Stellen aufgerissen, darauf ein Stapel Zeitungen und eine randlose Brille. An der Wand ein gemauerter Kamin. Auf dem Sims ein gerahmtes Foto, daneben eine kleine Pappschachtel. Ich kann die Person auf dem Foto von hier aus nicht genau erkennen und es wäre unhöflich, aufzustehen. Ein Esstisch fehlt. Nur ein schwerer Holzschrank steht noch im Raum.
„Sind Sie noch da?“ Vincent Molen taucht hinter dem Vorhang auf und kommt langsam auf mich zu.
„Ja, natürlich. Katja Wessels schickt mich. Ich bin Juna Fischer.“ Ich reiche ihm die Hand. „Bitte nennen Sie mich Juna.“
Er mustert mich kurz, dann ein knapper, trockener Händedruck.
„Vincent Molen. Was haben Sie mit mir vor?“
Meine Entschlossenheit gerät ins Wanken. „Ich dachte an einen Spaziergang durch die Altstadt, Herr Molen.“
„Vincent, bitte. Sonst fühle ich mich noch älter. Da ich ohnehin kaum die Straße überquere, klingt dein Vorschlag vernünftig.“
Der Mann hat Humor.
Vincent greift nach einem hellbraunen Trenchcoat, knöpft ihn langsam zu und geht hinaus. Ich folge ihm schweigend, fieberhaft nach einem Gesprächsthema suchend.
„Ich habe gerade Ihren Nachbarn getroffen. Florent Schubert. Der Mann mit Katze Ginger. Er führt sie an der Leine.“
„Ein fieses Tier. Stolziert herum wie Kleopatra.“
„Wurde sie nicht vergiftet?“, antworte ich trocken. „Durch den Biss einer Schlange?“
Vincent zieht eine Zornesfalte. „Ginger könnte das gleiche Schicksal ereilen.“
Vielleicht doch nicht das optimale Gesprächsthema.
*
Wir biegen in eine kleine Seitenstraße ein, schlendern in Richtung St.-Salvator-Kathedrale. Ob der alte Mann meine Gesellschaft genießt, lässt er sich nicht anmerken. Er hätte den Spaziergang auch ohne mich machen können.
„Haben Sie schon immer in Brügge gelebt?“, frage ich, als wir an der Kathedrale eine Pause einlegen und uns auf eine Bank setzen.
„Ich bin in Antwerpen geboren und in der Nähe auf dem Land aufgewachsen, Juna. Aber seit einigen Jahren lebe ich in Brügge.“
„Brügge ist auch solch eine schöne Stadt“, sage ich, ermutigt durch die Antwort. „Ich habe auch fast mein ganzes Leben hier verbracht. Vor ein paar Jahren bin ich nach Assebroek gezogen, aber das zählt kaum.“
Er brummt etwas Unverständliches.
„Waren Sie schon einmal in einer anderen Großstadt, Vincent? In London? In Paris?“
„Warum sollte ich? Brügge ist doch so schön.“
Ich lache leise. Er nicht. Jedoch glaube ich, ein dezentes Leuchten in seinen Augen zu sehen.
„Ich war in London, in Paris, in vielen Hauptstädten Europas. Nur New York fehlt mir noch, weil ich keine langen Flüge mag.“
Ich rede und rede. Erzähle von den Orten, die ich gesehen habe, mehr, um die Stille zu überbrücken, als aus echtem Mitteilungsbedürfnis. Insgeheim frage ich mich, ob Vincent Molen sich wirklich einen Buddy wünscht oder ob ein Arzt ihn ihm verordnet hat. Nach einer Viertelstunde machen wir kehrt. Ich rede immer noch, er schlurft schweigend neben mir her. Die Stadt füllt sich. Es ist kurz nach fünf. Die umliegenden Büros entlassen ihre Angestellten. Der alte Mann scheint sich unter den Menschen nicht wohlzufühlen. Ich nehme mir vor, das nächste Mal früher zu kommen.
„Möchten Sie mich nächste Woche wiedersehen, Vincent?“, frage ich, als wir vor seiner Haustür stehen.
„Ich schaue mal, ob ich einen freien Termin in meinem Kalender habe“, brummt er.
Nur das subtile Funkeln in seinen Augen verrät, dass er scherzt.
Kapitel 3
Antwerpen, November 1942
Esther
Es ist der kälteste November, den ich je erlebt habe. Ich wickle den Schal fester um meine Schultern, als könne er mich vor der Kälte und all dem schützen, was sich jenseits der Werksmauern zusammenbraut.
Der Weg vom Bürogebäude in die Werkshalle ist kurz, aber in diesem Winter zählt jeder Schritt doppelt. Meine Arbeit in der Diamantschleiferei Stern ist unsere einzige Einnahmequelle. Eine Erkältung kann ich mir nicht leisten. Ich nehme die schmale Treppe an der Seite des Gebäudes. Der Haupteingang bleibt den Vorgesetzten, den leitenden Angestellten und den Deutschen vorbehalten. Für uns jüdische Arbeiter gilt: Abstand halten, unsichtbar bleiben. Einem Deutschen zu begegnen, ist noch niemandem gut bekommen. Das weiß hier jeder.
Als die Deutschen in Belgien einmarschierten, hielten sie sich zunächst zurück. Doch es war nur Fassade. Inzwischen ist ihre Präsenz überall spürbar, wie ein kalter Schatten, der sich über das Land gelegt hat. Es ist kein erfreulicher Gedanke, für sie zu arbeiten, aber es ist die einzige Anstellung, die ich nach meiner Ausbildung bekommen konnte. Juden werden nicht mehr eingestellt. Die Deutschen sind allgegenwärtig. In Belgien arbeitet mittlerweile jeder für sie, egal wie man es betrachtet.
Die Familie Stern, einst Besitzer dieser Fabrik, war klüger als viele andere. Sie verließ das Land, bevor die Deutschen belgischen Boden betraten. Meiner Großmutter zufolge ging ein Teil der Familie nach London, der andere nach New York. Ich hoffe, sie sind dort sicher.
Sobald die Besatzer das Land wieder verlassen haben, wird die Familie zurückkommen und ihr Eigentum zurückfordern, sagt Großmutter. Sie hat vermutlich recht. Großmutter weiß immer alles und kennt jeden im jüdischen Viertel. Vor der Besatzung ging sie jeden Samstag in die Synagoge, aber ich glaube, eher aus Gewohnheit als aus überzeugtem Glauben.
Ich öffne die Tür zur Fabrikhalle. Der Lärm schlägt mir entgegen wie eine Welle. Das Kreischen der Diamantschleifscheiben, das rhythmische Hämmern der Maschinen: Es ist ein Lärm, der sich in den Körper frisst. Kein Wunder, dass die älteren Schleifer fast alle schwerhörig sind.
Die Halle ist endlos lang. Zwei Reihen Werkbänke erstrecken sich wie Metallgitter durch den Raum, flankiert von robusten Stützpfeilern, die das Dach stabil und zuverlässig tragen. Männer in Kitteln beugen sich konzentriert über ihre Arbeitsplätze und verwandeln Rohdiamanten in funkelnde Brillanten. Das Licht fällt durch die hohen Fenster auf ihre Arbeitsplätze, wie ein stilles Versprechen oder ein ferner Trost.
Einen Moment verweile ich an der Tür und lasse meinen Blick über die gesenkten Köpfe der Arbeiter schweifen. Es sind über dreihundert, nicht alle kenne ich mit Namen. Aber der Mann, den ich suche, ist leicht zu erkennen: jung, blond und damit auffällig unter den meist dunkelhaarigen jüdischen Kollegen. Ich entdecke seinen Schopf hinter der ersten Werkbank im Gang und eile auf ihn zu.
„Vincent Molen?“, rufe ich gegen den Lärm an.
Er blickt auf, beendet seine Arbeit und schaltet die Maschine aus. „Ja, was kann ich für Sie tun?“
Seine blauen Augen mustern mich neugierig. Er hat ein freundliches, offenes Gesicht und zwei feine Linien um den Mund, als verbirgt sich dahinter ein Lächeln. Ein gut aussehender junger Mann, kaum älter als ich.
Warum ist er mir nicht früher aufgefallen?
„Esther Hirsch von der Lohnbuchhaltung.“ Ich zeige ihm meinen Ausweis. „Kann es sein, dass Sie letzte Woche zwei Tage gefehlt haben, Herr Molen?“
„Leider ja“, antwortet er. „Aber mit Erlaubnis meines Vorgesetzten. Meine Großmutter ist gestorben. Ich wollte an ihrer Beerdigung teilnehmen.“
„Wie traurig. Mein Beileid.“ Ich zögere. „Sie wissen, dass Sie für den zweiten Tag keinen Lohn mehr erhalten?“
Er zuckt mit den Schultern. „Es ging nicht anders. Meine Großmutter hat in Langesthal, das ist ein Ortsteil von Eupen, gewohnt. Das ist in der Nähe der deutschen Grenze. Die Strecke an einem Tag hin und zurück. Unmöglich.“
„Das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen.“
Meine Arbeit ist getan. Ich sollte jetzt zurück ins Büro gehen und weiter die Lohnlisten ausfüllen. Doch ich bleibe. Etwas in seinem Blick hält mich zurück.
„War Ihre Großmutter schon alt?“, frage ich.
„Ja, sie wurde fünfundneunzig. In unserer Familie werden alle alt. Na ja, fast alle.“ Ein Schatten legt sich auf sein Gesicht wie eine Wolke. Er senkt den Blick, richtet ihn auf das Werkzeug auf seiner Werkbank, auf den unfertigen Diamanten, als könne der Stein seine Gedanken auffangen.
„Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, Herr Molen. Noch einmal mein herzliches Beileid.“
„Danke. Aber sagen Sie doch Vincent. Herr Molen klingt, als müsste ich jeden Moment ins Gras beißen.“ Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, kaum wahrnehmbar, aber es vertreibt den Schatten. Seine Augen leuchten, als wäre die Dunkelheit für einen Moment verschwunden. Mein Herz macht unwillkürlich einen kleinen Sprung. Ich nicke und drehe mich um. Mit der Abrechnung, wie eine nutzlose Requisite in der Hand, mache ich mich auf den Weg zurück ins Büro. Erst als ich meinen Platz wieder eingenommen habe und mein Kollege mich fragend ansieht, merke ich, dass ich lächle, nicht verhalten, sondern breit, offen, wie jemand, der gerade aus einem wunderbaren Traum erwacht ist.
*
Auf dem Heimweg nehme ich die Abkürzung durch Hinterhöfe und enge Gassen. Ich kenne sie wie meine Westentasche. Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich seit zwei Jahrzehnten. Ich würde lieber einen Umweg machen, die kalte Luft etwas länger genießen, den Staub des Tages abschütteln, aber ich will so schnell wie möglich zu meiner Mutter nach Hause.
An Judiths Haus blicke ich kurz auf. Die Fenster sind dunkel, das Haus leer. Vor zwei Wochen wurden Judith, ihre Eltern und die kleinen Geschwister deportiert. Ein Anruf, ein Befehl, eine gepackte Tasche, ein letztes Winken.
Seit unserer frühesten Kindheit waren wir zusammen. Die Schulbank, die erste Zigarette, die Ausbildung zur Sekretärin. Judith war meine Schwester im Geiste und ich ihre. Jetzt ist sie fort. Von der Gestapo in das SS-Sammellager Fort Breendonk gebracht. Dann in den Osten deportiert. Zur Arbeit, sagen sie. Wie es ihr wohl geht? Was sie dort wohl macht? Werde ich sie je wiedersehen?
Ich habe Glück gehabt, sagt Großmutter. Für eine Jüdin ist eine Arbeit in der Diamantschleiferei fast wie ein Wunder. Es ist ein Schutzwall vor der Deportation, zumindest vorerst. Aber wie lange noch? Ich bin keine Schleiferin, keine Fachfrau. Nur eine junge Frau mit Schreibmaschinen- und Stenokenntnissen, mit einem gelben Stern auf dem Mantel und einem „J“ im Ausweis: ein Buchstabe, der lauter schreit, als eine Stimme es je könnte.
Ich versuche, diesen Gedanken beiseitezuschieben, ihn dorthin zu verbannen, wo er mich nicht ständig daran erinnert, dass ich Jüdin bin. Antwerpen kann ich auch nicht verlassen. Ich kann meine Mutter und Großmutter nicht zurücklassen. Ich habe keine Wahl, keine, die nicht mit Schmerz einhergeht. Jede Entscheidung ist ein Opfer, und ich weiß nicht, wie viele davon Großmutter, Mama und ich noch tragen können.
Denk an etwas Schönes, Esther. Denk an Vincent.
Ich drücke die Haustür auf, nehme zwei Stufen auf einmal, als würde mich der Gedanke an den jungen Schleifer beflügeln. Ich bin albern. Es war nur ein Gespräch über eine tote Großmutter. Trotzdem. Als ich eintrete, lächle ich wie ein Schulmädchen.
„Schau nur, meine Enkelin, ein Lächeln, das den ganzen Tag heller macht“, ruft Großmutter, während sie mit dem Schöpflöffel sacht im Topf kreist. Vielleicht ist es nur eine dünne Suppe, doch sie trägt den Duft von Heimat und ein bisschen Trost in sich. Sie wohnt nur ein paar Straßen weiter und ist dennoch fast täglich hier, um für uns zu kochen, um einfach da zu sein.
„Großmutter! Du bist heute aber früh dran.“
Ich umarme sie. Ihre Arme sind vertraut, ein Ort der Geborgenheit. „Ich wollte mir gerade etwas kochen.“
„Hast du ein Glück“, brummt sie. Der Ton täuscht. Sie nörgelt, weil sie Mama und mich liebt.
Ich lehne mich zurück, schaue sie an. Ihre Stirn ist gerunzelt, aber in ihren Augen liegt stets Sanftmut. Ihre Liebe hat Kanten, doch sie ist echt wie der Morgen nach einem Sturm, wie ein Diamant.
„Wie geht es Mama heute?“, flüstere ich.
Ihr Bett steht hinter dem Vorhang in der Ecke. Von hier aus kann ich sie nicht sehen.
„Den Umständen entsprechend“, antwortet Großmutter. Sie sagt nie „gut“. Das wäre eine Herausforderung an den Himmel. Aber sie sagt auch nie „schlecht“. Das würde die Dunkelheit heraufbeschwören. Sie bleibt dazwischen, wie eine Gratwanderung zwischen Aberglaube und Pragmatismus.
Leise ziehe ich den Vorhang beiseite. Mama liegt einfach da, die Augen geschlossen. Ihre Brust hebt sich kaum merklich. Ihr Gesicht ist entspannt, fast selig. Im Raum ist die Luft schwer, feucht, kränklich. Sie hüllt mich ein wie ein Nebel. Ich knie mich neben ihr Bett.
Mamas rechte Hand liegt regungslos auf der Decke. Ich möchte sie streicheln, aber das würde sie aufwecken, und das möchte ich nicht. Vielleicht träumt sie etwas Schönes. Von der Sonne. Von Freiheit. Von einer Zeit vor all dem. Ich trete zurück und ziehe den Vorhang zu.
„Was war das vorhin für ein Lächeln auf deinem Gesicht, Esther?“, fragt Großmutter. Sie stellt mir einen Teller mit Salzkartoffeln hin und setzt sich mir gegenüber.
„Welches Lächeln?“ Ich mime die Ahnungslose, aber das hat bei Großmutter noch nie funktioniert.
„Die Braut, die an deiner Tasse klebt.“ Ich lache laut auf.
„Großmutter. Ich bin einfach nur froh, zu Hause zu sein“, antworte ich und wechsle das Thema. „Möchtest du nichts essen?“
„Ich habe schon gegessen“, antwortet Großmutter.
Eine glatte Lüge. Ich hörte ihren Magen knurren, als ich zur Tür hereinkam. Aber sie würde es nie zugeben. Nicht in diesen Zeiten, in denen Juden nur nachmittags einkaufen dürfen, wenn die Regale leer und die Vorräte aufgebraucht sind. Was Großmutter dann noch bekommt, gibt sie uns. Sie hat sich stets zurückgehalten. Früher war sie schlank und stolz auf ihre schmale Taille. Jetzt ist sie abgemagert. Die Wangenknochen treten hervor, das Gesicht wirkt kantig und ausgemergelt. Die dunklen Augen, früher funkelnd und lebendig, wirken größer, weil die Haut um sie herum eingefallen ist und der Vitaminmangel seine Spuren hinterlassen hat. Ich kenne alte Fotos von ihr: Eine schöne Frau, mit scharfem Blick und einem Lächeln, das den Männern den Kopf verdrehte. Jetzt ist ihre Haut grau, ihr Gesicht erschöpft, ihr Blick stumpf. Eine alte Frau, kaum über sechzig.
Sie erwidert mein Lächeln nicht und stellt keine neugierigen Fragen mehr. Stattdessen schaut sie aus dem Fenster, auf die tote Wand des Nachbarhauses, als könne sie dort eine Antwort finden. Wir wohnen zwei Stockwerke tiefer, in einem Raum, der alles zugleich ist: Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer.
Nach dem Tod meines Vaters vor zwölf Jahren sind wir hierhergezogen. Ich war noch ein Kind, aber ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen: Wir schoben unsere Habseligkeiten in einer rostigen Schubkarre durch die Straßen, weg aus dem großen Haus, das wir ohne Papas Einkommen nicht halten konnten. Dieses Zimmer war nie wirklich ein Zuhause, sondern eher ein Ort zum Ausharren.
„Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll“, sagt sie plötzlich, ohne den Blick vom Fenster zu wenden.
„Meinst du Mamas Gesundheit, Großmutter?“
Sie dreht sich zu mir um, ihr Gesicht wirkt weich und müde zugleich. „Ich meine alles, mein Kind. Dieser Krieg, die Deutschen, einfach alles. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und jetzt ist auch noch der Arzt fort.“
Ihre Hand fährt zu dem gelben Stern auf ihrer Brust, als wolle sie ihn abreißen. Sie schüttelt den Kopf.
Plötzlich bin ich ganz still. „Was heißt fort?“, frage ich, doch meine Ahnungslosigkeit ist nur Fassade, die Angst sitzt mir seit Langem im Nacken.
„Vermutlich deportiert“, antwortet sie. „Ich wollte heute Morgen ein neues Rezept abholen. Die Praxis war geschlossen. Die ganze Familie ist einfach verschwunden.“
Ein Arzt. Ein jüdischer Arzt, einfach fort?
Stille. Das Schweigen spannt sich zwischen uns wie ein straffes Tuch. In Gedanken gehe ich all die Namen durch. Sämtliche Adressen von Ärzten, von denen ich je gehört habe. Aber jeder Name ist wie ein Kartenhaus, das beim Windstoß zusammenfällt. Es muss einen Weg geben. Die Nazis können uns doch nicht die Medizin verbieten. Nicht auch noch das. Nicht, wenn es um Mamas Leben geht. Aber der Zweifel nagt. Wie Termiten am Holz.
Die Nazis haben uns nach und nach alles genommen. Und jedes neue Verbot kam wie ein Messerstich, unerwartet und kalt. Warum sollte es hier anders sein? Ich möchte mit Großmutter darüber sprechen, meine Ängste mit ihr teilen. Aber ich sehe ihre müden Augen und schlucke meine Worte hinunter.
Während ich mir die letzte Kartoffel in den Mund schiebe, überlege ich, wie ich Mama helfen kann. Ich muss einen Weg finden. Für Mama. Für uns. Für den letzten Rest Hoffnung.
Kapitel 4
Brügge, 2014
Juna
„Was für eine fantastische Nachricht.“
Meine Stimme klingt vergnüglicher, als ich mich fühle. Ich sitze mit einer Tasse Tee auf Josts weißem Sofa und kann seinen Worten kaum glauben. Er hat heute einen neuen Vertrag unterzeichnet, der Anlass für meinen Besuch und das Glas Champagner in seiner Hand. Und was für ein Vertrag! Jost wird die Musik für einen Hollywood-Film komponieren.
„Fantastisch ist noch untertrieben“, sagt er, das Gesicht voller stiller Glückseligkeit. „Dieser Auftrag ist das Beste, was ich bisher erreicht habe, Juna.“
Ich nehme einen kleinen Schluck von meinem Tee, obwohl er noch zu heiß ist. Der bittere Nachgeschmack auf der Zunge verdrängt den Versuch eines Lächelns. Mein Blick gleitet unweigerlich zu dem Flügel in der Mitte des Raumes, glänzend, monumental, still. Mein Verstand widerspricht leise Josts Worten. Es ist das Beste seit dem Unfall, aber nicht grundsätzlich das Beste.
Früher spielte er in den Konzertsälen der Welt, umjubelt und getragen vom Applaus. Heute ist vieles anders. Ich sage es nicht. Er weiß es. Vielleicht hat er sich mit der neuen Realität arrangiert. Oder er täuscht es nur vor.
„Erzähl mir mehr. Was ist das für ein Film?“
„Ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Das Casting läuft noch, aber die Namen, die ich zufällig aufgeschnappt habe, können sich sehen lassen. Große Stars. Und der Regisseur…“ Er nennt einen Namen, der selbst mir etwas sagt: ein Titan der Branche.
„Sam wäre stolz auf dich“, sage ich leise.
Jost nickt und hebt sein Glas zum Flügel, als säße dort jemand, den nur er sehen kann. Möglicherweise tut er das wirklich. Manchmal habe auch ich das Gefühl, dass Sam noch da ist, als wäre sein Schatten in den Möbeln gespeichert: in der Art, wie sich die Vorhänge bewegen, in den Dingen, die er berührt hat. In der Küche, in der er einst sorgfältig Teller übereinanderstapelte. Im Garten, mit den Händen in der Erde. In jedem Bild, in jeder Pflanze lebt ein Hauch von ihm. Ist das der berühmte ‚Geist‘ eines Menschen, oder erschaffen wir ihn selbst aus Verlust und Erinnerung?
„Sam hätte sich gefreut“, sagt Jost. „Ein alter Bekannter von ihm hat mich übrigens dem Produktionsteam empfohlen. Man weiß nie, welche Verbindung einem eine neue Tür öffnet. Apropos: Wie läuft’s mit deinem ehrenamtlichen Patienten?“
„Er ist kein Patient. Ich habe ihn zweimal getroffen. Wir sind spazieren gegangen. Aber ob es passt, da bin ich mir nicht so sicher.“
„Es hat demnach nicht gefunkt?“
Ich senke den Blick, lasse den Dampf des Tees in mein Gesicht steigen. „Ich weiß nicht. Vincent Molen ist schwer zu durchschauen, ein stiller, eigenwilliger Mann. Er hat mich aber zum Essen in eine Art Kantine in seinem Viertel eingeladen.“
Jost verschluckt sich fast an seinem Sekt. „Kantine? Oder meinst du Suppenküche?“, wiederholt er entsetzt. In seiner Stimme schwingen Belustigung und ein leiser Anflug von Besorgnis mit. Er war es, der mich zu diesem Ehrenamt überredet hat, aber dass ich jetzt mit einem alten Mann in eine Kantine essen gehe, scheint ihn zu beunruhigen.
„Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Morgen werde ich es wissen.“
Ein Laut entweicht ihm, irgendwo zwischen einem Seufzen und einem Lachen. Er schaut mich an, als wolle er mir sagen, ich solle mir vorsichtshalber eine Magentablette einpacken.
Ich lächle. „Keine Sorge, Jost. Vincent Molen isst dort jeden Dienstag und er lebt noch und ist erstaunlich rüstig.“
„Hat er Familie?“
„Nicht, dass ich wüsste. Katja Wessels vom Verein sagt, er sei allein. Er ist auch nicht der Typ, dem man so leicht persönliche Fragen stellen kann. Aber vielleicht werde ich morgen einen ersten Versuch starten. Sag mal, hast du schon Ideen für die Musik?“, frage ich, um das Thema zu wechseln.
Jost lenkt seinen Rollstuhl zum Keyboard in der Ecke. Wenig später fließen die ersten Töne durch den Raum, leise, suchend. Sie steigern sich, werden dunkler, drängender. Etwas Bedrohliches schleicht sich in die Melodie, als taste sich eine unsichtbare Präsenz durch den Klang.
Mein Nacken prickelt, die Luft wird plötzlich kühler.
Stille. Jost hebt die Hände über die Tastatur und legt sie langsam in den Schoß. Unzählige Male habe ich diese Bewegung auf der Bühne gesehen. Jetzt wirkt sie müde, wie das finale Kapitel eines alten Stücks.
„Ich habe bislang nicht viel komponiert“, sagt er mit gedämpfter Stimme. „Ich weiß erst seit heute Nachmittag, dass es losgeht.“
„Es wird dir gelingen und du wirst vor allem viel Freude daran haben.“ Ich stelle meine Tasse auf einen Kristalluntersetzer und greife nach meiner Tasche. „Morgen erwartet mich ein anstrengender Abend. Außerdem muss ich mich mental auf ein Kantinenessen vorbereiten.“
Jost lächelt, aber ich sehe, wie sein Blick sich bereits in seine innere Welt zurückzieht, dorthin, wo Töne mehr zählen als Worte. Ich umarme ihn, spüre die Spannung unter seiner Ruhe, diese stille Kraft, die ihn zusammenhält.
Auf dem Weg zur Tür frage ich mich, ob es wirklich die Leidenschaft ist, die uns durch schwere Zeiten trägt. Oder ob es etwas anderes braucht. Vielleicht etwas Dunkles, Hartnäckiges. Und ob meine Leidenschaft noch draußen auf mich wartet, leise, vergessen, tief in der Welt verloren. Werde ich sie jemals wiederfinden?
Kapitel 5
Brügge, 2014
Juna
Vincent hält sich noch wacker auf den Beinen, doch ich muss mein Tempo seinem anpassen. Wenn ich eine Pause einlege, bleibt er mit dem entschlossenen Blick eines Mannes stehen, der sich nicht eingestehen will, dass ihm etwas schwerfällt. Aber sein angespannter Gesichtsausdruck verrät, dass mein gemächlicher Schritt für ihn zur Anstrengung geworden ist.
Heute wirkt er weniger mürrisch. Vielleicht liegt es am bevorstehenden Essen. Vielleicht an einer Prise Vorfreude.
„Ich esse dort jeden Dienstag“, sagt er auf dem Weg zur Kantine. „Ich könnte auch öfter hingehen, aber dann wär’s nichts Besonderes mehr. So habe ich jede Woche etwas, worauf ich mich freuen kann.“
Ein wöchentlicher Anker in einem Leben, das sonst keine Höhepunkte mehr kennt. Vincent und ich sind uns ähnlich.
Die Kantine entpuppt sich tatsächlich als eine Suppenküche: eine Art Zeitkapsel, aus der Ästhetik gefallen, aus dem Geschmack, aus jeder denkbaren Norm. Die Luft riecht nach verkochtem Gemüse und Desinfektionsmittel. Die Wände sind hellgrün, zu hell, zu steril, als wolle man eine fröhliche Stimmung erzeugen. Der Boden ist mit weißen Fliesen ausgelegt, jeder Schritt hallt nach. Vincent strahlt, als säße er in einem Sterne-Restaurant. Ich nicht.
Bedient werden wir von Klara, einer Frau in den Fünfzigern, mit dem imposantesten Busen, den ich je gesehen habe. Mit ihrem kobaltblauen Lidschatten und der blonden Dauerwelle erinnert sie an eine Nebendarstellerin aus einer Fernsehserie der 1970er-Jahre. Der Leckerbissen, von dem Vincent gesprochen hat, besteht aus einem Metallteller, auf dem ein erschöpfter Klecks Kartoffelpüree liegt, daneben Karottensalat in einer seltsamen, glänzenden Farbe. Dazu gibt es eine flache Frikadelle, übergossen mit der Karikatur einer Soße.
Vincent stürzt sich mit freudigem Gesichtsausdruck auf das Gericht, die Gabel zum Mund, ein stilles Nicken, als ob alles genau so ist, wie es sein soll. Mein Appetit verabschiedet sich hingegen augenblicklich, nicht nur wegen des fragwürdigen Happens auf meinem Teller, sondern auch wegen der Umgebung.
Ich versuche, nicht auf die Gäste zu starren, aber es fällt mir schwer. Ein alter Mann in einem braunen Karoanzug, den er vermutlich seit 40 Jahren trägt. Eine Frau unbestimmten Alters mit ungekämmten, lilafarbenen Haaren. Ein schlampig gekleideter junger Mann mit einer Brille, die sein Gesicht verzerrt, liest ein Buch und stochert mit der Gabel in seinem Eintopf. Den letzten Gast an einem kleinen Tisch hinter uns kann ich nicht sehen, ohne mich umzudrehen, aber ich höre nur sein unverständliches Gemurmel, dumpf, unbeirrbar.
Könnte das hier womöglich eine Außenstelle der Heilsarmee sein? Oder doch eine Suppenküche? Ich hatte keine Ahnung, dass es im heutigen Brügge noch Orte wie diesen gibt.
„Was essen Sie denn den Rest der Woche, Vincent?“ Es soll beiläufig klingen, aber ich höre selbst, wie gezwungen meine Stimme klingt.
„Nur das, was in den Topf passt“, antwortet er, nachdem er seinen Mund geleert hat. „Der schmeißt mir meistens ein braunes Sandwich raus.“
Ich versuche zu lächeln. Es gelingt mir nicht.
Stattdessen tunke ich ein Stück Frikadelle in die bräunliche Pfütze, die sich in trägen Schlieren über den Teller zieht wie altes Öl auf Wasser. Schließlich fasse ich einen Entschluss.
„Wollen wir nächsten Dienstag woanders essen? Ich lade Sie ein.“
„Nein.“ Die Antwort kommt sofort. Kühl. Endgültig.
„Warum nicht?“
„Weil ich jeden Dienstag hier esse.“
So ist es. Und so bleibt es.
„Vielleicht Mittwoch?“, versuche ich.
Er hält inne, als müsse er seinen inneren Kalender abgleichen.
„Mittwoch passt.“
„Haben Sie Familie, Vincent?“ Ich frage nicht aus Höflichkeit, sondern aus echtem Bedürfnis, diesen Mann zu verstehen, der sich so tapfer an der Oberfläche hält.
„Nicht, dass ich wüsste.“
„Geschwister?“
„Nie gehabt.“
„Und waren Sie mal verheiratet?“
Sein Blick flackert. Nur kurz. Dann ist da wieder diese Mauer. Kein Ja. Kein Nein. Nichts. Ich möchte nicht nachhaken. Nicht hier. Nicht jetzt. Vincent ist kein Mensch, der solche Dinge leichtfertig teilt. Oder überhaupt etwas teilt, wenn ich ehrlich bin.
Er schiebt seinen Teller zurück und sieht zufrieden aus. Nicht satt im kulinarischen Sinn, sondern in einem tieferen, schwerer greifbaren Sinn. Vielleicht ist es das Ritual, die Gesellschaft oder die Tatsache, dass jemand gefragt hat, ob er Zeit hat.
Klara bringt uns die Rechnung. Ihre Hände riechen nach Reinigungsmittel und Zigarettenrauch. Vincent bedankt sich mit einem Nicken. In seinen Augen ist wieder ein schwaches Glitzern. Nicht Glück. Nicht Dankbarkeit. Etwas anderes. Etwas Uraltes. Vielleicht eine Erinnerung oder ein Verlust. Vielleicht ein Anzeichen von Vertrauen.
Kapitel 6
Brügge, 2014
Juna
„Waren Sie schon einmal hier?“, frage ich Vincent, als wir an einem Mittwochnachmittag das Café De Proeverie betreten, das ich online gefunden habe. Es sieht in Wirklichkeit gemütlicher aus, als ich erwartet hatte: ein Ort mit abgewetzten Holztischen, warmem Licht – ein Hauch von Vergangenem hängt in der Luft. Das Café ist eine Erweiterung der berühmten Schokoladenmanufaktur Chocolaterie Sukerbuyc, die sich gegenüber in derselben Straße befindet. Da es in der Nähe des Beginenhofs liegt, bin ich mir sicher, dass Vincent es kennt. Doch sein Blick schweift suchend umher, tastet nach Orientierung, nicht nach Erinnerung.
„Nein“, sagt er knapp. „Ich war seit zwanzig Jahren nicht mehr in einer Kneipe, wenn man die Kantine nicht mitzählt. Das hier ist anderes Land.“ Er schmunzelt. „Die Kantine ist ein Ort mit festen Ritualen und geregelten Erwartungen, fernab von Überraschungen.“
Um die Mittagszeit füllen Stimmengewirr, dezente Barockmusik und das Klappern von Besteck die warme Luft. Wir nehmen einen Tisch in der hinteren Ecke, etwas abseits von der Geräuschkulisse. Vincent setzt sich mit der Vorsicht eines Mannes, der nicht mehr nur seinem Körper, sondern auch der Welt misstraut. Selbst als die Kellnerin seinen Kaffee bringt, schaut er misstrauisch auf die Tasse mit dem J-Logo, bevor er einen Schluck nimmt.
„Dieses Zeug habe ich einmal verkauft“, murmelt er.
„Kaffeetassen?“
„Kaffeebohnen der Marke Jacobs. Damals, bevor das Unternehmen an die Amerikaner ging. Danach habe ich umgesattelt. Wer verkaufen kann, kann alles verkaufen, Bohnen, Schuhe, Träume.“
Sein Blick fällt missbilligend auf meinen Cappuccino. „Warum Milch in den Kaffee schütten? Du bist doch kein Baby, oder?“
Er hat mich geduzt. Wir machen Fortschritte. Ich lächle. Er hat diese Art von speziellem Humor, der nicht beleidigt, sondern entlarvt: mich, meine Gewohnheiten, vielleicht auch meine Unsicherheit.
„So trinkt man ihn in Italien.“
„Wir sind nicht in Italien. Echter Kaffee ist schwarz. Ohne Weichspüler. Basta.“
„Meine Eltern leben dort“, sage ich, obwohl das keine Erklärung ist. Nicht für meinen Cappuccino. Nicht für ihre Abwesenheit. „In Italien ist das vollkommen normal.“
Er mustert mich mit einer Mischung aus Skepsis und Interesse. „Bist du Italienerin?“
„Nein. Nur eine Emigrantentochter. Sie sind vor zehn Jahren ausgewandert: Sonne, Olivenöl, Dolce Vita. Sie sind dort glücklich. Zumindest hoffe ich das.“ Der Nachsatz kommt stockend.
Er sagt nichts, und sein Schweigen erlaubt es meinen Gedanken, sich an die Bruchstellen meiner Familie zu heften. Wie selten wir telefonieren. Wie selbstverständlich ihre Entfernung geworden ist und meine Einsamkeit.
„Siehst du sie oft?“ Die Frage kommt so ruhig, so unaufdringlich, dass sie mich trotzdem trifft.
„Ich sehe sie selten.“ Ich erwähne nicht, wie selten, auch nicht, dass sie nicht kamen, als ich nicht mehr konnte, als ich einsam war. „Familie ist kompliziert. Mein Bruder Jost kommt klar. Er hat seine Musik. Seine Welt. Ich hingegen…“ Ich halte inne. Der Satz bleibt unvollendet, wie so viele in letzter Zeit. „Man gewöhnt sich an vieles, auch an die Abwesenheit.“
Er sieht mich an. Zu lange. „Ich weiß nicht, ob man sich daran wirklich gewöhnen kann.“
Ich halte die Tasse mit beiden Händen. „Sie haben niemanden, oder?“
„Nein. Ich habe keine Kinder“, sagt Vincent. „Meine Eltern, das ist zu lange her. Ich sehe sie nicht mehr vor mir. Nur manchmal, wenn ich nicht darüber nachdenke. Dann kommen sie einfach. Bilder. Bruchstücke.“
Seine Hand zittert, als er die Tasse mit fast ritueller Langsamkeit absetzt. Eine schmale, braunfleckige Hand, die viel getragen hat: Zeit, Verlust, Geschichte. Zum ersten Mal fällt mir das Zittern auf. Als er merkt, dass ich hinschaue, verschwindet sie unter dem Tisch.
„Was haben Sie sonst gemacht? Vor und nach den Bohnen?“, frage ich, bemüht um Leichtigkeit.
„Was man halt so macht. Alles Mögliche. Die Zeiten haben nichts verschenkt. Man hat gearbeitet oder gehungert.“ Er lehnt sich zurück. „Wollen wir plaudern oder essen?“
„Was mögen Sie, Vincent? Kuchen, Schokoladenspezialitäten und Waffeln, alles nach Familienrezepten vor Ort hergestellt…“
*
Der Rückweg ist langsamer. Viel langsamer. Sein Gang ist schwerer, seine Schultern sind ein wenig runder. Ich spüre seine Erschöpfung, trotzdem sagt er kein Wort. Wir schweigen. Zwischen uns wächst eine neue Stille, keine unangenehme, sondern eine, die von stiller Übereinkunft erzählt. Unser Schweigen ist nicht leer. An seiner Veranda bleibt er stehen, hält mir fast galant die Tür auf, eine Geste, die ich nicht erwartet hätte, aber schätze.
„Ich habe seit Jahren nicht mehr so lecker gegessen, Juna. Danke“, sagt er und hängt seinen abgewetzten Mantel an der Garderobe auf.
Er hat meinen Namen gesagt.
Ich zögere, berührt von der Seltenheit seines Dankes, von der Wärme, die sich in meinem Brustkorb ausbreitet. „Gerne“, sage ich leise. „Ich fand es auch hervorragend.“
Er verschwindet hinter der kleinen Küchenwand.
„Tee?“, fragt er aus der Küche. „Kaffee kann ich leider nicht anbieten, meine Maschine ist seit dem letzten Jahrhundert defekt.“
Ich höre sein kehliges Lachen. „Tee ist perfekt.“
Während er Wasser aufsetzt, sehe ich mich um. Ein stilles Glück liegt in dieser kleinen Wohnung, zwischen gelesenen Zeitungen, dem verblassten Teppich und dem alten Trenchcoat an der Garderobe. Der Raum ist auf eine seltsame Weise vollkommen. Kein Platz für Überflüssiges. Vielleicht ist das Freiheit.
Mein Blick bleibt am Kaminsims hängen. Das Foto dort hatte ich bei meinem ersten Besuch nur vage wahrgenommen. Jetzt trete ich näher. Es ist ein altes Schwarz-Weiß-Foto, die Ränder sind vergilbt, das Papier gewellt. Kein Rahmen. Nur eine junge Frau, vielleicht zwanzig, mit dunklem, schulterlangem Haar, die freundlich und zugleich fest in die Kamera schaut. Neben dem Foto liegt eine Streichholzschachtel. Die beiden Gegenstände gehören offensichtlich zusammen, als feste Einheit, die nicht vergessen werden darf.
Plötzlich steht Vincent mit zwei dampfenden Gläsern in den Händen neben mir. „Hast du etwas verloren?“
„Nein. Ich habe mir nur das Foto angesehen. Wer ist sie?“
„Das ist Esther.“ Er sagt es, als müsste das genügen.
„War sie mit Ihnen verwandt?“
Er setzt sich langsam, stellt den Tee ab, zieht Zeitungen beiseite wie alte Erinnerungen. „Nein. Für mich war sie alles. Meine Liebe, mein Leben.“
Ein Kloß steigt mir in die Kehle. „Ist sie noch…?“
„Sie ist seit Ewigkeiten fort.“
„Wegen des …“ Ich muss das Wort nicht aussprechen.
Er tut es trotzdem. „Krieg.“ Seine Stimme ist flach, beinahe tonlos. Ein einziges Wort. Und doch schneidet es durch den Raum wie ein Messer. „Ich vermisse sie jeden Tag.“
Der Tee in meinem Glas bebt leicht. Über uns knarzt das Gebälk. Schritte. Sein Blick geht zum Fenster, als würde er dort draußen etwas sehen, das unwiederbringlich vergangen ist. Seine Esther?
Zum ersten Mal frage ich mich, was dieser Mann gesehen und verloren hat, was er niemals vergessen kann. Ich spüre, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Der Moment, in dem die Vergangenheit zu sprechen beginnt. Ich kann nur hoffen, dass ich auch bereit bin, zuzuhören.
Kapitel 7
Antwerpen, November 1942
Esther
Samstagabend. Ich spüre förmlich, wie sehr ich die Fabrik hinter mir lassen möchte. Nach sechs Tagen inmitten von Öl, Glasstaub und monotonem Schleifgeräusch ist jeder Schritt hinaus ein Aufbegehren. Im Vorbeigehen nicke ich einigen Bekannten zu, es ist kaum mehr als eine flüchtige Geste. Dann verschwinde ich, wie der Rest der Belegschaft, die sich lautlos auflöst. Das Fabrikgebäude leert sich und für einen Moment scheint die Straße in einem Strom dunkler Mäntel, übersät mit gelben Sternen, unterzugehen. Schwarz mit Gelb, ein zynisches Muster.
Die meisten laufen mit gesenkten Köpfen, die Hände tief in den Taschen vergraben, als könnten sie sich in sich selbst zurückziehen. Ein paar wenige reden. Einige lachen sogar, die altbekannten Witzbolde aus dem jüdischen Viertel. Unverbesserliche Optimisten schälen selbst jetzt noch einen Rest Leichtigkeit aus dem Tag. Vielleicht liegt es an der Aussicht auf einen freien Tag. Oder daran, dass Lachen manchmal das letzte Mittel ist, um nicht zu zerbrechen.
Dieser Gedanke berührt etwas in mir, das sich lange nicht mehr geregt hat. Ich überquere die Straße und biege bei meiner alten Schule um die Ecke. Mein Sonntag verläuft wie jeder andere Sonntag seit Judith fort ist: ich, allein, auf der Holzbank unter dem Küchenfenster, mit einem Buch auf dem Schoß, und der Stille als Gesellschaft.
Mit Judith hätte ich ausgehen können. An einen anderen Ort, an dem man uns noch hätte sehen wollen. Doch die Liste der Orte, an denen wir nicht willkommen sind, ist lang: Kinos, Cafés, Straßenbahnen. Selbst die Parks sind uns verschlossen. Ich frage mich oft, ob die Antwerpener diese Maßnahmen nicht ebenso lächerlich empfinden wie wir. Aber sie gehorchen. Die Nazis haben unmissverständlich klargemacht, was Ungehorsam bedeutet. Sie machen keinen Unterschied zwischen Juden und ihren Freunden.
Außerdem gehe ich ohnehin nicht gerne mit diesem verdammten Stern aus dem Haus. Er haftet an mir wie ein Stigma, das jeden Blick auf sich zieht.
„Esther!“
Ich halte inne, drehe mich um.
„Esther, warte!“, ruft Vincent Molen. Der blonde Diamantschleifer, mit dem ich kürzlich ein paar Worte gewechselt habe, kommt atemlos auf mich zu. Er scheint, als hätte er zu lange gezögert, aber jetzt keine Sekunde mehr verlieren zu wollen.
„Ich begleite dich ein Stück. Muss ohnehin in die Richtung.“
Ich mustere ihn. „Du wohnst doch in der Simonsstraße. Das ist nicht gerade in meiner Nähe.“
Er errötet so stark, dass ich unwillkürlich lächeln muss.
„Lohnbuchhaltung, erinnerst du dich? Ich arbeite schon eine Weile in der Fabrik. Ich weiß, wo jeder wohnt.“
„Und was jeder verdient.“
„Das auch.“ Ich kichere, überrascht über mich selbst.
Er grinst und sieht mit einem Mal jünger aus als dreiundzwanzig.
„Magst du einen Apfel?“ Er zaubert einen glänzenden Apfel aus seiner Jackentasche und hält ihn mir hin.
„Oh, danke.“
„Meine Großmutter hatte Apfelbäume im Garten. Na ja, hatte. Jetzt gehört der Hof meiner Tante Lena. Sie hat mit meiner Großmutter dort gelebt. Probier doch mal.“
Ich nehme den Apfel entgegen. Er ist auf einer Seite rund, auf der anderen leicht länglich, fast wie eine Birne – unförmig und doch schön.
„Probier ihn“, sagt Vincent noch einmal.
„Später.“ Ich lasse ihn lässig in meine Manteltasche gleiten. „Nach dem Abendessen. Bist du in Langesthal geboren?“
„Nein, hier in Antwerpen. Mein Vater stammt von dort. Er ist noch vor meiner Geburt hierhergezogen. Ich war aber als Kind oft bei meiner Großmutter.“
„Was macht dein Vater jetzt?“
„Gar nichts mehr.“
Vincent schubst mich sanft zur Seite, ein Versuch, dem Gewicht seiner Worte die Schärfe zu nehmen. „Komm.“
Ich will gerade nachfragen, doch in diesem Moment sehe ich sie auch: zwei SS-Offiziere, die über die Brücke auf uns zukommen. Laut redend, mit großen Gesten. Ich verschlucke jedes Wort. Wenn ich halb hinter Vincent gehe, ist mein gelber Stern für sie unsichtbar. Offiziell bewege ich mich noch im erlaubten Rahmen, aber das zählt kaum, wenn sie plötzlich Lust haben, Juden zu quälen.
„Mein Vater ist letztes Jahr gestorben“, sagt Vincent, nachdem wir schweigend an den NS-Leuten vorbeigegangen sind. „Er arbeitete im Hafen. Es war ein Unfall.“
„Mein Vater ist auch tot“, sage ich leise.
Meine Hand umklammert den Apfel in meiner Manteltasche, als würde ich ihn zerquetschen. „Er starb vor vielen Jahren. Ich war noch ein Kind. Er war unheilbar krank.“
Ich denke an meine Mutter. Auch sie ist unheilbar krank. Aber ich schweige. Denn sobald ich das Wort ausspreche, wird es wahr. So existiert noch Hoffnung auf Genesung. Vielleicht ist es Aberglaube. Vielleicht habe ich mehr Eigenschaften von meiner Großmutter geerbt, als mir lieb ist.
„Das tut mir leid“, sagt Vincent.
„Mir auch.“
„Ich war zumindest alt genug, um ihn bewusst zu erleben. Ich erinnere mich an vieles, wie an unsere Sommerurlaube in Langesthal.“ Sein Blick verliert sich für einen Moment am Kirchturm, warm und weit entfernt. Dann verengt er sich schlagartig.
„Pass auf“, flüstert er.