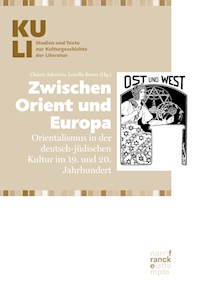
Zwischen Orient und Europa E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: KULI. Studien und Texte zur Kulturgeschichte der Literatur
- Sprache: Deutsch
Der Band hinterfragt den Nutzen des Begriffs "Orientalismus" zur Erforschung der vielfältigen deutsch-jüdischen kulturellen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei wird Orientalismus einerseits als postkolonialer Diskurs verstanden, der Identitätskonflikte und Sprachprobleme der jüdischen Diaspora in den Blick nimmt, andererseits als philologische Wissenschaft vom Orient. Die Beiträge behandeln folgende Fragen: In welchem Maße wurden deutsche Juden vom zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskurs über den "Orient" und den "Orientalen" beeinflusst bzw. gestalteten ihn mit? Wie tief verinnerlichten Juden die stereotypen Bilder ihrer Umgebung und inwiefern konnten die deutsch-jüdischen Orientalisten diese Vorurteile und deren philosophische Legitimierung wissenschaftlich widerlegen? Wie veränderte sich das Bild des Orients, als viele emigrierte deutsche Juden sich in Palästina mit dem "wahren" Orient konfrontiert sahen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chiara Adorisio / Lorella Bosco
Zwischen Orient und Europa
Orientalismus in der deutsch-jüdischen Kultur im 19. und 20. Jahrhundert
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-7720-8642-7 (Print)
ISBN 978-3-7720-0068-3 (ePub)
Inhalt
Zwischen Orient und Europa. Orientalismus in der deutsch-jüdischen Kultur im 19. und 20. Jahrhundert
Einleitung
Seit der Veröffentlichung von Eduard Saids einschlägigem Buch Orientalism (1978) ist der Terminus „Orientalismus“ zu einem der zugleich am kontroversesten diskutierten und am meisten verwendeten Begriffe auf dem Feld der Geistes- und Sozialwissenschaften avanciert. Er hat zudem weitere Entwicklungen im Bereich der Kolonialen und Postkolonialen Studien eingeleitet und zu einer Horizonterweiterung der Geisteswissenschaften beigetragen. In Anlehnung an Foucaults Theorien versteht Said unter ,Orientalismus‘ den europäischen Orientdiskurs, „a set of representative figures, or tropes“,1 welcher mithilfe ideologischer Konstruktionen die politische und kulturelle Autorität der westlichen Mächte über die als subaltern eingestufte orientalische Welt instituiert und verstärkt hat. Orientalismus, als Ergebnis westlicher Wissensproduktion über den Orient, bringt einen ,orientalisierten‘ Orient2 hervor, welcher als das Andere schlechthin geschildert wird. Darüber hinaus betont Said, dass die Entwicklung der Wissenschaften im Westen mit der Konstruktion des ,Orientalen‘ und des ,Orientalischen‘ eng einhergeht, zumal das Wort ,Orientalismus‘ ursprünglich das philologisch fundierte Studium der „orientalischen“ Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Hindustani, Japanisch, Persisch und Türkisch u.a.) bezeichnete. Man denke etwa – im Hinblick darauf – an die sprachwissenschaftlichen Wurzeln des sich im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich etablierenden „arischen Mythos“.3
Saids Thesen einer für das westliche Denken charakteristischen grundlegenden Dichotomie zwischen Orient und Okzident, zwischen einem orientalischen Objekt und einem beherrschenden westlichen Subjekt, haben eine breite Debatte angeregt und Kritiken hervorgerufen. Der Haupteinwand bestand in der theoretisch-methodischen Unschärfe von Saids Ausführungen, welche nicht selten auf essentialistische und eurozentrische Positionen verfallen. Man warf Said vor allem die ungenügende Kenntnis der marxistischen Philosophie und die nicht immer stringente Einbettung von Foucaults und Gramscis Gedanken in das theoretische Gerüst seines Buches vor. Auch die Gender-Implikationen des Orientalismus-Diskurses sind bei ihm weitgehend ausgeblendet.4 In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Saids Thesen, vor allem im Hinblick auf die deutsche Orientalistik des 18. Jahrhunderts, bemerkt Katherine Arens deshalb:
Said’s Orientalism is thus an Orientalizing methodological fantasy, just as it is a map of a particular imaginary European colonialism. He takes Arab/Islamic and Christian cultural blocks as monolithic; he ignores the ways in which the material practice and dissemination of institutionalized knowledge bases vary, across history and across national lines; and he rejects any notion that local everyday practices might impact blanket Orientalist attitudes. His is a world without stable bilingualism, competing class, gender, and ethnic positions within the nationalist identity, pilgrimages, crusades, business trips, and beneficial relationships across block lines.5
Einwände kamen vor allem aus dem Lager von Intellektuellen und Wissenschaftlern aus den einst ‚subalternen‘ Ländern.6 Homi K. Bhabha z.B. hat an Saids postkoloniales Paradigma angesetzt und es revidiert. Er greift auf strukturalistische Philosophie, auf Semiotik und Psychoanalyse zurück, um die Starrheit von Saids Dichotomien durch den zentralen Begriff der kulturellen Differenz zu lockern und den Blick stattdessen auf die Aushandlungsprozesse zwischen den Kulturen zu lenken. Sie finden nicht nur an den Peripherien, sondern schon immer im Zentrum statt. Differenzen betreffen also zugleich das Außen und das Innen von Kulturen und Subjekten, sie trennen und verbinden gleichzeitig, indem sie die Grenzen zwischen Fremdem und Vertrautem ständig verschieben, neu definieren, anders setzen oder gar unterlaufen. Darüber hinaus beschreibt Bhabha ein „in-between“ oder „third space“ innerhalb der und zwischen den Kulturen und Individuen, wo Identitäten und Positionen in einem ständigen und ununterbrochenen Verhandlungsprozess hervorgebracht und modelliert werden.7
The concept of cultural difference focuses on the problem of the ambivalence of cultural authority: the attempt to dominate in the name of a cultural supremacy which is itself produced only in the moment of differentiation. […] Cultures are never unitary in themselves, nor simply dualistic in the relation of Self to Other.8
Bhabha hat dabei das Konzept von „kultureller Hybridität“9 herausgearbeitet, welches sich jeder hegemonialen Denkkategorie und jedem Versuch, die orientalischen Kulturen zu definieren und zu kontrollieren, entzieht. Der Begriff bezeichnet die prozessuale und schöpferische Transformation von Identitäten und die Neubesetzung von eindeutig kodierten, hegemonischen Zuordnungen, die auf diese Weise polysemische, ambivalente, widersprüchliche Zeichen hervorbringen. Diese Strategie der Veruneindeutigung stellt insofern einen Gegenentwurf zu Saids binärer Denkstruktur dar, als sie auf beiden Seiten wirksam wird, sie betrifft also sowohl die Kolonisatoren als auch die Kolonisierten. Durch die Entwicklung von Mimikry-Strategien können die ,Orientalen‘ zudem koloniale Herrschaftsstrukturen subversiv und erfolgreich unterwandern. Bhabha bringt dieses Verfahren auf die Formel „the ambivalence of mimicry, always the same, but not quite […] almost the same but not white.“10
In seinem Buch hatte Said außerdem bestritten, dass Deutschland – aufgrund der bis zur Reichsgründung andauernden politischen Fragmentierung – eine mit dem britischen oder französischen Orientalismus vergleichbare Rolle gespielt hätte. Said hatte zwar erkannt, dass deutsche Wissenschaftler und Orientforscher zur Etablierung der Orientalistik und letztendlich eines Orientalismus-Diskurses maßgeblich beigetragen hatten, ohne jedoch auf ihre Arbeit und ihre Spezifizität näher einzugehen. Unter den Wissenschaftlern, die Saids Thesen weiterentwickelt oder zurechtgewiesen haben, findet sich auch Susanne Marchand mit ihrem 2009 veröffentlichten Buch German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race and Scholarship.11 Dieses Buch ergänzt Saids Studie, indem es unterstreicht, wie deutsche Wissenschaftler zur Wiederentdeckung und zum Studium der orientalischen Literatur und Philosophie beigetragen haben, obwohl sie von Vorurteilen und imperialistischen Interessen nicht frei waren. Marchand schreibt:
We need […] a synthetic and critical history, one that assesses oriental scholarship’s contributions to imperialism, racism, and modern anti-Semitism, but one that also shows how modern orientalism has furnished at least some of the tools necessary for constructing the post-imperialist worldviews we cultivate today.12
Marchand konzentriert sich in ihrem Buch auf einige der prominentesten deutschen ,Orientalisten‘, z.B. Heymann Steinthal, Max Müller, Carl Heinrich Becker, Ignaz Goldziher, Carl Brockelmann, Theodor Noldeke, deren Werke und Tätigkeit Saids Thesen widersprechen. Sie stellt klar, dass in ihrem Buch der Begriff „Orientalismus“ beschrieben und definiert wird als:
a set of practices, practices that were bound up with the Central European institutional settings in which the sustained and serious study of the languages, histories, and cultures of Asia took place. Many, but by no means all, of the scholars treated in this book actually did call themselves “orientalists” – some would have described themselves as theologians, classicists, historians, geographers, archaeologists, or art historians.13
Obwohl Deutschland bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein von den politischen und imperialistischen Auswirkungen des Orientalismus weitgehend ausgeschlossen blieb, waren die deutsche Wissenschaft und Philologie an der Hervorbringung eines Wortschatzes, eines Wissens und eines hegemonialen Denkens über den Forschungsgegenstand ,Orient‘ beteiligt. Methoden und Ergebnisse der deutschen Wissenschaft trugen zur Etablierung kolonialer Machtverhältnisse erheblich bei. Im deutschsprachigen Raum haben Wissenschaftler deshalb auf Saids zugleich einengende und verallgemeinernde Verwendung des Begriffs ,Europa‘ verwiesen, der bei ihm mit Großbritannien oder Frankreich gleichzusetzen ist,14 und ihm die Ausblendung der Orientalistik im 18. Jahrhundert („insensitivity to eventual differences between eighteenth- and nineteenth-century scholarship and nation-states“)15 vorgeworfen, die ja andere Fragestellungen aufwirft und einen ausdifferenzierteren Zugang erfordert. Diese Kritik trifft teilweise auch auf Susanne Zantops Konzept der colonial fantasies16 zu, das im Wesentlichen Saids Thesen – vor allem im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen einem manifesten und einem latenten Orientalismus – zu teilen scheint.17 In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Saids Orientalismus-Theorien hat Andrea Polaschegg 2005 deshalb den Begriff eines „anderen Orientalismus“ geprägt. Ihr zufolge habe Said seine Thesen, die fast ausschließlich aus der Erforschung der englischen und französischen Kultur- und Wissensschaftslandschaft zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert hervorgehen, auf das gesamte Spektrum der westlichen Beziehungen mit dem Orient angewandt. Die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte scheint jedoch seinem Konzept nicht zu entsprechen. Autoren wie Wieland, Herder, Voss, Hammer-Purgstall, Goethe, Platen, Rückert oder Hauff weisen eine „deutsch-morgenländische Imagination“ auf, deren Regeln sich durch eine nicht hegemonisch geprägte Auseinandersetzung mit dem in seiner Eigenheit anerkannten Orient auszeichnen und zu einer produktiven Anverwandlung und Übersetzung von Texten aus nicht westlichen Kulturen führen.18 Konstruiert wird auf diese Weise nicht nur das Fremde, sondern auch das Eigene.
Die kritischen Revisionen, denen der Orientalismus-Begriff in seiner ursprünglichen Prägung durch Said und die postkoloniale Kritik unterzogen worden ist, haben einen nachhaltigen Einfluss nicht nur auf die Erforschung der Beziehungen zwischen Osten und Westen ausgeübt. Sie haben seinen ausdifferenzierteren Zugang zum Verständnis der Beziehungen zwischen Mehrheiten und Minderheiten in unterschiedlichen Ländern und politisch-gesellschaftlichen Kontexten ermöglicht. Gerade im Hinblich auf das, was Ulrike Brunotte, Anna-Dorothea Ludewig und Axel Stähler den deutschen „colonial exceptionalism“19 nennen, gilt es, den Blick auf die Verflechtungen zwischen den politischen und ökonomischen Aspekten des Kolonialismus und der Wahrnehmung des Fremden sowohl außerhalb als auch innerhalb nationaler und kultureller Grenzen zu lenken. Hier kommt man an den Knotenpunkt von Orientalismus- und Antisemitismusdiskursen, auf den auch Said in seinem Vorwort zu Orientalism verwiesen hat.20 Vor allem in den USA sind die Jewish Studies vor dem Hintergrund der Multikulturalismusdebatte diesen Verflechtungen nachgegangen und haben ihre Auswirkungen auf die Entwicklung zionistischer Diskurse und auf die Bildung des Staats Israel erforscht. Susannah Heschel hat beispielweise behauptet: „although the Jews did not constitute a territory colony of Europe, they formed an internal colony within Europe, under the domination of christian powers.“21 Aufgrund ihrer weit zurückliegenden orientalischen Wurzeln wurden Juden häufig (nicht immer im positiven Sinn) als Orientalen bezeichnet und verwendeten nicht selten diese Benennung als Selbstdefinition. Bedenkt man außerdem die Rolle der jüdischen Minderheiten innerhalb der deutschsprachigen Länder, scheint es von Belang, die Bedeutung von ,Orient‘ und ,Orientalismus‘ sowohl als theoretisch-wissenschaftliche Begriffe als auch als Leitbilder der deutsch-jüdischen Beziehungen zu hinterfragen und die Rolle zu analysieren, welche sie in der Selbstdefinition der jüdischen Minderheit spielten. So hat etwa die Historikerin Shulamit Volkov die Spezifizität des jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum vor dem Zweiten Weltkrieg als einen „dritten Raum“ zwischen der Loyalität zur eigenen Tradition und Kultur und der Sehnsucht nach Integration in die Mehrheitkultur aufgefasst: „Die meisten von ihnen [den Juden, scil.] lebten in einer dritten Sphäre, die sich während des Jahrhunderts langsam entwickelte. Sie lebten in ihrem eigenen deutsch-jüdischen Kultursystem […], vertraten eine Vielzahl widerstreitender ideologischer Positionen und versuchten, eine gemeinsame jüdische Tradition zu konstruieren.“22 In diesem Raum verkörpern Juden die ambivalente Rolle der Kolonisierten und der Kolonisierer, der insiders und der outsiders zugleich.23 Sie werden vom zeitgenössischen Diskurs über den ,Orient‘ und den ,Orientalen‘ beeinflusst und gehen affirmativ oder ablehnend damit um. Auf mehr oder weniger tiefgreifende Weise interiorisierten Juden die stereotypischen Bilder, Vorurteile und Klischees ihrer Umgebung und setzten sich damit auseinander.24
Im Hinblick darauf nehmen die Werke deutscher Orientalisten jüdischer Herkunft, deren Leistungen Said in seinem Werk kaum würdigt, einen Stellenwert ein. Erst mit der Entstehung und Etablierung einer Wissenschaft des Judentums im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurden die in der deutschen Orientalistik zum Stereotyp geronnenen Vorstellungen des Orients neu thematisiert und hinterfragt. Zu dieser Zeit eröffneten deutsch-jüdische Intellektuelle und Wissenschaftler, die gleichzeitig Hebräisch, Arabisch und selbstverständlich Deutsch beherrschten, neue Perspektiven auf den Orient und insbesondere auf den kulturellen Austausch zwischen dem Osten und Westen, vor allem im Hinblick auf die wechselseitigen Einflüsse zwischen beiden Welten im Mittelmeerraum. Sie propagierten ein meist positiv besetztes Bild des Orients. Angesichts des prekären Status deutsch-jüdischer Gelehrten und Wissenschaftler an deutschen Universitäten, entschieden sich einige von ihnen für die Emigration nach Frankreich, wo sie günstigere Arbeitsbedingungen fanden.25 Ihnen ist die Etablierung der Jüdischen Studien als eigenständiges Fach an den europäischen Universitäten zu verdanken. Dieses Projekt, das 1818 mit der Gründung des Vereins für die Wissenschaft des Judentums von Leopold Zunz initiiert wurde, wurde zunächst von Zunz selbst und dann von Salomon Munk in Frankreich fortgesetzt. Für Zunz und seine Schüler und Mitgründer der Wissenschaft des Judentums stellte jede Manifestation jüdischen Lebens und jüdischer Kultur den Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung dar. Linguistik und Komparatistik, Philologie, Geschichte, Archäologie und Philosophie bildeten das Instrumentarium, mit dessen Hilfe die deutsch-jüdischen Gelehrten ihre Ziele realisieren wollten. Nach der Gründung des Vereins konzipierte Zunz gemeinsam mit Abraham Geiger und Eduard Gans das Projekt einer Reihe von kommentierten Übersetzungen jüdischer und arabischer Texte in die jeweiligen europäischen Zielsprachen (Deutsch und Französisch). Salomon Munk war z.B. derjenige, der die erste Übersetzung von Maimonides’ Führer der Unschlüssigen aus dem judäoarabischen Original ins Französiche anfertigte. Seine Übertragung bildet – neben Ibn Tibbons hebräischer Übersetzung – bis heute einen durchaus wichtigen Bezugstext zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Maimonides. In vieler Hinsicht leisteten deutsch-jüdische Wissenschaftler Pionierarbeit, indem sie nicht nur die wichtigsten religiösen und philosophischen Strömungen innerhalb des Judentums und des Islams untersuchten, sondern auch auf die Beziehungen dieser Strömungen zu christlichen Denktraditionen eingingen.
Ziel des vorliegenden Bandes ist es, der Vielfalt der deutsch-jüdischen Auseinandersetzung mit den Orient- und Orientalismusdiskursen im 19. und 20. Jahrhundert in einer fachübergreifenden Perspektive auf die Spur zu kommen. Deutsch-jüdische Intellektuelle hinterfragten die Grenzen zwischen orientalischer und westlicher Kultur und situierten sich an der Schnittstelle von linguistischen, ethnischen und nationalen Identitäten. Ihre Perspektive dynamisierte herkömmliche, in Dichotomisierungen gesetzte nationale Grenzziehungen.
Der vorliegende Sammelband vereint zwanzig Beiträge. Ihre Reihenfolge richtet sich nach der Chronologie der behandelten Themen. Der Band setzt mit Dominique Bourels (Paris) Beitrag zur Geschichte der deutsch-jüdischen Orientalistik ein. Er erläutert dabei die Rolle, die deutsch-jüdische Intellektuelle im Umkreis der Wissenschaft des Judentums bei der Herausbildung einer eigenständigen, vom Studium der klassischen Philologie unabhängigen Wissenschaft der orientalischen Sprachen und Kulturen spielten. Er hebt dabei auch den Beitrag hervor, den deutsch-jüdische Wissenschaftler (Derenbourg, Oppert, Munk, um nur einige Beispiele zu nennen) im Kulturtransfer zwischen Deutschland und Frankreich leisteten. Deutsch-jüdische Orientalisten (Horovitz, Weil) spielten ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Etablierung ihres Faches an den Hochschulen in Palästina und später in Israel.
Anknüpfend an Bourels Schilderung der deutsch-jüdischen Orientalistik geht Chiara Adorisio (Rom) auf das Werk von Salomon Munk (1803-1867) ein, der Anfang des 19. Jahrhunderts nach Paris auswanderte, um dort seine Studien fortzusetzen. Er zählt zu den interessantesten, zugleich aber auch am meisten vernachlässigten deutsch-jüdischen Orientalisten und Philosophiehistorikern. Mit seinen Entdeckungen im Bereich der Geschichte der jüdischen und islamischen Philosophie des Mittelalters hat Munk nicht nur einem neuen Forschungsgebiet den Weg gebahnt, sondern auch die deutsche und französische Philosophiegeschichtsschreibung beeinflusst und zudem den Orientalismus seiner Epoche kritisiert, indem er auf der Grundlage einer genauen philologischen Kenntnis der mittelalterlichen Quellen des jüdischen, islamischen und christlichen Denkens die Kategorien ,Orient‘ und ,Okzident‘ neu überdacht hat. Michael Engel (Hamburg) diskutiert den Fall der unglücklichen Rezeptionsgeschichte von Eljia del Medigo. Die moderne Geschichtsforschung habe ihn bloß als rationalistischen Philosophen und Vorläufer der modernen Vernunftauffassung verstanden, dabei sei er in seiner Komplexität als ein auch an kabbalistischen und mystischen Quellen des jüdischen Mittelalters interessierter Philosoph kaum erfasst worden.
Maria Carolina Fois (Triest) und Mauro Ponzis (Rom) Beiträge arbeiten die vielfältigen Darstellungen sowohl des nahen als auch des europäischen Ostens in der deutsch-jüdischen Literatur des 19. Jahrhunderts heraus. Foi untersucht Heines ,west-östliche‘ literarische Experimente, die zwischen 1821 und 1824 im Kontext seiner Auseinandersetzung mit der Arbeit des Vereins für Cultur und Wissenschaft des Judentums und mit den ersten Forschungsergebnissen der Wissenschaft des Judentums entstanden. Sie lenkt dabei das Augenmerk auf Heines west-östliche Verschiebungsprozesse und auf das Hybridisierungsverfahren von romantischen Themen und Motiven, die in Heines Frühwerk – vor allem in Über Polen und in Der Rabbi von Bacherach – ihre Entfaltung finden. Ein wichtiger Aspekt von Heines Konfrontation mit dem Judentum sei dabei die Auseinandersetzung mit den Ostjuden. Von Heines Werk ausgehend präsentiert Mauro Ponzi das Werk von Leopold Zunz, dem Gründer des Vereins für die Wissenschaft des Judentums, als Versuch der Selbstfindung im Spannungsfeld von Bewusstsein um die eigene jüdische Identität und Assimilation. Mit ihrer Forschungsarbeit hätten deutsch-jüdische Intellektuelle im Umkreis der Wissenschaft des Judentums das nationalistische Postulat der Reinheit der Kultur in Frage gestellt und stattdessen auf die kulturellen Zwischenräume und Hybridisierungsprozesse aufmerksam gemacht, wie es vor allem bei Heine ersichtlich wird. In Marina Foschi Alberts (Pisa) Essay geht es hingegen um eine bedeutende Facette der vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Orient im 19. Jahrhundert, nämlich um Friedrich Rückerts Übersetzung orientalischer Texte ins Deutsche. Seine Übertragungen, die den ,orientalistischen‘, exotischen Erwartungen des damaligen Publikums nicht entsprachen, versuchten, die deutsche Sprache durch die Übernahme fremdsprachlicher Konstruktionen zu bereichern, wie Foschi vor allem am Beispiel sanskritischer Wortverbindungen zeigt. Kathrin Wittler (Berlin) untersucht die Bedeutung deutsch-jüdischer Anthologien orientalischer Dichtung – vor allem Heimann Jolowiczs Polyglotte der orientalischen Poesie (1853), Blüthenkranz morgenländischer Dichtung (1860); Ludwig August Frankls Libanon. Ein poetisches Familienbuch (1855) – bei der Vermittlung jüdischer literarischer Texte an ein breites Publikum und bei ihrer Einbettung in den deutschsprachigen Kanon. Sie analysiert ferner die diskurspolitische Dimension dieser Textsammlungen, die auch durch ihre Aufmachung und Ausstattung die jüdische literarische Überlieferung zwischen Osten und Westen verorten.
Die mittleren Beiträge des Sammelbandes befassen sich mit weiteren Aspekten des deutsch-jüdischen Orientalismus, vor allem im Hinblick auf den aufkommenden Zionismus und auf den Kulturzionismus. Roberta Ascarelli (Rom) bettet ihre Lektüre von Theodor Herzls Roman Altneuland in die Rekonstruktion der Entstehung und Entwicklung des Zionismus auf europäischer und deutschsprachiger Ebene ein. Sie betont zudem Herzls Desinteresse am Exotismus und seine folgenreiche Unterschätzung der arabischen Frage. An der Rezeption der Figur des Shabbatai Zewi im Roman zeige sich außerdem, wie der anfängliche Erfolg des falschen Messias allein auf die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach einer Erlösung zurückzuführen sei, die erst durch den Zionismus konkrete Gestalt annehmen könne. Doerte Bischoff (Hamburg) setzt sich mit dem essaystischen Werk Jakob Wassermanns und dessen scharfem Bewusstsein um die ambivalente Stellung des Juden, vor allem des jüdischen Schriftstellers, in der Moderne auseinander. Durch das Konzept des „Juden als Orientalen“ plädiere Wassermann für ein diasporisches Verständnis des westlichen Judentums als Widerstandsform gegen die Rhetorik der Assimilation einerseits und des Nationalismus andererseits. Anhand der Erfindung des authentischen Juden als Orientalen schildert Massimiliano De Villa (Rom) die Beziehung zwischen Orientalismus und Judentum im deutschen Kulturzionismus und fokussiert dabei vor allem auf Martin Bubers Mythos des Ostjudentums und auf Else Lasker-Schülers Orientsbild in den Hebräischen Balladen. Im Rahmen des ästhetischen Programms einer jüdischen Renaissance am Anfang des 20. Jahrhunderts erscheinen sowohl der Jude als Orientale als auch der biblische Jude als positive Gegenentwürfe zu den zeitgenössischen deutschen Juden, sie weisen aber zugleich auch auf das Spannungsfeld zwischen Faktualität und Fiktionalität, Wirklichkeit der deutsch-jüdischen Beziehungen und deren symbolischer Überhöhung hin. Else Lasker-Schülers Orientalismus widmet sich ebenfalls Christine Kanz (Linz). Sie erläutert in ihrem Beitrag die Abgrenzungsstrategien (nicht zuletzt die orientalisierenden Ich-Figurationen) der Erzählerin in Mein Herz. Lasker-Schüler hebe ihre Andersheit und Fremdheit bewusst hervor, um ihre Identität als Frau, Jüdin und avantgardistische Künstlerin neu zu definieren. Es gehe dabei vorwiegend um einen strategischen und inszenatorischen Orientalismus, der sich zwischen verschiedenen heterogenen kulturellen Identitäten positioniert. Mark H. Gelber (Negev) spürt die Positionierung der Prager Kulturzionisten (Buber, Bergmann, Brod, Kohn) im Hinblick auf die Araberfrage und auf deren Lösungsmöglichkeiten nach und unterstreicht damit die Bedeutung von Kafkas Erzählung Schakale und Araber, die auf diesen Hintergrund vielfach Bezug nimmt. Gabriele Guerra (Rom) knüpft an Mark Gelber unmittelbar an und untersucht dabei die Reterritorialisierung des Symbolischen in der schon zitierten Erzählung Kafkas Schakale und Araber. Der Text verweigere jede eindeutige politische Lesart, denn Schakale ließen sich – aufgrund ihrer symbolischen Besetzung im alten Ägypten – nur teilweise mit den Juden identifizieren. Die Erzählung stelle zugleich eine Parodie pseudomessianischer Erwartungen dar. Lorella Bosco (Bari) widmet sich in ihrem Beitrag Arnold Zweigs Roman De Vriendt kehrt heim. Sie zeigt, wie De Vriendts Positionierung zwischen Juden, Arabern und Engländern, Orient und Okzident mithilfe binärer Kategorien nicht beizukommen ist. Die Ambivalenz des Helden überträgt sich auf die Schilderung der Stadt Jerusalem, die Fremdheit und Zugehörigkeit zugleich verkörpert. Jerusalem erscheint als hybrider Ort, in dem nationale, ethnische, kulturelle, religiöse und nicht zuletzt geschlechtliche Kodierungen ins Wanken geraten. Giuliano Lozzi (Rom) untersucht Margarete Susmans Positionierung innerhalb des Kulturzionismus – ausgehend von Vom Sinn der Liebe und Spinoza und das Weltgefühl bis zum Buch Hiobs und das Schicksal des jüdischen Volkes. Dabei hebt er hervor, wie sich Susmans Zionismus, in seinem Versuch, Differenzen produktiv zu verarbeiten, von Herzls Konzept distanziert und stattdessen auf eine Auffassung von Staat und Nation abzielt, die auf der Gemeinschaft der Seele und auf dem Monotheismus ruht.
Zwei weitere Beiträge setzten sich mit dem Thema Orientalismus und Prophetie auseinander. Vivian Liska (Antwerpen) greift Blanchots Auffassung der prophetischen Rede in La parole prophétique auf, um – vor allem anhand von Else Lasker-Schülers Werk – den Zusammenhang zwischen Prophetie, Orient, Krise (vor allem Sprachkrise) einerseits und der Suche nach neuen dichterischen Ausdrucksformen in der Moderne zu erläutern. Liska unterscheidet zwischen einer nicht-jüdischen Moderne (George, Nietzsche, Ball), die sich an das Vorbild des poeta vates anlehnt, und einer jüdischen (Ehrenstein, Mynona, Lasker-Schüler), die den Dichter als biblischen Propheten und Apokalyptiker stilisiert. An die Funktion der prophetischen Rede in der Moderne knüpft auch Eva Kocziszky (Veszprém) an. Sie stellt Yvan Golls prophetischen Gestus ins Zentrum ihres Beitrags. Ausgehend von der Feststellung des unaufhaltsamen Zerfalls Europas und der Erkaltung des jüdischen Lebens und der Welt, entwerfe Goll in seiner Lyrik ein universalistisches Konzept des Judentums, dessen Züge der Nomadismus, der Kosmopolitismus und die Verbindung mit dem Hellenismus und dem Katholizismus seien.
Irene Kajon (Rom) argumentiert am Beispiel der Rezeption von Henri Pirennes 1937 posthum erschienenem Buch Mahomet et Charlemagne, wie die deutsch-jüdischen Intellektuellen während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts einen Kosmopolitismus entwickelten, der die Dichotomie zwischen Orient und Okzident in Frage stellte. Aby Warburg, Ernst Cassirer, Erwin Panofsky und Raymond Klibansky untersuchten deshalb vor allem Aspekte der westlichen Kultur, an denen die Üperlappungen zwischen Orient und Okzident besonders hervortraten.
Die letzten zwei Beiträge gehen Aspekten des orientalistischen Diskurses nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoah auf die Spur. In ihrem Celan gewidmeten Beitrag verfolgt Camilla Miglio (Rom) einen geopoetischen Ansatz, um die semantische Vielschichtigkeit des Wortes ,Osten‘ bei Paul Celan auszuloten. Wie es sich besonders in den Briefen an die rumänischen Freunde zeigt, verwende Celan das Wort ,Osten‘ während seiner Pariser Jahre als Negation seiner westlichen politischen und kulturellen Umwelt, in der er sich nie heimatlich fühlte. Er habe deshalb – ähnlich wie Kafka oder Roth – einen inneneuropäischen Orientalismus entwickelt, dessen semantische und begriffliche Tragweite im Wort ,Ägypten‘ zur Sprache kommt. Ägypten bezeichne einen „A-Topos“, einen Zwischenraum, der sich weder mit ,Exil‘ noch mit ,Heimat‘ identifizieren lasse. Anhand von Elias Canettis Die Stimmen von Marrakesch legt Giulia A. Disanto überzeugend nah, wie Canettis Reise als Suche nach einem Ursprung zu verstehen ist, der mit den eigenen sephardischen Wurzeln eng verbunden ist. Sie sei deshalb von tiefen Ambivalenzen gezeichnet, weil Canettis jüdische Identität dem ,Westen‘ zuzuschreiben sei. Das stelle Saids West-Ost-Dichotomie in Frage, obwohl die Erzählstimme einen westlichen Standpunkt annimmt. Auch die Grenzziehung zwischen Fremdem und Eigenem beginne im Laufe der Reise zu bröckeln.
Der vorliegende Band versammelt die Beiträge des Humboldt-Kollegs „Zwischen Orient und Europa: Orientalismus in der deutsch-jüdischen Kultur im 19. und 20. Jahrhundert“, das vom 3. bis 5. November 2016 am Istituto Italiano di Studi Germanici in Rom stattfand. An der Tagung nahmen HumboltianerInnen und andere AkademikerInnen aus Europa und aus Israel teil. Die Tagung wurde von den Herausgeberinnen organisiert. Die Vorbereitung und die Durchführung der Konferenz wären ohne die Unterstützung der Alexander-von-Humboldt-Stiftung nicht möglich gewesen. Ihr gilt an dieser Stelle unser besonderer Dank. Unserem Gastgeber, dem Istituto Italiano di Studi Germanici, und dessen Leiterin, Prof. Dr. Roberta Ascarelli, sei ebenfalls herzlich gedankt. Ziel der Tagung war es, im Austausch der eingeladenen WissenschaftlerInnen – vom Orientalismusdiskurs ausgehend – das breite Spektrum und die Vielfalt deutsch-jüdischen Lebens im 19. und 20. Jahrhundert zu beleuchten und neue interdisziplinäre Perspektiven zu eröffnen. Bei der Herausgabe der Beiträge haben die Herausgeberinnen die drei Tagungssprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch) bewusst beibehalten.
Die Publikation dieses Buches wurde durch einen substantiellen Kostenzuschuss der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ermöglicht, bei der wir uns auch dafür aufrichtig bedanken möchten.
Bari/Berlin/Rom, Mai 2018
Die Diaspora der deutsch-jüdischen Orientalisten in Paris und in Jerusalem1
Mohamed Arkoun in memoriam
Die Frage nach der jüdischen Orientalistik ist seit etlichen Jahren akut geworden. Nicht jene Bewegung in der Malerei ist damit gemeint, die sich mit orientalischen Themen und Motiven auseinandersetzte, sondern die Geschichte der Orientforschung bei jüdischen Philologen, Philosophen oder Historikern. Unmittelbar nach der Entstehung der Wissenschaft des Judentums anfangs des 19. Jahrhunderts in Deutschland fragte Abraham Geiger 1833: Was hat Mohammed aus dem Judenthumegenommen2. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben jüdische Gelehrte ihre Aufmerksamkeit dem Islam gewidmet. Dazu gibt es verschiedene Gründe. Wir wissen, dass ein Großteil der jüdischen Geschichte auf islamischen Boden stattfand und auf Arabisch geschrieben wurde. Fromme Juden, die nicht Rabbiner werden wollten, fanden in der Islamwissenschaft eine neue Bildungsnische. Die Jungen, die Hebräisch konnten und an der Universität eine andersweitige klassische Bildung erhielten (Griechisch und Latein), hatten die beste Voraussetzung, gute Orientalisten zu werden.
Wir werden unsere Ausführungen in zwei Teilen darstellen: In einem europäischen Teil mit Schwerpunkt Frankreich und einem zweiten Teil über Jerusalem. In beiden Fällen war die deutsche wissenschaftliche Bildung grundlegend, und die Wissenschaft des Judentums eng mit der Islamkunde verknüpft, was heute aus verschiedenen Gründen weniger der Fall ist.
In Deutschland wurde die Arabistik im Rahmen der Semitistik unterrichtet. Da Deutschland keine Kolonien besaß, wurde die Kenntnis der arabischen Sprachen und Kunde zur rein akademischen Angelegenheit. In Frankreich waren die Bedingungen ganz unterschiedlich, weil seit 1830 Algerien ein Teil des Französischen Reiches und später der Republik wurde. Inzwischen kennen wir – dank der Bücher von Henry Laurens, Alain Messaoudi und François Pouillon3 usw. – die Geschichte des französischen wissenschaftlichen Orientalismus ziemlich gut. Diese Studientradition wurde von Raymond Schwab mit seinem epochemachende Buch La renaissanceorientale eingeleitet.4 Man kann aber schon früh den wissenschaftlichen Austausch und die Konkurrenz zwischen Franzosen und Deutschen, Juden oder Nichtjuden beobachten.5
Zu diesem institutionsgeschichtlichen Ausblick sollten wir hinzufügen, dass die Orientalistik in Deutschland meistens an den Universitäten vertreten war. In Frankreich wurde sie sowohl am Collège de France6 als auch an der Ecole des langues Orientales7 und dann an der École Pratique des Hautes Études (EPHE) nach dem deutschen Modell gegründet8 und gelehrt. Da in Frankreich die Universität sich allmählich eher in eine Diplomfabrik entwickelte, war die EPHE als eine Institutionalisierung der angestrebten Harmonie zwischen Forschung und Lehre konzipiert, mit der berühmten Erfahrung der ,Seminare‘, die nicht als Vorlesungen konzipiert waren. Deswegen heißt die École – die in der Sorbonne beheimatet ist – pratique. Besonders nach dem Preußisch-Französischen Krieg, bei dem bekanntwerweise nicht nur die Armee, sondern auch die Lehrer (instituteurs) gewonnen hatten, wurde die École erweitert. Und dort fand man Juden aus Deutschland, die in ihrer Heimat keinen Platz erhalten hatten.9 Heute noch ist die EPHE ein Ort, an dem die neuen Disziplinen Eingang in den Lehrbetrieb finden, bevor sie an der Universität anerkannt werden.
In Frankreich wurde ein Teil der Orientalistik und der Wissenschaft des Judentums zum Schlachtfeld zwischen Franzosen und Deutschen, besser gesagt: zwischen Katholiken und Protestanten! Es fängt im Grunde genommen schon mit Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)10 an. Im Deutschland des 18. Jahrhunderts wurde die Entwicklung der Orientalistik in eine von den Bibelstudien emanzipierte Wissenschaft zur neuen Aufgabe des Faches. Allmählich emanzipierte sich die Arabistik von der Hebraïstik und der Theologie und dank mehrerer wissenschaftlicher Reisen, linguistischer Entdeckungen und des konsequenten Wissenszuwachses entstand ein neues Forschungsfeld. Der erste Aufsatz von Silvestre de Sacy wurde in Deutschland veröffentlicht, aber zu ihm strömten viele deutsche Orientalisten.
Inzwischen hatte die französische Revolution die Juden emanzipiert. Preußen und andere deutsche Staaten wollten auch ähnliche Prozesse in die Wege leiten, änderten aber sehr schnell – besonders nach 1815 – den Kurs oder legten gar diesen Plan ad acta. Das erklärt die Masse deutscher Flüchtlinge, die nach Frankreich und besonders nach Paris kamen. Darunter befanden sich zahlreiche Juden. Im Rahmen der Transfer-Studien11 sind bereits viele Publikationen zu diesem Thema entstanden. Selbstverständlich bleibt es für die Orientalisten nach wie vor von großer Bedeutung.
Um die Unterschiede zwischen der französischen und der deutschen Forschungsmentalität besser zu veranschaulichen, auf welche die ausgewanderten Wissenschaftler stießen, werde ich nun ein Beispiel aus einem anderen Bereich, der Philosophie, anführen. Es betrifft Kant. Wilhelm von Humboldt, der damals in Paris weilte, hatte mit den besten Köpfen der französischen Philosophie diskutieren wollen. Also wurde er kurzerhand zu einem Gespräch eingeladen: Am 17. Mai 1798 fand sein erstes metaphysisches Gespräch mit Destutt de Tracy statt, das dann am 27. Mai – anläßlich einer Methaphysik-Konferenz, zu der Tracy eingeladen wurde – seine Fortsetzung fand. Wilhelm von Humboldt sollte dabei einfach die deutsche Metaphysik darstellen. Sein Fazit war katastrophal! An Friedrich Schiller schrieb er am 23. Juni 1798 über die französischen wissenschaftlichen Gepflogenheiten: „Ihre Vernunft ist nicht unsere, ihr Raum ist nicht unser Raum, ihre Einbildungskraft nicht die unsrige.“12 Ich glaube auch, dass die für unsere Disziplin so relevanten Begriffe von Text, Urtext, Tradition, Wahrheit in Deutschland und in Frankreich eine unterschiedliche Bedeutung haben. Auch die Kataloganordnung in den Bibliotheken erteilte damals Aufschluss über die Benutzungweise, vor allem was den Standort von Bibelausgaben, Kommentaren und Übersetzungen betraf.
Es ist klar, dass die Tradition der deutschen Philologie spezifische Merkmale aufweist. Auch die Universitäten, die Bibliotheken und die Seminare waren anders organisiert als die französischen. Zudem hatten die deutschen Juden eine doppelte Bildung genossen, eine, die aus dem deutschen Wissenschaftssystem stammte und eine andere, die von der traditionell jüdischen Erziehung geprägt war. Sie kamen nach Frankreich, weil dort keine Diskriminierung den Juden gegenüber im Universitätsbereich herrschte. Geboren in Deutschland oder in Osteuropa, waren sie zwei oder dreisprachig aufgewachsen, kamen manchmal direkt aus den Yeschivot, promovierten bei Theodor Mommsen, Ulrich von Wilamowitz Moellendorf, Leopold Ranke, und später bei Friedrich Meinecke. Da diese jungen hochbegabten Juden in Deutschland keine Zukunft hatten, überquerten sie den Rhein, wurden Deutschlehrer, manchmal Bibliotekare und dann schließlich Professoren, in der Provinz und erst dann in Paris und eventuell am Collège de France, das das höchste Ziel einer akademischen Karriere in Frankreich und Europa darstellte.
Es sollen kurz an dieser Stelle vier Institutionen genannt werden, die eine sehr wichtige Rolle für die orientalistischen Studien gespielt haben. Das Collège de France,13 das 1530 gegründet wurde, war mit Lehrstühlen für hebräische und arabische Sprache besonders ausgestattet, um gegen den religiösen und katholischen Einfluss der Sorbonne zu kämpfen. Die École Normale Supérieure (ENS) wurde 1794 im Zug der Französischen Revolution gegründet. Hier wurden die Spitzenschüler schon zwei oder drei Jahre nach dem Abitur rekrutiert. Da diese jungen Dozenten herrvoragend Griechich und Latein beherrschen mussten, war die deutsche Wissenschaft in ENS nicht nur präsent, sondern gar überrepräsentiert.14 Heute noch zeugt die Bibliothek von der Bedeutung der deutschen intellektuellen Präsenz. Die École Nationale des Langues Orientales ist auch ein Produkt der Französischen Revolution. Sie entstand in der Nachfolge der École des Jeunes de Langue15. Die Ecole Pratique des Hautes Etudes wurde 1866 gegründet, um ,Lehre und Forschung‘, das deutsche Modell humboldtscher Prägung, nach Frankreich zu importieren – gegen die strikt rhetorische (katholische) Art der Bildung, die sonst in der Sorbonne zu Hause war. Nach der Niederlage im Jahr 1870/71 wurde auch die EPHE eine Hochburg der deutschen Wissenschaften, an der Protestanten und Juden ungehindert lehren konnten.
Sie werden sofort bemerken, dass die Beispiele, die ich erwähne, aus der deutsch-jüdischen Geistesgeschichte stammen. Es muss noch hinzugefügt werden, dass die jüdischen Gelehrten gar nicht proselitisch arbeiteten – im Gegenteil zu ihren christlichen Hebräistik-Kollegen. Das gilt auch für die Islamwissenschaft. Bernard Lewis hat schon vor Jahren von den „Pro-Islamic Jews“ geredet.16 Sehen wir uns nun – kurz – ein paar Fälle näher an: Heinrich Weil (1818-1909) aus Frankfurt kam 1842 nach Frankreich. Als ein ehemaliger Schüler von Franz Bopp, August Böckh und Gottfried Hermann, hatte er in Leipzig promoviert, 1871-1891 unterrichtete er Griechisch am Tempel der Wissenschaft, an den ENS, nachdem er zuvor in Strasbourg und in Besançon gelehrt hatte. Dass er als Henri Weil auch in der EPHE zu Hause war, braucht nicht betont zu werden. Joseph Dernburg (1811-1895) hatte in Giessen, Marburg und Bonn studiert. 1844 wurde er Franzose, schrieb sich dann Derenbourg und unterrichtete Deutsch am Elitengymnasium Henri IV in Paris. Danach wurde er in der Imprimerie Nationale und 1852 in der Bibliothèque Nationale mit der Orientalistik vertraut. Mitglied des Institut de France (1871), bekam er 1877 einen Lehrstuhl für rabbinische Studien an der EPHE. Sein Sohn, Hartwig Derenbourg (1844-1908), ebenfalls als Arabist bekannt, machte in Frankreich auch eine glänzende Karriere. In Paris geboren, studierte in Göttingen und promovierte dort (1866). Er war Professor sowohl am Séminaire Israélite de France als auch an der EPHE. Er hat auch Thedor Nöldeke übersetzt. Julius Oppert (1825-1905) aus Hamburg studierte Jurisprudenz und orientalische Philosophie in Heidelberg und Bonn. Als er 22 Jahre alt war, las er schon Arabisch, Sanskrit und veröffentlichte seine ersten Abhandlungen über Persien. Ende 1847 kam er nach Frankreich. Er beteiligte sich an den Expeditionen in Mesopotamien, besonders in Mossoul 1852. 1854, zurück in Paris, ragte er als Epigraphist hervor. Seine Bücher, besonders die Einführungen, werden heute noch sehr geschätzt. 1848 unterrichtete er Deutsch in Laval, wurde Sanskritist, bekam 1874 den ersten Lehrstuhl für Assyriologie am Collège de France,17 wo er seit 1869 lehrte – allerdings als Professor an der Königlichen Bibliothek, die einige Professuren, besonders für seltene Sprachen, förderte. 1881 wurde er Mitglied der Académie des Inscription et Belles-Lettres. Übrigens war Oppert als Gegenkandidat Renans am Collège de France tätig.
Das berühmteste Beipiel aus der deutsch-französischen Wissenschaft des Judentums ist Salomon Munk.18 Geboren in Glogau 1803, genoss er eine fromme religiöse Bildung. Student in Berlin, hörte er die Vorlesungen von Franz Bopp, August Böckh und Hegel. 1827 war er in Bonn, wo er Arabistik bei Georg Wilhelm Freytag und Sanskrit bei Christian Lassen studierte. Er hatte auch die Vorlesungen von Barthold Georg Niebuhr und August Wilhelm von Schlegel besucht. Da er Jude war, hatte er keine Aussichten in Deutschland. Es muss noch hinzugefügt werden, dass ein richtiger Lehrstuhl für Jüdische Studien weder in Deutschland noch irgendwoanders auf der Welt existierte. Der erste wurde 1925, parallel mit der Gründung der Hebräischen Universität, für Harry A. Wolfson in Harvard eingerichtet.19 In Paris studierte Munk bei Antoine Isaac Silvestre de Sacy, wurde Privatlehrer bei der Familie Rothschild, befreundete sich mit Samuel Cahen, bekannt für seine Bibelübersetzung, sowie mit dem ungekrönten Papst der französischen Universität, Victor Cousin. Bekannt ist Munk für die Mélanges de philosophie juive et arabe (1857-1859). Er beschränkt sich nicht darauf, an der Bibliothèque Impériale zu arbeiten, sondern fährt ab 1838 mit Moses Montefiore und Adolphe Crémieux in den Orient vor dem Hintergrund der Damaskus Affäre, um Handschriften zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt seine große bahnbrechende Entdeckung: Hinter dem Namen eines Philosophen namens Avicebron, Autor des Fons vitae,20 sonst nur wegen einer lateinischen Übersetzung bekannt, verbarg sich der jüdische Denker und Poet Salomon ibn Gabirol (ca.1021-ca.1058)21. Wichtig ist Munk auch als Verfasser der ersten modernen, wissenschaftlichen Beschreibung des heiligen Landes, Palestine. Description géographique,historique et archéologique (1845). Seine Ausgabe und französische Übersetzung des Guide des égarés (Führer der Verirrten) wird heute noch benutzt.
Als Renan seine Leçon inaugurale am 22. Febuar 1862 hielt, wurde er noch am selben Abend vom Dienst suspendiert! Er hatte nämlich Jesus als personne remarquable bezeichnet und war also der theologischen Frage ausgewichen.22 Wer hätte nun sein Nachfolger werden können? Nach seiner erfolgreichen Bewerbung um die Stelle wurde Munk als Nachfolger ernannt. Es war unerhört, dass ein Jude, ein Deutscher noch dazu, auf den begehrtesten Lehrstuhl der Geschichte der Bibel berufen wurde! In der Jüdischen Zeitschrift fürWissenschaft und Leben wusste Abraham Geiger diese Tatsache angemessen zu würdigen.
Als Munk am 5. Februar 1867 starb, stellte sich das Problem der Lehrstuhlbesetzung erneut. Auf der Liste möglicher Nachfolger findet sich wieder ein deutscher Jude, und zwar Joseph Derenbourg, Sohn des Mainzer Rabbiners Zvi Hirsch Dernburg! Renan wurde am Ende, am 17. November 1870, inmitten der 1870-Kriege, wieder auf seinen alten Lehrstuhl berufen. Als er im Oktober 1892 starb, musste seine Stelle erneut besetzt werden. Man nahm am Ende einen Protestanten, Philippe Berger, als ob dieser Lehrstuhl nur mit Außenseitern (d.h. mit Nicht-Katholikern) besetzt werden könnte.
Es ist möglich, die Liste der deutschen Juden im akademischen Milieu ohne Schwierigkeiten um weitere Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte zu erweitern. Die Familie Darmstätter ist hier besonders zu erwähnen. Der Vater kam aus Frankfurt am Main und die Brüder haben sich in Frankreich vollständig integriert. Arsène Darmstätter war Professor für Französische Literatur an der Sorbonne und James unterrichtete Persisch an der EPHE und am Collège de France. Dasselbe trifft auch auf eine andere Familie aus Frankfurt zu: die Reinachs. Die sehr begabten Söhne wurden alle in Frankreich geboren: Joseph Reinach wurde als Politiker bekannt, Theodor hat Numismatik an Collège de France und Salomon Griechisch an der Sorbonne gelehrt! Ich schweige ganz von „französischen“ Musikern wie Jacques Offenbach und Giacomo Meyerbeer. In Frankreich ist diese untergründige deutsch-jüdische Tradition heute noch der Untersuchung wert. Es muss hinzugefügt werden, dass die Revue des Etudes juives (1880 gegründet) zahlreiche Beiträge aus der deutsch-jüdischen Wissenschaft druckte, mehr als die Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft desJudentums Beiträge aus der Feder französischer Wissenschaftler veröffentlichte!23 Aber auch Rabbiner und Gelehrte mit deutscher Bildung und Hintergrund wie Zadok Kahn (1839-1905), Israel Lévi (1856-1939),24 Julien Weill und Maurice Liber hatten nicht nur ihre Dissertationen in Frankreich verfasst, sondern bekamen auch Lehrstühle an der École Pratique des Hautes Études. Nachfolger von Liber wurde der berühmte Georges Vajda, der aus Ungarn kam. Er unterrichtete sowohl an der EPHE als auch am Séminaire Israélite de France in Paris. Er wurde später der erste Professor für Hebräische Philosophie an der Sorbonne (Paris III).
Als die hebräische Universität im April 1925 in Jerusalem eröffnet wurde, war ein Institut für Jüdische Studien schon Ende 1924 gegründet worden. Da diese Universität eine sehr starke deutsche Tradition hatte, waren die deutschen Orientalisten gut vertreten und selbstverständlich deutsche (oder österreichische) Juden. Seit kurzer Zeit liegt uns eine vorzügliche Geschichte der Hebräischen Universität25 in vier Bänden vor, die u.a. ein Kapitel über die Geschichte der Jüdischen Abteilung und der Orientalischen Abteilung aus der Feder von Menahem Milson enthält.26 Die Jüdische Abteilung war „als Forschungszentrum über Judentum, jüdische Religion, hebräische und semitische Sprachen, Literatur, Geschichte, hebräisches Recht, Philosophie und andere Themen/Aspekte in Beziehung mit der jüdischen Geschichte insgesamt und besonders Palästina“ konzipiert. Sie wurde am 22. Dezember 1924 in Anwesenheit der Professoren Jacob Epstein, Joseph Klausner, Samuel Klein eröffnet.
Jacob Nahum Epstein (1878-1962) stammte aus Brest Litovsk (Brisk in Litauen), wo ihm eine ,klassische‘ Bildung (Cheder usw.) zuteil wurde. Er besuchte die Cheder und Yeschiva in Mir und Vilna, das Rabbinische Seminar (1907) und die Universität in Wien (1911), studierte dann semitische Philologie, Philosophie und Geschichte in Bern, wo er seine Dissertation unter der Leitung von Karl Marti schrieb (1913). Er kam nach der Eröffnung der Hebräischen Universität im April 1925 in Jerusalem dorthin. Sein Lehrstuhl hieß: Talmudische Philosophie. Er wollte, dass die Universität ein Zentrum der Wissenschaft sei und sich auf gar keinen Fall in eine religiöse Einrichtung verwandele.
Joseph Klausner (1874-1958) stammte auch aus Litauen, aus Olkeniki, im heutigen Russland. Er besuchte die Cheder, dann die Yeschiva bis zum Abitur am Gymnasium in Odessa. Ab 1897 studierte er Semitische Philologie und Sprache, Philosophie (bei Kuno Fischer) Geschichte und politische Wirtschaft (bei Max Weber) an der Universität Heidelberg bis zu seiner Dissertation (1902). Er kam 1919 nach Palästina. Schon vor seiner Auswanderung leitete er als Nachfolger von Achad Ha-Am die Zeitschrift Ha-Shiloah (1903-1918) und unterrichte an der Universität Odessa. Er wurde Professor für Moderne Hebraïsche Literatur in Jerusalem, und erst 1944 wurde er an den Lehrstuhl für Geschichte des Zweiten Tempels berufen. Er vereinte zwei Lehrstühle – mit großem publizistischen Erfolg.
Es soll hier noch Samuel Klein (1886-1940) erwähnt werden. Er stammte aus Ungarn (Szilas-Balhas), wo sein Vater Rabbiner war. Er besuchte das Gymnasium in Budapest bis zum Abitur (1905), dann das Rabbinerseminar in Berlin. Nach seiner Dissertation in Heidelberg (1909) und der rabbinischen Smiha (1910) kam er erst 1929 nach Jerusalem und unterrichtete hier Palästinologie und Topographie von Erez Israel. Schon 1920 hatte er das Jüdisch-palästinensische Corpus Inscriptionum gegründet.
Innerhalb von kurzer Zeit wurden auch „junge Löwen“ wie Gershom Sholem (1897-1982) nach Jerusalem eingeladen, dessen Autobiographie Von Berlin nach Jerusalem ein einzigartiges historisches Dokument darstellt.27 Harry Torczyner (Tur Sinai, 1886-1973) hatte auch in Berlin studiert und in Wien promoviert und wurde 1933 Bialikprofessor für Hebraïsche Sprache. Mosche Schwabe (1889-1956), der Direktor des Gymnasiums in Kaunas (wo Emmanuel Lévinas Schüler war), hatte in Halle und Berlin studiert, war Gräzist und Latinist, stand aber auch mit der jüdischen Abteilung in Verbindung. Einen besonderen Fall stellt Hartwig Baneth (1893-1973) dar, dessen Vater (Ezekiel) Rabbiner und ehemaliger Professor für Talmud und Midrasch an der Berliner Hochschule für Wissenschaft des Judentums war. Hartwig Baneth hatte 1920 über die Briefe Muhamads promoviert und die ersten Schritte des Instituts für Orientalische Forschung in Jerusalem 1926 begleitet. Er wurde Nachfolger von Levi Billig, der 1936 ermordert wurde. Sein Schwerpunkt war die jüdisch-arabische Sprache28. Diese Domäne wurde zum Spezialgebiet der Hebräischen Universität. Die School of Oriental Studies sollte ihren Sitz eben nicht am Institut für Jüdische Studien haben, sondern eine eigenständige Universitätseinrichtung bilden. Sie wurde im April 1926 eröffnet. Horovitz kam 1925 zur Eröffnung und bekam die feindliche Stimmung bei den Arabern in Jerusalem zu spüren!
Wir dürfen nicht vergessen, dass, bevor die hebräische Universität gegründet wurde, die israelitische, jüdische und christliche Geschichte ein Streitobjekt zwischen Juden und Christen einerseits, und zwischen Katholiken und Protestanten andererseits bildete. Die Exegese wurde auch zum Mittel der wissenschaftlichen Kriegsführung und zwar unter Einmischung der politisch-diplomatischen Organe. Nachdem zum ersten Mal ein englischer Konsul ernannt worden war (1838), wurde ein preußischer und unmittelbar danach ein französischer Konsul nach Jerusalem gesandt. Die ersten deutschen Konsulen waren Orientalisten. Dann enstand die von den französischen Dominikanern geleitete École Biblique et archéologique,29 deren wissenschaftliche Autorität bald von deutschen Jesuiten in Frage gestellt wurde! Englische und amerikanische Institute für die Geschichte des Heiligen Landes waren ebenfalls in Jerusalem tätig. Diese Stadt wurde in kurzer Zeit das ,Mekka‘ der Wissenschaft des Judentums.
Die damalige deutsche Judaïstik war eine Mischung aus zwei Traditionen: der rein philologischen Tradition und der ,anderen Tradition‘, die man an jüdischen Seminaren und Hochschulen hören könnte. In Breslau, in Wien, in Budapest und selbstverständlich in Berlin besuchte man hauptsächlich zwei Institutionen, die an manchen Orten – zum Beispiel in Berlin – drei wurden: Universität, Hochschule für Wissenschaft des Judentums und Rabbinerseminar, wie z.B. im Fall von Alexander Altmann, der damals eigens noch ein Rambam Seminar in Berlin gründete. Es ist also kein Wunder, dass die Wissenschaft des Judentums in Palästina/Israel auch zur Hochburg der deutschen Wissenschaft wurde. Was sowohl die Judaistik und die Arabistik als auch die Islamwissenschaft angeht, ist der deutsche Einfluss nicht übersehbar.
Aber kehren wir zurück zur Arabistik an der hebräischen Universität, die am Anfang in der jüdischen Abteilung angesiedelt war. Die eigentliche School of Oriental Studies (ha merkaz/machon le-madaiha-mizrach) wurde erst 1926 gegründet. Fünf Gelehrte: Ludwig A. Mayer, David Hartwig (Zwi) Baneth, Levi Billig, Walter Joseph Fischel30 und N. Braun, wurden hierhin berufen. Man wollte unbedingt eine Brücke zum überwiegend arabischen Umfeld schlagen. Übrigens wurde die Gruppe Brith Shalom um Buber, Scholem und die Arabisten aus diesen Instituten, die sich der jüdisch-arabischen Verständigung widmeten, auch 1925 gegründet. Man kann also auch in diesem Fall von einer deutschen (mitteleuropäischen) Konstellation sprechen. Schon als Student war Judah Magnes, der erste Kanzler der Hebraïschen Universität, in Heidelberg und in Berlin.31 Er promovierte über die arabische Kultur (Heidelberg 1902). Er lernte junge Judaisten kennen, die Islamwissenschaftler wie er waren, darunter drei, die später in Palästina tätig sein sollten: Arthur Biram (1878-1967),32 Max Schloessinger (1877-1944) und Gotthold Weil (1882-1960).33
Josef Horovitz (1873-1931), der erste und wichtigste unter den mitteleuropäischen Gelehrten, der schon 1925 Mitgleid des Kuratoriums der Hebräischen Universität war, stammte aus einer berühmten Rabbinerfamilie aus Frankfurt. Als Sohn des orthodoxen Rabbiners Markus Horovitz (1844-1910), war Josef der erste Direktor der School of Oriental Studies – als visiting director wohlbemerkt, weil er inzwischen 1915 als ordentlicher Professor für Semitische Philologie nach Frankfurt berufen worden war. Der ungarisch-stämmige Josef Horovitz war in Lauenburg geboren und hatte in Frankfurt und Berlin studiert. Er war Schüler von Eduard Sachau, dem Begründer des Seminars für Orientalische Sprachen. 1907 wurde Horovitz Professor.
Als der junge Student nach Berlin ging, um dort sein Studium zu beginnen, das aus Neigung und innerem Bedürfnis gewählt war, und von dem man nicht wissen konnte, wie er es einmal zu einem bürgerlichen Berufe führen würde, war er für sein Fach mehr vorgebildet, als ein Student der orientalischen Sprachen gewöhnlich vorgebildet zu sein pflegt. Im dem Elternhause hatte er so viel Sinn für wissenschaftliches Denken und Arbeiten, so viel Scheu vor religiösem Erleben, soviel Verständnis für die liebvolle Versenkung in die Vergangenheit, so viel positive Kenntnis der hebräischen Sprache und der biblischen und nachbiblischen Literatur mit auf den Weg bekommen, dass die Erlernung des Arabischen und der anderen orientalischen Sprachen ihm leicht fiel, und dass ihm das Verständnis für die Religionen des Orients und insbesondere für die Muhammeds schnell aufging. Das Judentum hat nämlich mit dem Islam bei aller Verschiedenheit in der Zielsetzung doch eine Reihe wesentlicher Züge gemeinsam .34
Sein Schüler, Freund und Nachfolger Gotthold Weil, von dem das obige Zitat stammt, fährt fort:
In beiden Religionsgemeinschaften wird Denken und Handeln der Bekenner von der Wiege bis zum Grabe und täglich vom Aufstehen bis zum Niederlegen durch einen Kanon, durch ein geoffenbartes sittliches Gesetz geregelt. Gleiche Ausgangspunkte führen häufig auf gleiche Wege und so nimmt es nicht Wunder, dass die Art der Überlieferung dieses Gesetzes, die Art, wie der gesamte Kanon dann gesammelt und gelehrt wird, wenn auch nicht gleiche, so doch auffallend ähnliche Entwicklungsreihe durchlaufen. Um den eigentlichen Kern der geoffenbarten Lehre bilden sich in beiden Religionen Schalen zum Schutze des Kerns, die ihrerseits kanonische Bedeutung erlangen und von sich zu ihrem Schutze immer wieder neue Schalen ansetzten.35
Eduard Sachau, der spiritus rector der Ausgabe von ibn Sa’ds Kitab al-tabaqat alkabir (Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams biszum Jahre 230 der Flucht)36 war der Gründers des Seminars für orientalische Sprachen in Berlin. Horovitz’ Dissertation über DeWaqidi libro kitab al-magaziinscribitur (Das Leben Muhammeds) wurde am 27. Juni 1898 verteidigt und im selben Jahr in Berlin gedruckt. Habilitiert hat er über den schiitischen Dichter Kumait.37Das Koranische Paradies wurde in der Reihe „Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum“ veröffentlicht.38 1907 war Horovitz Professor am berühmten Anglo-Oriental College in Aligarth, wo er sieben Jahre unterrichtete. Sommer 1915 fing er an, in Frankfurt zu lehren. Er hat nicht nur über den Koran gearbeitet, sondern auch über arabische Dichtung.
Kurz vor der Eröffnung der Hebraïschen Universität notiert Magnes in seinem Journal:
Relations with Arabs, Muslim world, whole Near East exacerbated. Horovitz reports Egyptian Scholars as now definitely hostile. University has political aspect in their eyes now. Only help for this is over a number of years to do useful scholarly work, particularly in language, literature, culture of East. The Jews the tool of imperialism.39
Horovitz war in der wissenschaftlichen Verwaltung der neu enstandenen Universität sehr involviert. Schon am 14. Mai schickte er ein Memorandum an Magnes, um ihm zu erklären, dass die arabischen und islamischen Studien am Institut für Jüdische Studien nicht am richtigen Platz seien. Nach der Sitzungen des Bord of Governors in München am 23.-24. September 1925 notiert Magnes:
By the time we had reached the question of the establishment of School of Oriental Studies, so much time and energy had been taken up with the discussion of mathematics and physics and some of the other matters mentioned above, that Prof. Horovitz, who had come to the meeting for the purpose of reporting on the School of Oriental Studies, was greeted with the remark that everything that he would propose would be satisfactory and therefore it would not be ncessary for him to proceed. Prof. Horovitz, however, properly said that he had been listening to long and wearying discussions on other matters, and that he requested patient hearing for what he had to say because he did not want someone someday to stand up and to say that „Oh, I did not know that you were going to propose that“. The school of Oriental Studies was a far-reaching idea, and it was better that it be understood now rather than later. He thereupon unfolded his suggestions in his ouwn lucid way.40
Horovitz starb 1931, bevor er die Arbeit an seinem großen Projekt, einer Ausgabe des arabischen Historikers al-Baladuri und einer Konkordanz der frühen arabischen Dichtung beenden konnte. Dank der Vorlesungsverzeichnisse kann man genau rekonstruieren, welche Themen er während seiner Lehrtätigkeit behandelt hat. Man merkt dabei auch, dass er mit Studenten die zeitgenössische arabische Presse las. Als er starb, wurde die Eulogie von Martin Buber höchstpersönlich im Namen der Hebräischen Universität in Frankfurt gehalten. Magnes sagt über Horovitz: „He was modest, simple, and kind and we feel in Jerusalem a great sense of personal loss.“41 Franz Schultz, der Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Frankfurt, stellte fest:
Er war kein Orientalist alten Schlages, der, so gelehrt er sein mochte, nie einen Fuß in das Land gesetzt hat, dem seine Forschung galt. Der achtjährige Aufenthalt in Indien hatte Horovitz geprägt und ihm jene Weltoffenheit und Weltläufigkeit und jene Einsicht in die Fragen der Weltpolitik gegeben, die man an ihm schätzte. Sein Buch über Indien unter britischer Herrschaft, das beste seiner Art, zeigt bei aller Verständnisinnigkeit und Umsicht jene nüchterne Klarheit, durch die sein Denken und Urteilen sich auszeichneten, diese Eigenschaften auch seiner übrigen wissenschaftlichen Arbeit. Sie imponiert im übrigen durch ihre Vielseitigkeit. Er war der beste Kenner besonders des indischen Islams, ihn beschäftigte die altarabische Dichtung ebenso wie das ältere jüdische Schrifttum. Er widmete sich dem antiken Lustspiel im islamischen Schattenspiel. Sein Lebenswerk sollte der große wissenschaftliche Kommentar des Korans werden, ein Werk, das er nun unvollendet hinterlassen muss. Er war eine internationale Größe und Berühmtheit seines Faches. Man weiß, dass ihm die Einrichtung des orientalischen Instituts der Universität Jerusalem verdankt wird und dass es von ihm inspiriert wurde.42
Seine Schüler, wie Shlomo Dov Goiten (1900-1988) oder Johann Fück (1894-1974), haben einen entscheidenden Einfluss auf die jüdische Islamwissenschaft ausgeübt. Posthum ist sein Artikel „Islam“ in Enzyklopädia Judaica43 erschienen und die Ausgabe des Al-Baladhuri44 wurde erst 1936 von Shlomo Dov Goiten angefangen, „published for the first time by the School of Oriental Studies, Hebrew University.“45 Goiten war 1949-1956 der Direktor der School of Oriental Studies in Jerusalem, bevor er nach Amerika ging!
Goitens Vertretung wurde von Martin Plessner46 (WS 1931/32) übernommen. In Breslau geboren, Urenkel vom berühmten orthodoxen Prediger Solomon Plessner (1797-1883), wurde Plessner Assistent von Hellmut Ritter in Hamburg und arbeitete danach am Berliner Institut für Geschichte der Wissenschaften (1927-1929). 1933 ging er nach Palästina, unterrichtete in Beit sefer reali in Haifa und schrieb die erste arabische Grammatik in modernem Ivrit. Mitarbeiter der jüdischen Nationalbibliothek wurde er 1952 Assistent (Marzeh) und 1955 Professor an der Hebräischen Universität. „Die Islamwissenschaft, genauer: die Geschichte der politischen, kulturellen und geistigen Entwicklung der islamischen Welt als eines Ganzen sowie der einzelnen Völker, die sich zur Religion Muhammads bekannten oder bekennen, ist einer der jüngsten Zweige am Baume der morgenländischen Studien“ schrieb er in seiner Antrittsvorlesung, die am 21. Februar 1931 in Frankfurt stattfand. „Die Wissenschaft ist im Islam von allem Anfang an als ancilla theologiae aufgetreten; und schon weil sie in Übereinstimmung mit Glaube und Pflichtenlehre bleiben musste, konnte von Freiheit ebensowenig die Rede sein wie in Europa vor dem 19. Jahrhundert.“ Nachdem er sein Programm beschrieben hatte, sagte Plessner zum Schluss: „Und vielleicht wird gerade die Kenntniss des ganz Andersartigen dazu beitragen, Gesichtspunkte für die Beurteilung unserer eigenen Verhältnisse zu gewinnen, die übrigens mit den islamischen, als dem Gegenstück zu denen des mittelalterlichen Abendlandes, viel mehr Beziehungen verknüpfen, als uns auf den ersten Blick scheinen möchte.“47
Nachfolger von Horovitz war der Berliner Gotthold Weil (1882-1960), der auch an den Balhaduri-Projekten entscheidend mitgearbeitet hat. Geboren in Berlin, war er der Urenkel von Simha Weil, dem Großrabbiner von Berlin am Ende des 18. Jahrhunderts. Er hat an der Universität studiert sowie an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Schüler des Arabisten Eduard Sachau, dessen Festschrift er herausgab,48 wurde Weil nach seiner Dissertation (1905) Bibliothekar an der Kaiserlichen Bibliothek in Berlin (1906), wo er 1918 die Orientalische Abteilung mitgründete und leitete. 1920 war er Privatdozent für Semitische Philologie und Islam in Berlin. Sehr früh kam er als Professor für die noch zu eröffnende Hebräische Universität ins Gespräch:
Im Namen des Herrn Dr. J. L. Magnes gestatten wir uns, Ihnen anbei einen Bericht über die kürzlich in London stattgefundene Universitätskonferenz zu überreichen. Die Konferenz beschloss, an mehrere jüdische Gelehrte heranzutreten und sie zur Übernahme von Lehrstühlen an dem zu gründenden judaistischen Institut einzuladen. Sie beschloss u.a. auch einen Lehrstuhl für die arabische Sprache zu schaffen und Herrn Prof. Mittwoch einzuladen, diesen zunächst für die Dauer eines Jahres, zu übernehmen. Da er Dr. Magnes, der von der Konferenz mit der Vorbereitungsarbeit für das Institut betraut worden ist, sehr in Zweifel ist, ob Prof. Mittwoch im gegenwärtigen Zeitpunkt bereit sein wird, das ihm angetragene Lehramt zu übernehmen, so hat er uns, entsprechend den ihm von der Konferenz erteilten alternativen Instruktionen ersucht, Sie zu befragen, ob Sie bereit wären, für den Fall, dass Herr Prof. Mittwoch nicht imstande ist, der Einladung zu folgen, das erwähnte Lehramt zu übernehmen.49
1931 wurde Weil Nachfolger von Horovitz an der Universität Frankfurt. Im selben Jahr bekam er folgenden Brief von Judah Magnes:
You will be glad to know that the meetings of the Board of Governors and the Academic Council have passed off satisfactorily and I am very happy to be able to inform you that you were unanimously elected a member of the Board of Governors and that you are to be invited by unanimous vote to become the Visiting Director of the School of Oriental Studies in place of the late Professor Horovitz. You know how happy this makes me and how happy also Schloessinger50 will be, and you will be pleased also to know that the members of the School of Oriental Studies in Jerusalem ware unanimous in urging us to have this invitation extended to you. I have heard about the possibility of your going to Frankfurt and I want to extend to you my very best wishes for fruitful scientific work in your new position. This will also give us the opportunity of being in closest touch with you and I hope that conditions may sometimes shape themselves in the not too distant future to enable us to bring you to Jerusalem, where I think you could perform a great service.51
Die Zukunft kam viel schneller, als Magnes dachte: 1933 stand Weil unter Berufsverbot und etablierte sich in Jerusalem; kurz vorher wurde ihm die Redaktion der berühmten Zeitschrift der deutsche Morgenländische Gesellschaft angeboten: „Dass eine solche Zeitschrift notwendig ist und dass es trotz der Schwere der Zeiten möglich sein muss, sie durchzuhalten und ihr weitere Bedeutung zu verleihen, erscheint mir zweifellos. Gewisse organisatorische Gaben scheinen mir für die Leitung einer solchen Zeitschrift notwendig zu sein, aber dass Sie diese zu Genüge besitzen, haben Sie ja in Ihrer früheren Tätigkeit bewiesen.“52 Weil war auch am Anfang, zwischen 1931-1935, visiting Director. In diesem Jahr ersetzte er Shmuel Hugo Bergmann als Direktor der Universitäts-und Nationalbibliothek (bis 1946). Übrigens dank des in Jerusalem geborenen Gelehrten Abraham Shalom Yahuda und des in Collège de France lehrenden Louis Massignon wurde die Bibliothek von Ignaz Goldziher von der Bibliothek der hebräischen Universität gekauft. Weil hat bis 1952 regelmäßig mit Erfolg im Gebiet der semitischen Linguistik and arabischen Sprache und Literatur (so wurde sein Lehrstuhl genannt) gelehrt. Sein Spezialgebiebt war die türkische Sprache.53 Ein Blick in seinen Aufsatz Zum Verständnis der Methode der moslemischen Grammatiker: Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in Islam54zeigt den Unterschied zu unserer heutigen Auffassung der islamischen Kultur, was ihre Beziehungen zu der griechischen anbelangt:
Sahen die Griechen das Allgemeine, von dem sie ausgegangen waren, stets hinter dem Einzelnen, so rangen sich die Muslime von dem gegebenen Einzelnen nur schwer zum Allgemeinen durch. Schufen die Griechen daher eine Theorie von der Sprache im Allgemeinen, die wegen ihrer formalen Gültigkeit auf alle Sprachen anwendbar ist, so ist die Terminologie der islamischen Grammatiker nur auf die Grammatik der arabischen Sprache anwendbar, weil sie nur aus ihr heraus abstrahiert ist.55
Es wird im Folgenden auf weitere Unterschiede verwiesen:
Auch hier sind dogmatische Gesichtpunkte methodisch von grundlegender und bestimmender Bedeutung gewesen. Ebenso wie Allah selbst, so ist auch der Qur’an als Gottes Wort die Vernunft schlechthin. Da aber die Sprache des Qur’an Repräsentant und Muster des Ausdrucks der arabischen Sprache ist, so muss die göttliche Vernunft und Vollkommenheit auch im Bau der arabischen Sprachen allenthalben zum Ausdruck kommen. Identifizierten die Griechen bewusst Sprechen und Denken, Sprachgesetze und Denkgesetze, so schufen die Moslems unbewusst die Gleichung von arabischer Sprache und absoluter Vernunft.56
Also der Muslim denkt „unwissenschaftlich, stark subjektiv“!
Leo Aryeh Mayer, der erste Direktor des Instituts, der nicht visiting oder in absentia war, stammte aus Galizien, wo er in Stanislawow 1895 geboren wurde, und starb 1956. Nach seinem Studium in Wien, Lausanne und Berlin promovierte er 1917 in Wien, wo er auch das Israelitische Theologische Seminar besuchte. Schon 1921 ist er in Jerusalem, nachdem er sowohl in Wien (1917-19) als auch – nach einem kurzen Aufenthalt am Gymnasium in Stanislawow – in Berlin unterrichtet hatte. In Berlin wurde er Gotthold Weils Bibliothekassistent.
April 1925 wurde er Assistent (marzeh) für Islamische Kunst und Archäologie und dann 1935-1949 Direktor des Instituts für Orientalische Studien in Jerusalem. Als Dekan, Rektor und in verschiedenen hohen Verwaltungsämtern tätig, wohnte er übrigens ab 1939 in der Abrabanelstrasse 30 (ein paar Meter von Scholem entfernt, der seine Adresse in der Nummer. 28 hatte). Mit seinem Freund Elezar Lipa Sukenik (1889-1953), der ab 1911 in Jerusalem residierte und Vater von Ygal Yadin (1917-1984) war,57 hat er viele Nachschlagwerke veröffentlicht, darunter das CorpusInscriptionum Judaicarum Palestinensium, mit hebräischen, aramäischen und griechischen Inschriften. Das heutige Museum für Islamische Kunst in Jerusalem (1962 gegründet) trägt seinen Namen. Sein Briefwechsel zeugt von den damaligen schwierigen technischen Bedigungen, unter denen die arabischen Druckereien standen:





























