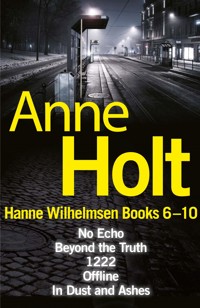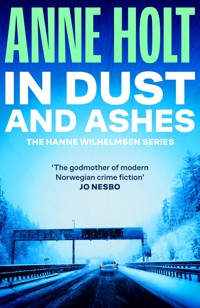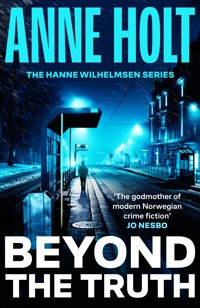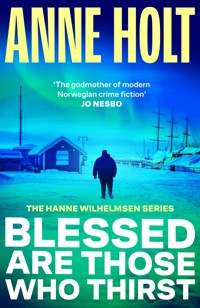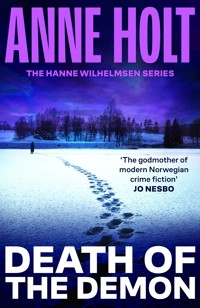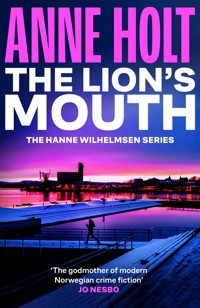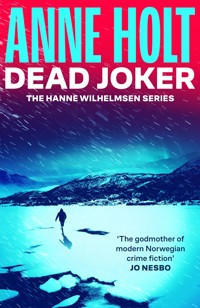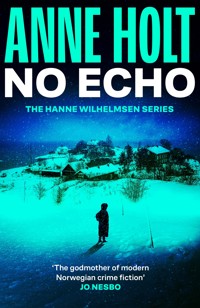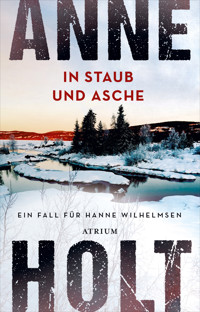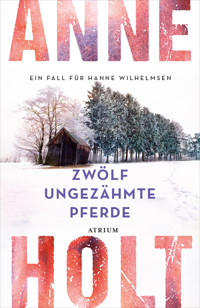
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der große neue Kriminalroman der norwegischen Bestsellerautorin Hanne Wilhelmsens Leben droht aus den Fugen zu geraten. Ihre Frau Nefis hat sie verlassen und die gemeinsame Tochter Ida mitgenommen. Als dann auch noch einer der wenigen Menschen, die Hanne auf der Welt etwas bedeuten, brutal ermordet wird, muss sie nicht nur ihre Familie retten, sondern auch den wichtigsten Fall ihres Lebens aufklären. Mit ihren eigenen Dämonen kämpfend, gerät sie in eine düstere Landschaft aus Hass, Verachtung und Missbrauch, in der auch eine Reihe unerklärlicher Schwangerschaften Teil eines größeren schrecklichen Ganzen sind. Schlaflos und verzweifelt arbeitet Hanne rund um die Uhr und stößt schließlich auf eine unerträgliche Wahrheit. »Wow! Und nochmal wow! Anne Holt beginnt ihren zwölften Hanne-Wilhelmsen-Roman mit einem Paukenschlag – oder zwei.« Stavanger Aftenblad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anne Holt
Zwölf ungezähmte Pferde
Hanne Wilhelmsens zwölfter Fall
Deutsche Erstausgabe
1. Auflage 2025
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2025
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Tolv utemte hester bei Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.
© 2023 Anne Holt
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Trevillion © Carmen Spitznagel; FinePic®, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
ISBN978-3-03792-233-0
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Prolog
Samstag, 12. März 2022
Das Königreich Norwegen erwachte langsam zum Leben.
Auf den Tag genau vor zwei Jahren hatte das Land dichtgemacht, um seine Bevölkerung vor einem lebensgefährlichen Virus zu schützen.
Hanne Wilhelmsen hatte niemals in einer besseren Zeit gelebt.
Jetzt war alles zu Ende.
»Du solltest dich schämen. Dich schämen!«
Hanne starrte ihre Frau geschockt an. Sie traute ihren Ohren nicht.
»Es ist absolut unerträglich«, fuhr Nefis jetzt mit so lauter und scharfer Stimme fort, dass ihre Tochter Ida, die im Sommer neunzehn werden würde, aus der Küche kam.
Ida blieb mitten im Zimmer stehen, neben Nefis und ebenso verweint wie diese.
»Du bist absolut unerträglich«, korrigierte sich Nefis. »Du! Satt hab ich dich. Satt, dass …«
Ihre Arme schnellten zur Seite und dann aufwärts, als ob sie alle groben Fehler und Unzulänglichkeiten der ganzen Welt umfassen würden. Hanne saß regungslos in ihrem Rollstuhl, in dem sie seit über zwanzig Jahren saß, nachdem sie im Dienst bei der Osloer Polizei eine schwere Schussverletzung im Rücken davongetragen hatte.
Ihre Sehfähigkeit schien sie im Stich zu lassen. Es war, wie in die falsche Richtung durch ein Fernglas zu blicken: zwei winzig kleine Menschen in weiter Ferne, umgeben von nichts. Nefis’ Gesicht war rot und wütend. Ihre früher rabenschwarzen Haare hatten während der Pandemie graue Streifen bekommen. Sie hatte sie noch nicht in ihrem üblichen Knoten hochstecken können, um dem Tag entgegenzutreten, und die helleren Strähnen hatten sich wie Schlangen um ihren Kopf gewunden.
Hanne atmete zusehends flacher.
»Und jetzt ist es zu spät«, schluchzte Ida und trat dicht an ihre Mutter heran, die ihr einen beschützenden Arm um die Taille legte und sie an sich zog.
Nefis dämpfte ihre Stimme.
»Das Schlimmste … das Allerschlimmste ist, dass du Schwäche verachtest.«
Nein!, wollte Hanne abwehren.
»Und Verachtung von Schwäche …«, fuhr Nefis fort, plötzlich ruhiger; sie strich Ida mit der linken Hand über den Kopf, »… bedeutet Geringschätzung des Menschlichen. Anderer lebender Menschen.«
Das wollte Hanne sich nicht anhören. Das hier stimmte nicht. Das war von vorn bis hinten gelogen. Aber Nefis log nie.
»Entschuldigung«, flüsterte Hanne.
»Was hast du gesagt?«
»Entsch…«
»Entschuldigung? Entschuldigung? Ist das alles, was du zu sagen hast?«
Nefis ließ Ida los und trat zwei Schritte auf den Rollstuhl zu. Sie hatte die rechte Hand so fest zur Faust geballt, dass ihr Unterarm zitterte. In der linken hielt sie Hannes Telefon, sie hatte es ihr mit Gewalt entrissen und all das Entsetzliche gesehen, was sich dort versteckte.
»Wenn du auch nur für einen Moment glaubst …« Abermals hob sie die Arme, jählings und nach vorn gerichtet. »Wenn du auch nur eine einzige Sekunde lang glaubst, dass es hilft, jetzt noch mit einem armseligen Entschuldigung zu kommen, nach … nach all den Jahren, dann überlegst du dir das lieber noch mal genauer. Wir gehen.«
»Wer?«
»Wir. Ida und ich. Du kannst ja nirgendwo hin. Du musst ja hier wohnen, um … duschen und kacken zu können. Bitte sehr!«
Sie machte eine gebieterische Handbewegung, wie um Hanne nach einer aufreibenden und nun entschiedenen Scheidungssituation die Wohnung zu überreichen. Ihre Stimme klang kalt und spöttisch.
»Wohin wollen wir denn?«, fragte Ida und schaute zum Rollstuhl hinüber.
»Keine Ahnung«, blaffte Nefis. »Pack eine Tasche. Eine große Tasche.«
Sie selbst lief in Richtung des Schlafbereichs durch die riesige Wohnung. Auf halber Strecke überlegte sie sich die Sache anders.
»Nein. Pack einen Koffer. Einen von den größten, die wir haben.«
Sie verschwanden. Es wurde still. Geradezu ohrenbetäubend still.
Dann hörte Hanne die beiden dort drüben reden.
»Hammo tut das so leid.« Idas Stimme klang kleinlaut und jämmerlich.
»Das will ich ja wohl dringend hoffen«, sagte Nefis.
Ein dumpfer Aufprall war zu hören, als ein Koffer auf den Boden auftraf.
»Scheiße!«, fauchte Nefis.
»Mama«, weinte Ida. »Wir können Hammo nicht allein lassen. Ohne uns kommt sie doch nicht zurecht. Und wohin wollen wir überhaupt?«
»Das habe ich noch nicht entschieden. In die Türkei vielleicht. Dann allerdings erst nach der Beerdigung. Jetzt mach schon.«
»Ich mache dieses Jahr mein Abi, Mama. Die Pandemie ist endlich vorüber. So gut wie, jedenfalls. Ich hab Schule, das letzte Jahr, und bald kommen … Ich will nicht.«
»Packen!«
Wieder wurde es still. Hanne hob die Hände, spreizte die Finger und starrte sie an. Sie zitterten.
Nefis hatte Hannes Telefon auf das Sofa geschleudert.
Das verdammte iPhone.
»Sag Hammo, sie soll machen, dass sie in ihr Büro kommt, und da bleiben, bis wir weg sind«, hörte sie Nefis rufen. Ida war vermutlich zum Packen in ihr eigenes Zimmer gegangen. »Ich kann ihren Anblick jetzt nicht ertragen.«
Ohne nachzudenken, ohne zu warten, gehorchte Hanne dem Befehl, der ihr noch gar nicht mitgeteilt worden war. Die Gummiräder fiepten klagend und ungewohnt über das Parkett, als sie sich langsam der Diele näherte, wo die hinterste Tür in ihr Arbeitszimmer führte. Dort schloss sie sich ein. Mit dem Rücken zu allem, was ihr auf der Welt etwas bedeutete, starrte sie auf die Reste des Pandemiedaseins.
In der Ecke standen vier unberührte und ein halb leerer Kasten mit Mundschutzmasken. Zwei Kanister voll Desinfektionsflüssigkeit zur Verwendung auf Oberflächen waren unter dem Fenster verstaut. Sechs negative Covid-Tests lagen wie Bauklötze als kleiner Turm neben einem Joystick. Dort, wo zu Beginn der Pandemie fünf Computerbildschirme gestanden hatten, waren jetzt sieben. Sie standen eng aneinander, einige schief, und auf der großen Tischplatte lag eine Unzahl von kleinen Plastikflaschen mit Desinfektionsmitteln zwischen leeren Dosen eines billigen schwedischen Mineralwassers. Der Papierkorb war voll. Ein vergessener Apfelrest dünstete einen schwachen Geruch aus, und Hanne weinte lautlos.
Draußen näherte sich das Rattern der Kofferräder auf dem Parkett.
»Wie soll Hammo denn ohne Hilfe zur Beerdigung kommen?«, flüsterte Ida.
»Das ist ihr Problem. Zieh eine dicke Jacke an. Und nimm auch den dunklen Mantel mit. Und die schönen Stiefel.«
»Ich muss Hammo Auf Wiedersehen sagen, Mama. Wir können nicht einfach …«
»Komm jetzt!«
Noch mehr Gepolter. Ida weinte noch immer, als die beiden aus der Wohnung verschwanden und die schwere Eichentür hinter ihnen ins Schloss fiel. Mit einem Knall waren alle Lebenszeichen gekappt.
Die Welt war so sicher und eng gewesen. Zwei Jahre lang, ein geschlossenes Leben, ein schmales und geradliniges Dasein, bei dem ein Tag in fast allem dem anderen ähnelte.
Eine glückliche Zeit.
Bis vor ein paar Wochen alle Verbote und Einschränkungen aufgehoben worden waren. Danach war das meiste schiefgelaufen, bis dann vor einer Stunde alles endgültig in Scherben gefallen war. Ein Polizist hatte vor der Tür gestanden. Was er zu sagen hatte, war einfach unbegreiflich. Seine Worte hatten zudem Hanne Wilhelmsens Familie in Stücke gerissen, und zum ersten Mal seit 1999 war sie ganz allein auf der Welt.
Das würde nicht gut gehen, das wusste sie.
Das würde ganz einfach nicht gut gehen.
Teil 1
Zwei Wochen früher
Freitag, 25. Februar 2022
Hauptkommissar Henrik Holme lebte ein Leben in Scham.
Er schämte sich wegen der meisten Dinge. Wegen seines Familienhintergrunds, über den er lieber nicht sprach, wenn jemand danach fragte. Was nur selten passierte. Sein Aussehen quälte ihn ebenfalls schon, seit er alt genug war, um zu begreifen, dass er anders wirkte: die ungewöhnlich schmalen Schultern, die Hände, klein und feminin, an den zu langen Armen. Der verdammte, viel zu große Adamsapfel, der, bis Henrik ihn mit Mitte zwanzig hatte operieren lassen, eher die Größe einer Apfelsine gehabt hatte, hüpfte noch immer gar zu sichtbar in seinem langen Hals auf und ab.
Sein Kopf war auch viel zu groß.
Er hatte keine Ahnung von Frauen, und er wurde rot und brach in Schweiß aus, wenn eine ihm auch nur die geringste Freundlichkeit entgegenbrachte.
Scham war für Henrik Holme zum Normalzustand geworden. Er wusste, wie seltsam er war, er duckte sich im Gehen und suchte sich immer einen Stuhl ganz unten am Tisch aus. Im Winter trug er einen Dufflecoat aus so steifem Stoff, dass sein Rücken dadurch breiter wirkte, und im Sommer behielt er immer alle Kleider an. Schon mit acht Jahren hatte er sich nicht gesonnt, auch später hatte er nie in einem See oder im Meer gebadet, und er hatte auch niemals sexuelle Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht. Abgesehen von ein paar Episoden, die ihn erröten ließen, wenn er unfreiwillig daran denken musste.
Er war an Scham und Erniedrigung gewöhnt.
Das hier war trotzdem das Schlimmste, was er je erlebt hatte.
Er war auf unbestimmte Zeit suspendiert.
Nach einer Beschwerde wegen »sexueller Belästigung«. Die er noch niemals irgendwem zugemutet hatte. Es war ein dermaßen riesiges und katastrophales Missverständnis, dass er rein gar nichts hatte erklären können, als er zur HR-Chefin einbestellt worden war.
Das hier nehmen wir ernst, hatte sie gesagt.
Drei Mal.
Er selbst hatte kein einziges Wort herausgebracht.
Er saß nur da, in sich zusammengesunken, als wäre er schuldig. Verzweifelt hörte er ihre Stimme über Rechte und Konsequenzen und Protokolle predigen. Zwei Mal hatte er versucht, den Mund aufzumachen. Er wollte sich erklären, wie es, das hatte sie gesagt, sein Recht war, aber seine Erklärung blieb in einem so heftigen Magenkrampf stecken, dass er nicht einmal den Rücken gerade machen konnte, als er ihr Büro verließ, obwohl sie noch gar nicht fertig war.
Jetzt war er allein.
In seinem Büro, das streng genommen nicht mehr seins war.
Suspendiert.
Zwei Dinge hatte Henrik im Leben. Nur zwei Dinge machten sein Dasein erträglich. Das eine war Hanne Wilhelmsens Familie in der Kruses gate.
Das andere, dass er ein tüchtiger Polizist war.
Das wusste er, und er bekam es zu hören. Immer wieder. Von Vorgesetzten und vom Polizeichef. Sogar von ganz oben aus dem Polizeipräsidium waren schon zweimal lobende Worte gekommen. Henrik konnte viele Tage lang lächeln, wenn so etwas passierte. Er war fleißig, wusste viel und arbeitete gründlich. Außerdem gab er niemals wirklich auf. Theoretisch ließ sich jeder Fall lösen. Er war selten bereit, einen Fall abzuschreiben, immer lagen fünf oder sechs in seinem Büro, die er sich bei Gelegenheit vornahm. In dem grünen Metallschrank neben dem Fenster hatte er sein eigenes Archiv für »kalte Fälle«, einen kleinen Stapel von Mysterien, die er noch nicht hatte aufklären können. Er widmete ihnen ziemlich viel Zeit. Zeit war das Einzige, wovon Henrik Holme reichlich hatte. Wenn jemand sich die Mühe gemacht hätte, Buch darüber zu führen, wie viele Stunden er sich in dem immer mehr heruntergekommenen Polizeigebäude in Grønlandsleiret aufhielt, hätten sie sich vor der Arbeitsschutzkontrolle fürchten müssen.
Aber Henrik wurde von fast allen in Ruhe gelassen.
Bis jetzt. Jemand wollte ihm übel mitspielen.
Er müsste jetzt aufstehen und gehen. Verschwinden. Nicht mehr da sein; der Gedanke, allem ein Ende zu setzen, war eigentlich logisch, und für einen Moment schloss er die Augen und verspürte eine Art Trost. Es dauerte nur ein oder zwei Sekunden, denn was er sich wünschte, war nicht der Tod.
Er wollte Gerechtigkeit. Die Vorwürfe der Belästigung waren glatter Wahnsinn, das musste doch alle Welt begreifen. Er war fünfunddreißig Jahre alt und hatte in seinem ganzen Leben kaum einer Frau auch nur ein Kompliment gemacht. Dass er eine belästigt haben sollte, war so unvorstellbar, so unmöglich, so …
Beim Gedanken daran, worauf sich die Vorwürfe bezogen, schlug er die Hände vors Gesicht. Nun strömten die Tränen, und er hielt den Atem an, um kein Geräusch zu verursachen. In seinem Zwerchfell hatte sich ein kräftiger Druck aufgebaut. Er steckte die Finger in die Ohren und versuchte, einen Gegendruck zu erzeugen. Ein Laut entrang sich seinem Kehlkopf, ein leises, schnarrendes Knurren.
Hanne Wilhelmsen würde ihm helfen können. Sie kannte ihn. Konnte für ihn bürgen. Wenn er ihr die Geschichte der Begegnung mit Margareth aus der Passabteilung erzählte, würde Hanne lachen. Herzlich und ausgiebig, ehe sie bei der Polizeichefin anrufen und dafür sorgen würde, dass sich die ganze Sache aufklärte. Es gab für alles Zeugen. Auch sie hatten gelacht, gegrinst und ihn aufgezogen und alles immer schlimmer gemacht, bis er sich ausreichend zusammengerissen hatte, um nach Hause zu gehen.
Sie hatten gefeiert, dass an diesem Tag alle durch die Pandemie bedingten Verbote aufgehoben worden waren. Endgültig, hofften die meisten. Die Stimmung in der Stadt war euphorisch gewesen, als sie von Lokal zu Lokal taumelten, trotz des kalten Winterwetters. Alle waren betrunken gewesen, aber sie mussten sich doch daran erinnern können, was passiert war.
Das Knurren legte sich erst, als er den Mund öffnete und alle Luft aus seiner Lunge entweichen ließ.
Das hier würde er Hanne niemals erzählen können, beschloss er dann. Natürlich konnte er das nicht. Er schämte sich viel zu sehr. Er war ein erwachsener Mann und musste seine Probleme selbst aus der Welt schaffen.
Zuerst könnte er sich an Margareth aus der Passabteilung wenden, eine Zweiundzwanzigjährige mit Zähnen, die viel zu klein waren für ihr großes, kreisrundes Gesicht. Ihr klarmachen, dass es nur ein Missgeschick gewesen war. Ein unvermeidliches Unglück eigentlich. Natürlich hätte er nichts trinken dürfen. Das könnte er immerhin mit gutem Gewissen zugeben. Er war nicht an Alkohol gewöhnt, und er konnte nicht begreifen, was ihn dazu gebracht hatte, die vielen Biergläser zu leeren, die die anderen ihm vor die Nase gesetzt hatten, und das in einem Tempo, mit dem er unmöglich Schritt halten konnte.
Aber die HR-Chefin hatte ihn verpflichtet, einen großen Bogen um Margareth zu machen.
Jetzt sei sie eine »Whistleblowerin«, so, wie Henrik das verstanden hatte.
Mit Anspruch auf Schutz. Mit Rechten. Den Vorschriften gemäß.
Er selbst war ganz und gar rechtlos, so kam es ihm vor, obwohl die HR-Chefin ihn gedrängt hatte, mit einem Anwalt zu sprechen. Oder mit der Gewerkschaft.
Als ob er so etwas wagen würde!
Einem wildfremden Menschen diese unendlich peinliche Geschichte zu erzählen.
Nein!
Jetzt knurrte er richtig. Zu seinem Erstaunen registrierte er einen wachsenden Zorn. Als er aufstand, war er bereits richtig wütend. Dieses Gefühl war fremd und wundervoll. Er kam sich größer vor als sonst, er machte den Rücken gerade und zog die Schultern nach hinten, in einem Versuch, die Brust vorzuschieben. Ohne nachzudenken, ging er mit festen Schritten zum Aktenschrank, schloss ihn auf und schnappte sich den Stapel der alten, ungeklärten Fälle. Die Polizei war schon längst vollständig digitalisiert, aber Henrik legte noch immer gern altmodische Ordner mit Ausdrucken an. Dass er nicht befugt war, diese Ordner aus dem Polizeigebäude zu entfernen, war ihm in diesem Augenblick völlig egal. Etwas musste er doch tun, während er auf die Entscheidung von höchster Stelle wartete. Irgendwie musste sein Gehirn Ruhe finden.
»Ich werde jeden Einzelnen davon lösen«, fauchte er leise und verstaute die Ordner in einem Fjällräven-Rucksack, den er von Nefis und Ida zu Weihnachten bekommen hatte. »Jeden einzelnen verdammten Fall!«
Als er den Dufflecoat übergeworfen hatte und Mut sammelte, um sein Büro zu verlassen, fiel sein Blick auf einen dünnen Umschlag, der ganz am Rand des Schreibtisches lag. Auch diesen Fall hatte er sich ausgedruckt, Papier hatte eine Haptik, die den Ernst der Sache betonte, fand er.
Vilde Karoline Bredesen, stand in der Spalte für persönliche Angaben.
Geboren 14. Januar 1999.
Vilde war vor drei Wochen gestorben, mit dreiundzwanzig Jahren, und die Ermittlungen würden bald eingestellt werden, weil keine strafbaren Verhältnisse vorlagen. Einwandfrei Selbstmord. Alles stimmte. Sie war in ihrer kleinen Wohnung in Mortensrud gefunden worden, einer Unterkunft, die vorher sorgfältig gesäubert und aufgeräumt worden war. Die Wohnungstür war von innen verschlossen, die Sicherheitskette war vorgelegt. Die Wohnung lag im vierten Stock, ohne Balkon, mit geschlossenen Fenstern und ohne Hinweise auf Einbruch. Der Abschiedsbrief war handgeschrieben, und das grafologische Gutachten hatte keinen Zweifel an der Echtheit gelassen. Außerdem hatten mehrere von Vildes Bekannten sie als einen Menschen geschildert, der in den letzten Tagen, vielleicht auch in den letzten Wochen, absolut verzweifelt gewirkt hatte.
Ohne dass irgendwer gewusst hatte, weshalb.
Der Abschiedsbrief sagte eigentlich niemandem besonders viel, aber er war jedenfalls inhaltsreich genug, dass der zuständige Jurist den Fall wohl bald als erledigt abstempeln würde.
So etwas kam vor.
Menschen nahmen sich das Leben.
Henrik fuhr sich mit dem Ärmel seines Dufflecoats über die Augen. Einen Moment lang hatte er das Gefühl, Vilde vor sich zu sehen. Blond und gerade kräftig genug für seinen Geschmack. Breite Hüften, schmale Taille. Große, schwere Brüste, fast wie eine schöne Fünfzigjährige. Sie sah aus wie aus einem dänischen Film der 60er-Jahre entsprungen. Er selbst war schon auf den ersten Blick hin und weg von ihr gewesen.
Vilde hatte ihn angelächelt. Freundlich und warm, immer wenn er das kleine Café in der Helgesens gate betreten hatte. Wie alle anderen Lokale war es in den beiden vergangenen Jahren häufiger geschlossen als geöffnet gewesen, aber immer, wenn die Pandemie vorübergehend ihren Zugriff ein wenig lockerte, war er mit bestimmten Schritten die kurze Strecke nach Løkka gegangen, um zu sehen, ob Vilde wieder da war.
Das war sie immer.
Immer gleich munter. Immer gleich wogend, wenn sie mit einem Cappuccino in der einen und zwei Biscotti auf einem Tellerchen in der anderen Hand auf ihn zukam. Ihre Stimme war leise und melodisch, und sie hatte den Akzent der norwegischen Südküste. Bei Vilde lief Henrik niemals vor Verlegenheit rot an. Ab und zu hatte er das Gefühl gehabt, dass er sie liebte.
Sie hätte für ihn bürgen können. Vielleicht hätte er sie bitten können, in aller Freundschaft. Um Hilfe. Darum, dass sie mit der HR-Stelle redete, oder mit der Polizeichefin oder sogar mit Margareth aus der Passabteilung, die sich in keiner Weise mit Vilde aus Grimstad messen konnte. In keiner Weise!
Vielleicht hätte er das getan. Sie gefragt. Wenn sie noch am Leben gewesen wäre.
Henrik wischte sich ein weiteres Mal über die Augen, die Haut über den Wangenknochen war schon wund von dem groben Wollstoff.
Vilde hatte sich das Leben genommen.
Und niemand wusste, weshalb.
Er legte den Rucksack auf den Schreibtisch, zog den Reißverschluss auf und steckte die Unterlagen über Vilde Karoline Bredesen zu den übrigen Ordnern. Dann stellte er den Becher mit den Kugelschreibern genau an die Stelle, wo er hingehörte, legte die Tastatur parallel zum Bildschirm und fegte unsichtbaren Staub von der Tischplatte. Am Ende atmete er dreimal tief durch, zog sich die Kapuze seines Dufflecoats über den Kopf und verließ das Polizeigebäude mir raschen Schritten.
Ohne zu wissen, ob er jemals wieder die Erlaubnis erhalten würde, es zu betreten.
***
Das konnte doch einfach nicht stimmen.
Der Mann musste sich irren.
Dabei war er Arzt. Ein erfahrener praktischer Arzt, zu dem die junge Verlagslektorin Ebba Braut schon ging, seit sie zum Theologiestudium nach Oslo gezogen war. Bisher war es nie etwas Ernstes gewesen, wenn sie seine Hilfe gebraucht hatte. Halsschmerzen, die einfach nicht verschwinden wollten und die am Ende dazu geführt hatten, dass sie die Mandeln entfernen lassen musste. Magenprobleme, die sich von selbst gelegt hatten. Kleinkram. Belanglosigkeiten. Sie hatte nicht einmal mit dem Gedanken gespielt, zum Arzt zu gehen, als sie vor einiger Zeit von ihrer ersten Runde COVID-19 umgeworfen worden war. Es war wirklich heftig gewesen, und sie hatte sich für zehn Tage isoliert. Danach hatte sie trotz allem ein gutes Gefühl gehabt bei dem Gedanken, die Krankheit hinter sich zu haben.
Das hier war etwas ganz anderes.
»Zeigen Sie mal«, sagte Ebba und streckte die Hand aus.
»Was denn?«
»Das da …«
Der Arzt lächelte, nahm Ebba an. Hinter dem Mundschutz und einem am Kopf befestigten Plastikschirm war das schwer zu sagen. Jedenfalls lag etwas Munteres in seinen gelbbraunen Augen. Die waren gesprenkelt, das sah sie erst jetzt; goldene Körner, die sozusagen mit der hellbraunen Iris verschmolzen. Die Augenbrauen waren grau, und einige Haare waren so lang, dass sie sich nach oben und zur Seite bogen. Kleine, muntere Hörner, hatte sie gedacht, als sie gekommen war. Wie bei einem lüsternen Ziegenbock.
»Ich will dieses Papier sehen. Das Testergebnis. Hier muss ein Irrtum vorliegen.«
Nun lächelte er auf jeden Fall. Die Augen wurden zu Strichen, die Krähenfüße vertieften sich. Er schob seinen Schreibtischstuhl zurück. Die Rädchen quietschten, sie müssten geschmiert werden. Als er nur noch ein paar Meter von ihr entfernt war, nahm er den Plastikschirm ab und schob sich den Mundschutz unter das Kinn.
»Ich freue mich auch nach all den Jahren noch über solche Ergebnisse«, sagte er gelassen und hielt ihrem Blick stand. »Fast egal, welche Umstände vorliegen. Aber welches Recht habe ich zu einer Meinung über das Leben und die Entscheidungen anderer Menschen?«
Er seufzte fast unhörbar und nickte zu dem Blatt Papier hin, das er auf einen kleinen Metalltisch neben ihr gelegt hatte. Es war unprofessionell von dem Mann, so etwas zu sagen, dachte sie. Er hatte überhaupt nichts zu meinen. Seine Aufgabe war es, sich den Tatsachen gegenüber neutral zu verhalten. Ihr gegenüber. Vor allem jetzt. Obwohl er sicher an Patientinnen gewöhnt war, die über eine solche Nachricht jubelten, konnte sie ja wohl kaum die Erste sein, die dadurch in ein unwirkliches Chaos geschleudert wurde.
Außerdem war es unmöglich.
Der Arzt warf einen Blick auf den Bildschirm auf seinem Schreibtisch.
»Hier steht nichts über Verhütung während der letzten zwei Jahre. Viele junge, ledige Frauen haben die Pandemie genutzt, um aus der Verhütung für eine Weile auszusteigen. Haben Sie das auch getan?«
Ebba Braut gab keine Antwort, sie musterte den Ausdruck.
»Wann hatten Sie die letzte Menstruation?«, fragte der Arzt.
Ebba gab noch immer keine Antwort. Ihr Blick bohrte sich in das Papier, das erklärte, der hCG-Wert in ihrer Blutprobe lasse nicht den geringsten Zweifel zu.
»Weiß nicht mehr«, murmelte sie schließlich.
Das stimmte. Sie wusste es nicht. Idiotisch. Früher hatte sie diese Dinge im Griff gehabt. Aber das war vor dem neuen Job, vor dem landesweiten Lockdown und vor einem spektakulären Kriminaldrama, dem fast zwei Jahre der Isolation gefolgt waren. Und es war, lange ehe sie sich zu einer Impfung bereit erklärt hatte, von der sie gelesen hatte, dass sie den weiblichen Zyklus total durcheinanderbringen konnte.
»Haben Sie Familie?«, fragte er vorsichtig. »Wie sieht Ihr Netzwerk hier in Oslo aus? Es gibt viele Angebote …«
»Mischen Sie sich da gar nicht erst ein«, fiel Ebba ihm mit scharfer Stimme ins Wort.
Die Wut ließ ihre Hände zittern, und sie schleuderte den Ausdruck in Richtung des Metalltisches. Das Blatt aber setzte stattdessen zu einem lautlosen Segelflug Richtung Boden an.
»Das muss ein Irrtum sein, hab ich doch gesagt. Eine Verwechslung der Ergebnisse oder so was.«
»Das ist sicher nicht der Fall«, sagte der Arzt beherrscht. »Neben den Testergebnissen haben wir ja auch noch Ihre Symptome. Der Grund, aus dem Sie gekommen sind. Übelkeit. Lustlosigkeit. Müdigkeit.«
Er lächelte nicht mehr.
»Wir sollten so bald wie möglich feststellen, wie weit Sie schon sind. Nur dann werden die … die Entscheidungsmöglichkeiten für Sie offenstehen. Wie Sie wissen, teile ich die Praxis mit Dr. Kavli …«
Mit dem Daumen zeigte er über seine Schulter.
»Er ist Gynäkologe, und ich kann für Sie sehr bald einen Termin bei ihm machen. Wenn Sie das wollen.«
»Sie müssen mir zuhören«, sagte Ebba wütend. »Ich bin nicht schwanger!«
»Nun, der Ultraschall wird …«
»Hören Sie mir endlich zu!«
Ihre Handfläche knallte auf den Tisch. Es war ein dermaßen scharfes Geräusch, dass Ebba selbst zusammenzuckte. Der Arzt starrte sie entgeistert an und rückte ein Stück mit seinem Stuhl zurück.
»Ich bin ganz sicher«, sagte sie und versuchte, sich zu beruhigen. »Und der Grund ist, dass … dass ich mit niemandem geschlafen habe. Nicht seit dem Beginn der Pandemie. Genauer gesagt …«
Sie holte dreimal tief Luft, als ob sie Anlauf nähme, um das Unbegreifliche in Worte zu kleiden.
»Das letzte Mal war am 25. Februar 2020. Vor auf den Tag genau zwei Jahren. Unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie.«
Jemand näherte sich mit raschen Schritten der Tür, vielleicht die Sprechstundenhilfe, die von dem Knall beunruhigt war. Ebba erhob sich. Sie legte die Handflächen aneinander. Ihre Stimme war jetzt anders, sie hörte selbst, dass es wie eine Bitte klang, als sie fast flüsterte: »Verstehen Sie mich jetzt, Herr Doktor?«
***
Als Henrik Holme zu Hause angekommen war, nachdem er die Strecke zwischen Polizeigebäude und Korsgate in Rekordzeit zurückgelegt hatte, blieb er stehen und lehnte sich mit dem Rücken an die Wohnungstür. Die hatte er vorher aufs Sicherste geschlossen, mit zwei Schnappschlössern und einer Kette. Er rang um Atem, obwohl er dazu eigentlich viel zu gut in Form war. In seinen Ohren pfiff es.
Er zwang sich, kontrolliert zu atmen.
Schloss die Augen.
Horchte auf sein eigenes starkes Herz, das schlug und schlug.
Damit würde es weitermachen. Er würde nicht sterben. Jedenfalls noch nicht. Mit übertrieben langsamen Bewegungen zog er den Dufflecoat aus und hängte ihn an den Haken in dem engen Gang, gleich bei der Badezimmertür. Noch einmal schloss er die Augen, während er in Gedanken bei jedem tiefen Atemzug bis fünf zählte.
Das half. Sein Puls senkte sich, und das Hochfrequenzgeräusch verstummte. Er packte den Rucksack am Griff und ging damit ins Wohnzimmer. Auch hier blieb er, gleich vor der Schwelle, eine Weile stehen und schaute sich um.
Die Wohnung war wie immer sauber und aufgeräumt, aber das war auch alles. Der Geruch, an den er eigentlich so gewöhnt war, dass er ihn nicht mehr bemerkte, war jetzt aufdringlich. Einige der Möbel hatte er beim Tod seiner Großmutter geerbt. Sie strömten noch immer etwas von den 60er-Jahren aus: Kochkaffee und Teaköl, mit dem er weiterhin einmal im Halbjahr den Eckschrank behandelte. Aus einem gut gefüllten Bücherregal, das er um den türlosen Eingang zur Küche gezimmert hatte, roch es noch älter. Dort stand kaum ein während der letzten fünfzig Jahre verfasstes Buch. Hamsun und Selma Lagerlöf, Dostojewski und Ernest Hemingway und eine vollständige Ausgabe der Encyclopedia Britannica. Klassiker mit monochromem Rücken, alles zusammen aus dem Nachlass des Vorbesitzers. Die Bücher hatten in Kisten gelegen, für die die Hausverwaltung um Entschuldigung gebeten hatte, der Vereinbarung nach hätten sie längt entfernt sein müssen.
Henrik Holme fand plötzlich, dass die Wohnung, die er eigentlich immer gerngehabt hatte, nach Versager roch.
Und in der Küche stank es noch dazu nach Fisch.
Fischfrikadellen, das ging ihm auf, als er den Rucksack auf dem Couchtisch stehen ließ und zum Kühlschrank ging, um sich ein Glas Milch zu holen. Auf dem Küchentisch lag eine halb verzehrte Fischfrikadelle. Es sah ihm gar nicht ähnlich, dass er gestern Abend vergessen hatte, sie nach dem Essen einzupacken und in den Kühlschrank zu legen. Sicher hatte ihn die Vorladung zur HR-Chefin durcheinandergebracht, schon ehe er gewusst hatte, worum es ging. Er hatte durchaus eine Ahnung gehabt, das musste er zugeben, bei der Arbeit hatten die anderen noch mehr als sonst hinter seinem Rücken gefeixt. Und Margareth aus der Passabteilung hatte weggeschaut, als er in der Kantine zweimal versucht hatte, ihren Blick einzufangen. Um sich zu entschuldigen, hatte er gedacht, auch wenn doch alles ein Missverständnis gewesen war.
Henrik warf die halbe Fischfrikadelle in den Mülleimer, füllte ein Glas mit Milch und ging damit zurück ins Wohnzimmer. Dort setzte er sich in den Ohrensessel, den er vor der Pandemie auf dem Flohmarkt gekauft hatte.
Der Sessel roch nach nasser Wolle, was Henrik auch noch nie vorher aufgefallen war.
Er trank die Milch. Die schmeckte zu süß und war so kalt, dass er sofort Kopfschmerzen bekam. Er packte sich mit zwei Fingern an der Nasenwurzel und drückte zu. Mit der anderen Hand griff er nach dem Rucksack auf dem Tisch. Sowie sich der Schmerz gelegt hatte, zog er die mitgenommenen Fallunterlagen heraus.
Die alten, ungelösten Fälle legte er rasch beiseite, als perfekten Stapel an der Tischkante. Die Mappe mit den Informationen über die dreiundzwanzig Jahre alte Vilde Karoline Bredesen packte er sich auf den Schoß. Und öffnete sie.
Ihr Bild lag ganz oben.
Ihm traten Tränen in die Augen. Vilde war auf unaufdringliche Weise hübsch gewesen. Das Foto war im Schlafzimmer der jungen Frau gefunden worden. Eine ganze Wand war von Familienbildern bedeckt gewesen, daran erinnerte Henrik sich jetzt, von Hüfthöhe bis fast zur Decke. Einige waren vergrößerte Schnappschüsse, von Kindern, die spielten oder badeten oder konfirmiert wurden. Andere Bilder waren alt. Schwarz-Weiß-Fotografien von posierenden, ernsten Ehepaaren. Urgroßeltern vielleicht. Mehrere Farbbilder waren offensichtlich von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden. Drei davon zeigten eine siebenköpfige Familie und waren im Abstand von mindestens fünf Jahren entstanden. Auf dem jüngsten war Vilde zwölf oder dreizehn. Sie war sofort wiederzuerkennen. Ihre vier Brüder waren älter als sie. Kräftige Jungen mit breitem Lächeln. Sie hatten große Ähnlichkeit mit dem rothaarigen Vater, während Vilde ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war. Blond und niedlich und im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Vor allem als Baby auf dem ältesten Bild. Dort saß sie mitten in der Schar, auf dem Schoß des Vaters, während die übrige Familie sie anstarrte, als wäre sie ein Wunder.
Vielleicht war sie das gewesen.
Endlich ein Mädchen nach vier lärmenden Jungen.
Henrik selbst war ein Einzelkind und niemals zum Fotografen gebracht worden.
Er legte das Bild beiseite und schloss die Augen. Vom Markvei her hörte er laute Rufe zwischen den Mauern, gefolgt von einem kratzenden, metallischen Geräusch. Normalerweise wäre er zum Fenster geeilt, um nachzusehen, was passiert war. Schlimmstenfalls bedeutete es: Auto gegen Fahrrad. Er sollte hinauslaufen.
Er blieb sitzen.
Kein Zweifel, hatte der zuständige Ermittler gesagt. Einer der eindeutigsten Selbstmordfälle, die ich je gesehen habe.
Henrik war am Tatort gewesen. In der Wohnung. In Vildes kleiner Höhle, einem gemütlichen Fleckchen Erde, wo sie eine Nische zum winzigsten Schlafzimmer aller Zeiten umgebaut hatte. Sie lag im Bett, mit aufgeschnittenen Pulsadern am linken Handgelenk, alles war auf fast professionelle Weise durchgeführt worden. Aber sie war ja auch angehende Krankenschwester gewesen. Der Schnitt war scharf und tief und zog sich längs über den Arm, nicht quer, wie es in schlechten Filmen gar zu oft der Fall war. Die Blutproben waren noch immer nicht fertig, aber nichts in der Wohnung deutete auf Alkoholkonsum oder andere starke Substanzen hin. Keine Pillengläser oder Flaschen. Keine Reste von etwas, das den Schmerz nach dem tiefen Schnitt mit dem Skalpell hätte betäuben können.
Henrik Holme staunte immer wieder darüber, wie sehr sich Blut überall breitmachte.
Der Selbstmordbrief lag im Wohnzimmer. Mit der Hand geschrieben. Es stand nicht viel darin, nur ein letzter Gruß an die Eltern an der Wand und eine Erklärung, dass Vilde sie liebte und ihnen nicht wehtun wollte. Sie mussten das Letzte gewesen sein, was sie im Leben gesehen hatte, vom Bett aus hatte sie den Blick nur auf die Familienwand dem Kopfende gegenüber richten können.
Der Gedanke, wie sehr sie wohl gelitten hatte, in Leib und Seele, versetzte ihm einen Stich. Selbstmordfälle gehörten zu dem Schlimmsten, womit er sich beschäftigen musste, und es gab viel zu viele davon.
Es war schwer zu begreifen, dass eine junge Frau wie Vilde Karoline Bredesen keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen. Sie war erst dreiundzwanzig, angehende Krankenschwester mit einem netten Nebenjob, und sie hatte ihre Finanzen so gut im Griff, dass ihr dieser kleine Unterschlupf in Mortensrud gehört hatte. Sie hatte die Wohnung während der Pandemie gekauft. Zweiunddreißig Quadratmeter für die Summe von 2,9 Millionen Kronen. Das hatte ihr eine gewisse Menge an Schulden beschert, aber nicht schlimmer als bei anderen, die sich auf dem absolut durchgeknallten Wohnungsmarkt die erste Wohnung zulegten.
Sie hatte da unten in Grimstad eine offenbar liebevolle Familie. Freundinnen hatte sie auch. Henrik hatte einige von ihnen im Café gesehen, wo sie gearbeitet hatte; ihr Lächeln war noch strahlender geworden und ihre Stimme noch etwas munterer, wenn sie vorbeischauten und sie mit einer Umarmung begrüßten. Mit dreien von ihnen hatte er nach dem Selbstmord gesprochen. Sie waren von aufrichtiger Trauer und tiefem Schock geprägt.
Und von einem Freund hatte keine etwas gewusst.
Keine schwerwiegenden Geldprobleme. Kein Liebeskummer, soviel man wusste. Eine gute Familie, nahm er an, auch wenn er während der kurzen, offenbar ziemlich gleichgültigen Ermittlungen nicht selbst mit ihnen gesprochen hatte.
Unten näherte sich ein Streifenwagen mit heulenden Sirenen. Als Henrik die Augen öffnete, konnte er das Blaulicht an der Decke kreisen sehen. Noch immer blieb er sitzen.
Er schaute auf die Uhr.
Halb zwei Uhr mittags. Noch immer war alles offen, und die meisten Menschen waren bei der Arbeit. Er griff nach seinem Telefon und suchte die Nummer heraus, die er schon viel zu oft angerufen hatte. Nach nur zweimaligem Klingeln meldete sich jemand.
»Heidi Kvitne«, sagte eine freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Hallo. Henrik hier, Holme, Polizei Oslo.«
»Ach ja.«
Ihr Interesse ließ sofort nach.
»Es geht um den Fall Nummer …«
Er beugte sich vor und blätterte in den Unterlagen, fand eine Reihe von Buchstaben und Ziffern und las sie vor. Ein piependes Geräusch veranlasste ihn, das Telefon von seinem Ohr zu entfernen. Dann hörte er, wie sie eine Tastatur benutzte.
Es wurde still.
»Hallo?«, fragte er, als die Pause zu lang wurde.
»Ich finde es nicht.«
»Was?« Henrik nahm das Telefon in die linke Hand und fragte: »Wie meinst du das?«
»Also, ich sehe den Fall. Vilde Karoline Bredesen. Geboren 1999. Gestorben vor drei … Moment mal. Doch.«
Wieder wurde es still.
»Bist du noch da?«, fragte Henrik.
»Natürlich«, antwortete die Frau ungeduldig. »Es ist nur, dass ich nicht sehen kann, wo ihre Sachen im Moment sind.«
»Ihre Sachen? Wie meinst du das?«
»Die Proben. Die Ergebnisse. Das, was analysiert werden sollte. Blutproben und …«
Heidi Kvitne aus der Universitätsabteilung für Rechtsmedizin hatte seit ihrem letzten Gespräch offenbar noch mehr verlernt, in vollständigen Sätzen zu sprechen. Henrik holte tief Luft und ließ sie so langsam entweichen, dass Heidi Kvitne das hoffentlich als ungeduldigen Seufzer auffasste.
»Ich meine«, hörte er dann schließlich, »wir haben die Proben bekommen. Das steht hier. Es ist bloß, dass … hier fehlt etwas.«
»Was denn?«
»Eine Registrierungsspalte ist nicht ausgefüllt worden. Und ohne die Registriernummer kann ich die Analysen nicht finden. Nicht im Computer, mein ich. Muss die Nummer haben.«
»Habt ihr …« Jetzt war es Henrik, dem es schwerfiel, Worte zu finden. »Habt ihr die Blutproben verschusselt?Unsere Blutproben?«
»Nicht direkt verschusselt. Das ist ziemlich sicher. Wie gesagt sind sie als eingetroffen registriert. Aber dann ist offenbar irgendetwas passiert. Irgendwer hatte es vielleicht eilig. Wir haben hier schrecklich viel zu tun, nur um das mal festzuhalten.«
»Aber dann musst du sie finden. Die Proben sind doch eine physische Größe. Eine … Sache, sozusagen, wie du selbst gesagt hast. Wie schwer kann es da sein, sie zu finden?«
»Sehr«, antwortete sie kurz. »Wie eine Nadel in einem …«
Heuhaufen, fügte Henrik in Gedanken hinzu.
»Aber sie ist obduziert worden«, sagte er stattdessen. »Kannst du nicht einfach …«
»Nein«, sagt sie so entschieden am anderen Ende der Leitung, dass er fast hören konnte, wie sie den Kopf schüttelte. »Sie ist nicht obduziert worden.«
»Nicht … Sie ist nicht obduziert worden?«
»Du klingst überrascht?«
»Das war doch ein unnatürlicher Todesfall, gelinde gesagt?«
»Unbedingt. Aber ihr habt nicht darum ersucht. Die Polizei, meine ich. Der Fall ist sicher ganz offensichtlich. Wir obduzieren nicht alle Selbstmordopfer. Ich dachte, du …«
Wüsstest das, dachte Henrik. Und das tat er ja auch.
Obduktionen kosteten Geld. Und alles, was etwas kostete, war Einsparungen unterworfen. Kürzungen im Etat. Er glaubte gelesen zu haben, dass mehr als zwanzig Prozent der Selbstmordopfer in Oslo nicht obduziert wurden. Das provozierte ihn. Nur durch eine gründliche Untersuchung der Toten konnte man hoffen die Geheimnisse hinter den selbst gewählten Todesfällen zu finden. Wenn Abschiedsbriefe hinterlassen worden waren, konnten die ebenso entlarvend wie irreführend sein. Der Körper dagegen log nicht. Er konnte Krankheiten verraten, von denen niemand gewusst hatte. Missbrauch von Alkohol oder Medikamenten. Misshandlungen, die bei der Obduktion ans Licht kamen.
»Es war wohl zu offenkundig«, hörte er Heidi Kvitne wiederholen, ziemlich uninteressiert. »Offenkundiger Fall, meine ich. Das weißt du übrigens besser als ich.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Wer?«
»Vilde Karoline Bredesen.«
»Sie ist … Sie ist längst ihren Angehörigen übergeben worden. Der Familie, nehme ich an. Vermutlich ist sie inzwischen begraben. Es ist doch schon … drei Wochen her, dass sie gestorben ist?«
Henrik hob die freie Hand vor die Augen und ballte die Faust. Die Fingerknöchel wurden weiß, das sah er, und er biss die Zähne so fest zusammen, dass ein weher Backenzahn, der längst hätte gefüllt werden müssen, ihm einen Stich versetzte.
»Ihr habt also die Leiche freigegeben und alle Proben verschusselt, die wir euch geschickt haben?«, fragte er, so ruhig er konnte.
»Nein. Ich würde nicht behaupten, dass wir etwas verschusselt haben. Aber hier liegt irgendwie eine Falschregistrierung vor. Ich kann natürlich versuchen …«
»Ja, das solltest du unbedingt. Versuchen, die Proben zu finden. Und wenn du sie gefunden hast, dann rufst du mich sofort an. Und damit meine ich sofort.«
Sein scharfer Tonfall ließ ihn selbst zusammenzucken, und eilig fügte er hinzu: »Wenn das für dich in Ordnung ist, meine ich.«
»Sicher. Bis dann.«
Ein Bruchteil einer Sekunde verging, dann fiel ihm die Suspendierung ein, die für kurze Zeit in den Hintergrund gerutscht war durch die Schlamperei, die die Frau am anderen Ende der Leitung gar zu leicht zu nehmen schien.
»Nur noch eins«, sagte er laut, sie hatte zum Glück noch nicht aufgelegt. »Ruf mich unter dieser Nummer an. Auf dem Handy. Ich bin … gerade ziemlich viel unterwegs, und es eilt.«
»Alles klar«, sagte Heidi Kvitne mürrisch und legte auf.
Samstag, 26. Februar
Ein Lyriker schaute aus dem Fenster.
Er war ein Name, den man kennen musste: Aasmund Aaletjønn. Er hatte zwar nur fünf Gedichtsammlungen veröffentlicht in den dreißig Jahren, die seit seinem Debüt vergangen waren, aber dafür war jede davon ein Ereignis gewesen. Und zwar jedes Mal ein größeres. Die erste Sammlung, Skizzen von einem Acker, Gedanken über eine Ernte, war mit dem Debütantenpreis und einem ziemlich fetten Stipendium belohnt worden. Danach war ihm das seltene Kunststück gelungen, sowohl von der Kritik gelobt als auch vom Publikum geliebt zu werden. Er gab nur selten Interviews. Nicht, weil er besonders eigen gewesen wäre, sondern weil er einfach keine Lust hatte. Belanglosigkeiten interessierten ihn nicht, und ein Pressemensch war im Grunde wie der andere. Sie hatten in der Regel keine Ahnung. Unmittelbar vor der Pandemie hatte ein unbekannter junger Novellenschreiber dennoch eine einstündige Porträtsendung über ihn aufnehmen dürfen. Die war mehrmals gesendet worden und wurde dann auch noch als Podcast des norwegischen Rundfunks ein Erfolg. Seine letzte Lyriksammlung, damals drei Jahre alt, hatte im ersten Herbst, in dem alle eingeschlossen waren, zwei Auflagen erlebt.
Indre Vestfold war nie so trist wie jetzt, mitten im Februar. Der Schnee zwischen den Kiefernstämmen war eingesackt und schmutzig. Die Bäume sahen tot aus. Ein Fichtenkreuzschnabel flog resigniert am Waldrand entlang nach Süden, auf Jagd nach Nahrung. In diesem Jahr würden wohl kaum viele dieser kleinen Finkenvögel zu sehen sein, es hatte bei den Nadelbäumen seit Ewigkeiten keine so schlechte Samenbildung gegeben. Aasmund Aaletjønn hatte zwei Tage zuvor ein Nest entdeckt, im Wipfel einer mageren und halb im Boden eingesunkenen Tanne. In jüngeren Jahren wäre er hochgeklettert, um zu sehen, ob schon Eier darin waren. Sie waren früh unterwegs, diese Fichtenkreuzschnäbel. Brüteten, obwohl die Temperaturen noch unter null lagen.
In etwa einer halben Stunde würde sie eintreffen.
Das war jedenfalls die Abmachung. Mit GPS war es eine Kleinigkeit, herzufinden, abgesehen vielleicht von den letzten beiden Kilometern von der Bezirksstraße 306 hierher. Die Abfahrt war nicht ausgeschildert und führte auch nur auf einen huckeligen Waldweg.
Aasmund Aaletjønn wandte den Blick vom Fichtenkreuzschnabel ab und drehte sich zum Zimmer um.
Fast alles war vorbereitet. Überall war es sauber und ordentlich, und in dem großen Kamin in der Ecke zur Küche brannte schon seit dem Morgen ein munteres Feuer. Nicht dass das zum Heizen notwendig gewesen wäre; das Wohnhaus war größer und viel moderner geworden, seit er hier aufgewachsen war, auf dem ehemals kleinsten Hof der Umgebung.
Vermutlich würde sie überrascht sein. Dafür, dass er so abgelegen wohnte, war es ziemlich luxuriös. Strom und Wasser und Internet. Der Mangel an Breitband war schon vor Jahren durch einen auf seinem Grundstück aufgestellten Mobilmast behoben worden. Die Mieteinnahmen für den Boden, auf dem der Mast stand, überschritten die Ausgaben für die Benutzung von 4G um ein Weites, und bald würde er zu 5G hochgestuft werden.
Das Manuskript lag da, wo es hingehörte.
Auf dem Couchtisch. Ausgedruckt am Vorabend, nach den letzten winzigen Korrekturen. Genau hundert Gedichte, eins auf jeder Seite, 120 Gramm chlorgebleichtes Papier, um die Schwere zu erreichen, die Poesie verdiente. Als Bauchbinde hatte er das Ganze mit einem rot-gelb-schwarzen Flechtband umwickelt. Vor langen Zeiten hatte seine Ururgroßmutter dieses Muster entworfen, und später gelangte es dann als tragendes Element in die Tracht von Vestfold.
Er besaß ganze Meter von diesen Bändern.
Auf dem Papierstapel lag ein Speicherstick mit den Gedichten; er wusste, dass das Originalmanuskript zu seinen früheren Werken in ein verschlossenes und unzugängliches Archiv gelegt werden würde. Davon hat niemand irgendwas, dachte er, aber so wollte er es.
Wieder schaute er auf die Uhr.
Jetzt müsste sie bald kommen. Er legte den Kopf schräg und glaubte, Motorengeräusche zu hören. Als er zum südlich ausgerichteten Fenster ging, konnte er sehen, dass das trübe Wetter sich nun langsam verzog. Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolken in umgekehrter Fächerform; er nannte sie Finger Gottes, wenn sie so sichtbar waren wie jetzt. Die Fensterhaken saßen locker, und es war leicht, das Fenster auf kipp zu stellen.
Nun näherte sich aber wirklich jemand, das konnte er hören.
Aasmund Aaletjønn war froh. Er freute sich. Es verschaffte ihm eine tiefe Befriedigung, den Schlusspunkt gesetzt zu haben. Eine hohe Erwartung dabei, seine Gedichte abzugeben. Das zu teilen, was eigentlich unteilbar war. So war es schon gewesen, als er zum ersten Mal in Oslo bei einem Pfeife rauchenden, übel riechenden Cheflektor angeklopft hatte, um seine ersten Gedichte einzureichen. Und als ihm ein beifälliges Lächeln zuteilgeworden war, nachdem der Mann erst drei davon gelesen hatte.
Aasmund schaute sich nach dem ordentlichen Papierstapel um. Sein Herz machte einen doppelten Schlag.
Rasch lief er zum Büfett hinüber. Es war seltsam, dass er vergessen hatte, den silbernen Rahmen zu entfernen, der neben einer Schale mit Clementinen stand. Er griff danach und legte ihn vorsichtig in eine Schublade in dem Möbelstück. Danach legte er einen weißen offenen Umschlag neben das Bild und stellte schließlich sicher, dass die Schublade wieder sorgfältig geschlossen war. Sein Puls ging noch immer ein bisschen zu schnell, als er danach das Manuskript nahm und damit hinaus auf die Treppe ging.
Das Sonnenlicht flutete über den Hofplatz.
Ein kleines gelbes Auto mit der Aufschrift AVIS an den Seiten stand vor dem Holztor, wo der Weg endete. Die Fahrerin schien Angst zu haben, dass sie nicht hindurchkommen würde, obwohl sie auf beiden Seiten mindestens einen Meter Spielraum hatte. Der Motor brummte ein wenig, dann fuhr der Wagen langsam unter die große Eiche bei der Scheune und hielt dort. Ein wenig schräg und mit zwei Rucklern, ehe der Motor ausgeschaltet wurde.
Die Frau war jünger, als Aasmund Aaletjønn sich das vorgestellt hatte. Blonder auch, und schlanker. Hübscher. Etwas ganz anderes als der schmuddelige Cheflektor, der seine beiden ersten Veröffentlichungen betreut hatte, ehe der Mann dann einfach gestorben war. Die Fahrerin des Mietwagens erinnerte auch nicht an die herzensgute Eli Schwartz, die ältere Dame, die für die folgenden zwanzig Jahre die Betreuung seines Werks übernommen hatte und ihn unter anderem begleitet hatte, als er mit dem Literaturpreis des Nordischen Rates ausgezeichnet worden war.
Die Gestalt dieser jungen Frau hätte das Modell sein können, das Gott im Garten Eden benutzt hatte.
Die Wagentür fiel zu, und sie kam über den mit Eis, Matsch und Streusand bedeckten Hofplatz auf ihn zu. Sie ging rasch, aber mit einem winzigen, femininen Hüftschwung. Sie war geschmeidig, sie sah aus, als ob sie gerne lief. Dennoch hatte ihr Gang etwas Kontrolliertes. Als ob etwas sie zurückhielt.
Er drückte sich das Manuskript an die Brust. Sie reichte ihm die Hand. Er hatte vor zwei Jahren zuletzt jemandem die Hand geschüttelt und wusste nicht so ganz, wie er sich verhalten sollte. Das Ganze wurde seltsam, er stand zwei Treppenstufen über ihr, und sie schaute schräg zu ihm hoch, als er fast das Manuskript hätte fallen lassen, ehe er endlich die warme, trockene Hand nahm und seinen Namen murmelte.
»Ebba. Ebba Braut«, erwiderte sie ruhig. »Deine neue Lektorin.«
Aasmund Aaletjønn erschien in den meisten Lebensbereichen als bedächtiger Mann. Er war 1961 als Sohn eines Kleinbauernpaars geboren worden und nicht gerade in materiellem Überfluss aufgewachsen. Er war gern allein, und er war nach dem Tod seiner Eltern freiwillig auf den Hof zurückgezogen. Er hatte nie Probleme damit gehabt, Frauen zu finden, zumindest sah er das so. Sie waren in der Regel leicht zugänglich und fühlten sich durch die Aufmerksamkeit des Dichters geschmeichelt. Schwieriger war es, sie zu halten. Er war nie verheiratet gewesen und hatte, wenn überhaupt, nur wenige wirklich enge Freunde. Geschwister hatte er auch keine.
Ein Einsiedler war er aber trotzdem nicht. Mit siebzehn war er zur See gegangen und bis fünfundzwanzig ununterbrochen auf großer Fahrt gewesen. Er hatte die Welt gesehen, wenn auch in einer anderen Zeit. Als Autor war er nun ab und zu in Oslo, meistens auf Einladung und Kosten des Verlags. Mindestens einmal im Monat fuhr er nach Larvik oder Sandefjord, um das Nötigste zu erledigen, und ein paarmal die Woche ins Dorf zum Einkaufen. Dann fing er immer ein Gespräch über Gott und die Welt an, und keiner der Bauern in der Nachbarschaft zögerte, wenn er ein seltenes Mal bei irgendetwas auf dem Hof Hilfe brauchte.
Ebba Braut jedoch setzte ihn völlig außer Gefecht.
Er klammerte sich an seine Gedichte, als ob sein Leben davon abhinge.
»Sollen wir reingehen?«, schlug sie vor.
Sogar ihre Stimme war für Aasmund Aaletjønn etwas ganz Neues.
Er blieb reglos stehen; seine Gedanken wirbelten wild durcheinander. Er konnte ihren Duft wahrnehmen, etwas Großstädtisches, Junges, es roch nach Zitrus. Wie alt konnte sie sein? Die Beine drohten unter ihm nachzugeben, er musste einen Schritt zur Seite machen, und sie sah ihn fragend an. Er wollte den Mund aufmachen und sie hineinbitten, wollte ihr das Manuskript geben – halb beiläufig, halb feierlich. Auf dem Umschlag stand ein Titel, an den er sich nicht mehr erinnern konnte, denn die große Unsicherheit hatte ihn ins Chaos gestürzt.
Hatte er das Bild auch wirklich weggenommen?
***
Von allen Wochentagen war der Samstag für Henrik Holme der schlimmste. Der Freitagnachmittag war auch ziemlich übel, aber der dauerte trotz allem nur ein paar Stunden. Sonntags ging er in der Regel in Museen, Ausstellungen oder ins Kino, immer allein. Außerdem war er an einem Sonntag im Monat bei Hanne Wilhelmsen und ihrer Familie zum Essen eingeladen.
Der Samstag dagegen …
Der Samstag fing viel zu früh an. Aus irgendeinem Grund wachte Henrik immer zwischen sechs und sieben auf, genau wie an Werktagen. Nichts half, nicht einmal wenn er sich dazu zwang, am Vorabend lange aufzubleiben und sich alte Filme anzusehen. Die morgendliche Stille passte eigentlich zum Sonntag. Die leeren Stunden am Samstag dagegen, bis die Läden – und jetzt auch wieder die Cafés – im Markvei öffneten, waren nur eine Erinnerung an Henriks unfreiwillige Einsamkeit. Normalerweise nutzte er den Tag, um Bücher zu lesen und sich auf den Montag und eine neue Arbeitswoche zu freuen.
Jetzt war alles nur schwarz.
Auch draußen, wie er feststellte. Durch den Spalt zwischen den Schlafzimmervorhängen war noch keine Spur von Tageslicht zu sehen. Aufgrund der durch die Decke gegangenen Strompreise sparte die Stadt an der Straßenbeleuchtung. Er seufzte, drehte sich auf den Rücken und faltete die Hände über der Bettdecke.
Er sehnte sich nach einem Menschen, mit dem er reden könnte. Wenn seine Mutter nicht schon längst in eine geistige Nebellandschaft versunken wäre, in der sie nicht mehr ansprechbar war, hätte er sich mit ihr zufriedengegeben. Aber so, wie sie jetzt war, hätte er auch mit der Wand reden können. Das war nicht das, was er brauchte. Er brauchte einen lebenden Menschen. Er wünschte sich die Bestätigung, dass er nichts falsch gemacht hatte. Dass er wirklich niemandem zu nahe getreten war und dass sich alles klären würde, sobald er erklären konnte, was wirklich passiert war.
Das Problem war, dass er sich an die ganze Episode nicht mehr so richtig erinnerte.
Nicht an alles, und außerdem nur sehr vage.
Er war jedenfalls gestolpert, das wusste er noch, als er sich in die Damentoilette verirrt hatte, um sich zu übergeben. In seiner Verwirrung hatte er irgendwo Halt gesucht. Genau in dem Moment kam Margareth aus der Passabteilung aus der nächstliegenden Zelle. Ihre Vorderpartie war überaus umfangreich, und im Nachhinein hatte Henrik mehrmals gedacht, dass ihr Busen ihn vor einem ziemlich üblen Sturz auf den Betonboden gerettet hatte.
Sie schrie auf; nie im Leben würde er diese schrille Mischung aus Schmerz und Angst vergessen, als er ihre Brüste packte, mit jeder Hand eine, und das Gleichgewicht wiederfand. Wenn sie allein gewesen wären, hätte Henrik sich möglicherweise aus allem herausreden können. Hätte sie beruhigen und auf der Stelle um Entschuldigung bitten können. Aber sie waren nicht allein. Die Tür zum Pub hin stand offen, und drei der jüngsten Kollegen hatten alles gesehen. Sie johlten und lachten und schrien: »ME-TOO! ME-TOO! Me-too durch Holme, hier!«
Der Rest dieses Samstagabends war im Nebel versunken. Auf irgendeine Weise war er nach Hause und ins Bett gekommen. War um vier Uhr aufgewacht, schweißnass und mit hämmerndem Herzen und dem dringenden Wunsch, das alles sei nur ein Albtraum gewesen.
Die Hoffnung hatte sich rasch zerschlagen, und die Tage danach waren zur Qual geworden.
Wenn er doch nur auf dem Beton auf die Fresse geknallt wäre!
Der Schlaf rückte in unerreichbare Ferne. Da konnte er auch gleich aufstehen. Ein bisschen mit Legosteinen bauen vielleicht, ein Hobby, das er sich während der Pandemie zugelegt hatte. Aktuell arbeitete er an der Tower Bridge, und er hatte erst sehr wenige der 4295 Steine zusammengesetzt.
Der Boden fühlte sich kalt an, als er die Füße aus dem Bett schwang und zur Morgentoilette ins Badezimmer stapfte. Erst danach warf er einen Blick auf sein Mobiltelefon. Er bekam nur sehr selten Mitteilungen, außer im Dienst, und nach allem, was passiert war, war damit ja nun kaum zu rechnen. Das Pflegeheim, in dem seine Mutter untergebracht war, hatte ihn jedoch gebeten, auch nachts erreichbar zu sein; es ging für die alte Frau möglicherweise auf das Ende zu.
Eine unbekannte Nummer. Er schaute auf die Seite des Telefons und sah resigniert, dass er vergessen hatte, es nach seinem Termin bei der HR-Chefin am Vortag wieder laut zu stellen. Er öffnete die Meldung.
Hallo, Henrik! Ich bin im Oslovelo. Meine Freunde sind zu einer Party weitergezogen, und ich hab keine Lust. Komm doch vorbei. Bin noch ne halbe Stunde hier. F.
Dem F folgten drei schäumende Biergläser und eine Flamencotänzerin. Die Nachricht war um 21:32 Uhr geschickt worden.
»Shit«, murmelte Henrik. »Shit, shit, shit.«
Er hätte gestern Abend ausgehen können. Durch die Kneipen ziehen. Mit Fridtjof, einem Freund. Einem echten Freund, den er vor einem halben Jahr in einem Lego-Forum im Internet kennengelernt hatte. Ein Mann, der ihn ernst nahm und ihn wie seinesgleichen behandelte. Kein illoyaler, mobbender Kollege, sondern ein echter Kumpel, der ganz aus freien Stücken, schon sechs Tage, nachdem die zweijährige drückende Pandemieherrschaft endlich zu Ende gegangen war, Kontakt zu Henrik aufgenommen hatte.
Um Bier zu trinken und Frauen anzugucken.
»Verdammt«, sagte Henrik und wurde rot.
Seine Daumen jagten über das Display.
Hallo, Fridtjof. Hab das gerade erst gesehen, leider. Aber wie wäre es heute? Oder morgen?
Schnell löschte er den letzten Vorschlag, morgen würde er zu Hanne und Nefis in der Kruses gate zum Essen gehen.
Oder Montag?, schrieb er stattdessen und fügte hinzu: Heute kann ich den ganzen Tag und Abend, und jeden Abend in der nächsten Woche und am Wochenende. Kino? Entscheide du. Jederzeit. Henrik.
Er zögerte einen Moment, streng genommen konnte er sich auch tagsüber mit anderen treffen. Sollte er aus »jeden Abend« »jeden Tag, den ganzen Tag« machen?
Nein. Das könnte vielleicht zu aufdringlich wirken. Stattdessen machte er aus Henrik ein H. Nach Fridtjofs Vorbild.
Dann drückte er auf Senden.
Danach stand er lange in Unterhose da und sah das Display an. Er wartete auf das Zeichen für »gelesen«, oder lieber noch auf die tanzenden Punkte, die anzeigten, dass eine Antwort unterwegs war. Nach zehn Minuten wurde ihm kalt, und ihm fiel ein, dass es noch immer erst Viertel vor sieben war. Jetzt würde sicher keine Antwort kommen.
Er war trotzdem viel besserer Laune, als er sich anzog, in die Küche wanderte, Kaffee aufsetzte und den Karton mit den Legosteinen holte, mit denen er nun überaus dringend weitermachen wollte.
Vielleicht würde er an diesem Abend auf die Piste gehen.
Mit einem Freund!
Sonntag, 27. Februar
»Was ist eigentlich mit euch beiden los?«
Hanne Wilhelmsen saß am Tischende. Sie ließ sich von Nefis einen großen Teller Bœuf bourguignon geben. Lächelnd schaute sie dann von ihrem Essen zu Ebba Braut und Henrik Holme auf, die einander gegenübersaßen.
»Seid ihr verkatert, oder was?«
Sie antworteten beide nicht. Henrik wurde rot. Beiden wurden gefüllte Teller in die Hände gedrückt, während Hanne sich Kartoffelpüree nahm.
»Du da!« Hanne nickte in Henriks Richtung. »Mitten in einer Pandemie, und du treibst dich offenbar in den Kneipen rum. Du solltest es eigentlich besser wissen. Setz dich bitte weiter hinten an den Tisch.«
Sie zeigte mit dem Messer auf das andere Tischende, vier Meter von sich entfernt.
»Lass den Quatsch«, sagte Nefis leise.
»Die Pandemie ist vorüber, Hammo!«
Ida, die achtzehn Jahre alte Tochter, nahm sich etwas, bei dem es sich um Nussbraten oder etwas ähnlich Ungenießbares handeln musste, und fügte hinzu: »Du kannst nicht für den Rest deines Lebens Rücksicht auf COVID-19 nehmen.«
»Doch, das kann ich. Und das habe ich auch vor.«
Ein Blick von Nefis veranlasste sie dennoch zu einer beschwichtigenden Geste in Richtung von Henrik, der kleinlaut dabei war, sich zu erheben.
»Setz dich. Aber nächstes Mal bringst du keinen solchen Kater mit. Geh am Abend vor unserem Sonntagsessen nicht in Kneipen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Die Behörden haben die Verbote aufgehoben, weil die Öffentlichkeit sie einfach nicht mehr aushält. Nicht, weil das Virus verschwunden ist.«
»Die Verbote wurden aufgehoben, weil alle geimpft sind«, sagte Nevis, in schärferem Tonfall als sonst bei ihr üblich, zumindest vor Gästen. »Und das sogar mehrmals. Dazu haben die allermeisten eine Runde mit dieser Krankheit hinter sich. Wir sind ausreichend geschützt, um das Land wieder zu öffnen.«
»Norwegen öffnet sich vor allem, weil die Leute einfach nicht mehr wollen«, erklärte Hanne. »Aber ich will. My house, my rules.«
»Streng genommen ist das ja wohl auch Mamas Haus«, sagte Ida.
Streng genommen ist es sogar nur das Haus von Nefis, dachte Hanne, sagte aber nichts. Nefis schwieg ebenfalls. Eine schräge, dünne Falte zwischen ihren Augenbrauen hinderte Hanne jedoch nicht daran, Henrik anzusehen und zu fragen: »Mit wem warst du denn nun unterwegs? Hast du dir neuerdings Freunde zugelegt, oder was?«
Sie lachte kurz auf und schob sich ein Stück Fleisch in den Mund.
»Mmm. Köstlich, Nefis. Wie immer. Du bist die beste Köchin auf der Welt. Die Beste von einfach allem.«
Henrik starrte seinen Teller an. Er hatte noch nicht zu seinem Besteck gegriffen. Es blieb jetzt viel zu lange still.
»Bei diesen Sonntagsessen geht es darum, dass wir es nett miteinander haben«, sagte Hanne, auch sie war jetzt leicht irritiert. »Nicht darum, dass die Gäste das Essen anstarren, als ob es vergiftet wäre. Es besteht aller Grund dazu, wegen Russlands Überfall auf die Ukraine niedergeschlagen zu sein, aber für den Moment können wir wohl an etwas anderes denken. Na los, Leute. Nefis hat zwei Tage für dieses Gericht gebraucht. Esst!«
Sie spießte mit der Gabel eine Perlzwiebel auf. Die glänzte in der dunklen, blanken und gerade richtig sämigen Soße.
Henrik wischte sich rasch den Mund, dann griff er zu seinem Wasserglas und trank.
»Also, ich kann da ja zustimmen«, sagte nun Hanne, betrachtete die Zwiebel, ließ sie fallen und nahm sich einen Champignon, der durch den eingekochten Rotwein glänzte und fast schwarz war. »Jeder Bestandteil für sich sieht vielleicht nicht so appetitlich aus? Aber der Geschmack? Der Eintopf als Ganzes …«
Sie schmatzte zufrieden.
»Und du«, sagte sie mit vollem Mund und sah dabei Ebba an. »Du scheinst ja auch nicht so ganz in Form zu sein. Was fehlt dir denn? Bist du schwanger, oder was?«
Sie lachte und nickte in Richtung des Rotweinglases, das Ebba sehr untypisch mit der Hand bedeckt hatte, als ihr Wein angeboten worden war.
»Hör auf«, sagte Nefis. »Iss.«
»Ich esse! Esse und trinke! Aber da bin ich wohl die Einzige. Ich bitte ja nur um Auskunft darüber, was unsere übellaunigen Gäste daran hindert, bei diesem fantastischen, köstlichen …«
»Manchmal bist du ganz einfach unerträglich«, sagte Ebba, die ihr Essen noch immer nicht angerührt hatte. »Ich glaube, ich gehe.«
»Was?«
»Kannst du nicht einfach aufhören?«, fragte Ida bittend und sank auf ihrem Stuhl in sich zusammen. »Mach doch nicht alles kaputt!«
»Ich?«
Hanne legte ihr Besteck beiseite und hob die Hände.
»Ich bin es doch nicht, die hier Schwierigkeiten macht!«
Ebba erhob sich. Der Stuhl schrappte über den Boden. Henrik folgte plötzlich ihrem Beispiel. Sein Stuhl kippte um.
»Bitte«, sagte Nefis so leise, dass es fast nicht zu hören war.
»Du kannst gern gehen«, sagte Hanne gelassen und sah Henrik an. »Jederzeit, eigentlich. Aber du, Ebba! Warum bist du plötzlich so verdammt sauer? Ich hab doch nichts gesagt, was auf irgendeine Weise …«
Hanne riss sich zusammen. In Nefis’ Blick lag etwas, das sie nicht richtig deuten konnte. In ihr verkrampfte sich alles; sie schluckte und fragte kleinlaut: »Was ist hier eigentlich los?«
Ida stand ebenfalls auf.
»Hammo, du bist … du bist …«
Der Rest verschwand in etwas, das sich gewaltig nach einem Knurren anhörte.
»Tut mir leid«, rutschte es Hanne heraus. »Jetzt setzt euch doch, Leute. Ich verstehe ja, dass ich irgendetwas Unpassendes gesagt habe. Wir ziehen einen Strich darunter, ja? Und erweisen dieser wunderbaren Mahlzeit unsere Ehre.«
Ebba beugte sich vor und stemmte ihre Handflächen um den Teller. Ihr Gesicht kam Hannes so nah, dass die den schwachen Geruch des Traubensaftes wahrnehmen konnte, den Ebba anstelle von Wein trank.
»Ich verstehe, dass es schwer für dich ist, dass die Pandemie ein Ende hat«, sagte sie leise. »Aber so darfst du dich einfach nicht aufführen.«
»Wie … aber ich …«
»Natürlich können wir einen Strich darunter ziehen«, fuhr Ebba fort. »Irgendwann einmal. Aber im Moment kann ich das einfach nicht. Heute bin ich auch nicht nur hergekommen, um es ›nett zu haben‹.«
Sie hob die Hände und malte Anführungszeichen in die Luft, ohne sich aufzurichten. Ihre Augen waren jetzt eisblau.
»Ich wollte mit vier meiner wichtigsten Menschen ein Geheimnis teilen. Ein beängstigendes Geheimnis, das mich total verwirrt und ziemlich verzweifelt macht und bei dem ich Hilfe brauche, um ihm auf den Grund zu kommen. Aber das muss auf ein anderes Mal verschoben werden.«
»Henrik ist doch wohl keiner von deinen wichtigsten Menschen«, sagte Hanne. »Genau betrachtet?«
Ebba ließ abrupt den Kopf sinken.
»Du I-di-o-tin!«, stöhnte sie und betonte dabei jede einzelne Silbe, dann richtete sie sich auf und ließ ihren Blick von Ida zu Nefis wandern.
»Das hier tut mir wirklich leid«, sagte sie. »Tausend Dank für die Einladung und das sicher wunderbare Essen. Ich bin nur nicht ganz in Form. Bis dann.«
Sie ging zur Tür. Ida versteckte ihr Gesicht in ihrer Serviette. Nefis saß vollkommen ausdruckslos da und legte die Hände in den Schoß. Henrik ging hinter Ebba her zur Diele. Auf halber Strecke hielt er inne und lief zurück.
»Entschuldige, dass ich ein bisschen verkatert bin«, sagte er zu Hanne und blieb einen Moment lang dicht neben dem Rollstuhl stehen. »Aber ich hatte gestern wirklich einen sehr netten Abend. Ich hab einen neuen Freund!«
Es sah ein bisschen aus, als ob er sie umarmen wolle.
Hanne hob abwehrend die Hände.
»Geh doch einfach«, sagte sie mürrisch und aß weiter.
***