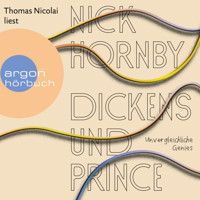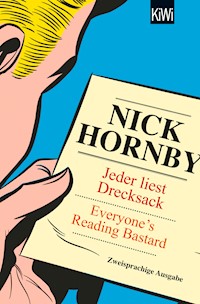9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nick Hornbys erfolgreichster Roman Kinder sind so ungefähr das letzte, was sich Will Freeman, 36 Jahre alt und überzeugter Single, wünscht. Er lebt gut und faul von den Tantiemen eines Weihnachtslieds, das sein Vater 1938 komponiert hat. Seine Tage verbringt er mit Nichtstun, und an den Abenden bemüht er sich zur Zerstreuung um junge, alleinerziehende, gutaussehende Mütter.Marcus hat mit seinen zwölf Jahren ganz andere Probleme. Seine Eltern sind getrennt, und seine Mutter hat die beängstigende Neigung, ständig in Tränen auszubrechen. In der Schule ist Marcus nicht zuletzt wegen seiner Kleidung, seines Haarschnitts und seines Musikgeschmacks ein Außenseiter. Zum Glück bringt ihn das Schicksal mit Will zusammen. Und was das Schicksal einem schenkt, das lässt man so schnell nicht wieder los…Nick Hornbys erfolgreichster Roman wurde verfilmt mit Hugh Grant, Toni Colette und Rachel Weisz. Der Film wurde – wie das Buch – ein riesiger Erfolg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Ähnliche
Nick Hornby
About a Boy
Roman
Aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Nick Hornby
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Mein besonders herzlicher Dank an David Evans, Adrienne Maguire, Caroline Dawnay, Virginia Bovell, Abigail Morris, Wendy Carlton, Harry Ritchie und Amanda Posey.
Die Musik wurde von Wood in Upper Street, London N 1, zur Verfügung gestellt.
Liz Knights zur Erinnerung
1
»Und, habt ihr euch getrennt?«
»Machst du Witze?«
Die Leute glaubten oft, Marcus mache Witze, obwohl das nicht der Fall war. Er begriff das nie. Seine Mutter zu fragen, ob sie sich von Roger getrennt habe, fand er vollkommen vernünftig: Die beiden hatten gerade einen Riesenkrach gehabt, dann waren sie rüber in die Küche gegangen, um leise zu reden, und nach einer kleinen Weile kamen sie mit ernsten Gesichtern wieder heraus, Roger hatte ihm die Hand gereicht, ihm viel Glück in seiner neuen Schule gewünscht, und dann war er gegangen.
»Warum sollte ich Witze machen?«
»Was meinst du, wonach sieht’s denn aus?«
»Für mich sieht es so aus, als hättet ihr euch getrennt. Ich wollte es nur genau wissen.«
»Wir haben uns getrennt.«
»Also ist er weg?«
»Ja, er ist weg.«
Er konnte sich nicht vorstellen, sich je an diese Geschichten zu gewöhnen. Er hatte Roger ganz gern gemocht, und sie hatten öfter etwas zu dritt unternommen; jetzt würde er ihn offenbar nie wiedersehen. Es machte ihm nichts, aber seltsam war es schon, wenn man darüber nachdachte. Er war mal mit Roger zusammen auf dem Klo gewesen, als sie beide nach einem Ausflug mit dem Auto ganz dringend mussten. Man sollte doch meinen, wenn man mit jemand schon mal gepinkelt hatte, müsste man irgendwie in Verbindung bleiben.
»Was ist mit seiner Pizza?« Sie hatten gerade drei Pizzas bestellt, als der Streit losging.
»Wir teilen sie uns. Wenn wir noch Hunger haben.« »Es sind aber große. Und hat er nicht eine mit Salami bestellt?« Marcus und seine Mutter waren Vegetarier. Roger nicht.
»Dann schmeißen wir sie halt weg«, sagte sie.
»Wir könnten auch die Salami abmachen. Ich glaube, sie tun sowieso nicht viel drauf. Hauptsächlich Käse und Tomaten.«
»Marcus, für die Pizzas habe ich jetzt wirklich keinen Kopf.«
»Okay. Tut mir leid. Warum habt ihr euch getrennt?«
»Oh … alles Mögliche. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das erklären soll.«
Es überraschte Marcus nicht, dass sie nicht erklären konnte, was vorgefallen war. Er hatte mehr oder weniger den ganzen Streit gehört und kein Wort davon verstanden; irgendwo schien da ein Stück zu fehlen. Wenn Marcus und seine Mutter stritten, hörte man alles Wichtige heraus: zu viel, zu teuer, zu jung, schlecht für deine Zähne, anderes Programm, Hausaufgaben, Obst. Wenn seine Mutter aber mit ihren Freunden stritt, konnte man stundenlang zuhören und trotzdem das Wesentliche nicht mitbekommen, den Obst- und Hausaufgabenteil. Es war so, als würden sie auf Kommando streiten und das Erstbeste sagen, was ihnen einfiel.
»Hatte er eine Freundin?«
»Ich glaube nicht.«
»Hast du einen anderen Freund?«
Sie lachte. »Wen denn zum Beispiel? Den Kerl, der die Pizzabestellung angenommen hat? Nein, Marcus, ich habe keinen anderen Freund. So läuft das nicht. Nicht bei einer siebenunddreißigjährigen berufstätigen Mutter. Da gibt es ein kleines Zeitproblem. Ha! Da gibt es mit allem ein kleines Problem. Warum? Findest du es schlimm?«
»Weiß nich.«
Er wusste es wirklich nicht. Seine Mutter war traurig, das wusste er – sie weinte jetzt viel, mehr als sie geweint hatte, ehe sie nach London gezogen waren –, aber er hatte keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwas mit Männern zu tun hatte. Irgendwie hoffte er das, denn dann würde alles gut werden. Sie würde jemanden kennenlernen, und der würde sie glücklich machen. Wieso auch nicht? Seine Mutter war hübsch, fand er, und nett, und manchmal lustig, und er stellte sich vor, dass jede Menge Typen wie Roger rumlaufen mussten. Doch wenn es nicht die Männer waren, wusste er nicht, was es sein könnte, außer etwas ganz Schlimmes.
»Stört es dich, wenn ich Freunde habe?«
»Nein. Nur bei Andrew.«
»Na ja, ich weiß, du konntest Andrew nicht leiden. Aber im Allgemeinen? Grundsätzlich hast du nichts dagegen?«
»Nein. Natürlich nicht.«
»Du warst wirklich immer sehr tapfer. Wenn man bedenkt, dass du zwei ganz verschiedene Leben geführt hast.«
Er verstand, was sie meinte. Das erste Leben war vor vier Jahren zu Ende gegangen, als er acht war und seine Mutter und sein Vater sich getrennt hatten; das war ein normales, langweiliges gewesen, mit Schule und Ferien und Hausaufgaben und Wochenendbesuchen bei den Großeltern. Das zweite Leben war chaotischer, und es gab darin mehr Menschen und Schauplätze: die Freunde seiner Mutter und die Freundinnen seines Vaters, Wohnungen und Häuser, Cambridge und London. Kaum zu glauben, dass sich so viel ändern konnte, nur weil eine Beziehung zerbrach, aber ihm machte das nichts aus. Manchmal dachte er sogar, dass er das zweite Leben dem ersten vorzog. Es war mehr los, und das konnte ja nur gut sein.
Abgesehen von Roger war in London bis jetzt nicht viel los gewesen. Sie wohnten erst seit ein paar Wochen hier – sie waren am ersten Tag der Sommerferien umgezogen –, und bis jetzt war es ganz schön langweilig. Zweimal war er mit seiner Mutter im Kino, einmal in Kevin allein in New York, der nicht so gut war wie Kevin allein zu Haus, und einmal in Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, der nicht so gut war wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, und seine Mutter hatte gesagt, die modernen Filme seien viel zu kommerziell, und dass, als sie in seinem Alter war … irgendwas gewesen war, was ihm nicht mehr einfiel. Sie hatten sich auch seine neue Schule angesehen, die groß und scheußlich war, wanderten in ihrem neuen Wohnviertel herum, das Holloway hieß und schöne und hässliche Ecken hatte, und sie hatten sich oft und lange über London unterhalten und über die vielen Veränderungen in ihrem Leben, die – wahrscheinlich – nur zu ihrem Besten waren. Aber eigentlich saßen sie herum und warteten darauf, dass ihr Leben in London begann.
Die Pizzas kamen, und sie aßen sie direkt aus den Kartons. »Die sind besser als die in Cambridge, oder?«, sagte Marcus gut gelaunt. Das stimmte nicht: Sie kamen von derselben Pizzafirma, und in Cambridge hatten die Pizzas keinen so weiten Weg und waren deshalb nicht ganz so matschig. Er fand einfach nur, er müsste etwas Optimistisches sagen. »Sollen wir fernsehen?«
»Wenn du willst.«
Er fand die Fernbedienung hinter den Sofakissen und zappte durch die Programme. Er wollte keine der Soaps sehen, weil es in Soaps nur Probleme gab, und er fürchtete, die Probleme in den Soaps würden seine Mutter an ihre eigenen Probleme erinnern. Also sahen sie sich eine Tiersendung über so eine Art Fisch an, der am Grund einer Höhle lebte und nichts sehen konnte, einen Fisch, von dem man nicht wusste, was er eigentlich sollte; er glaubte nicht, dass der seine Mutter an irgendetwas erinnern würde.
2
Wie cool war Will Freeman? So cool: Er hatte in den letzten drei Monaten mit einer Frau geschlafen, die er nicht besonders gut kannte (fünf Punkte). Er hatte über dreihundert Pfund für ein Jackett ausgegeben (fünf Punkte). Er hatte über zwanzig Pfund für einen Haarschnitt ausgegeben (fünf Punkte). (Wie war es möglich, 1993 weniger als zwanzig Pfund für einen Haarschnitt auszugeben?) Er besaß mehr als fünf HipHop-Alben (fünf Punkte). Er hatte Ecstasy genommen (fünf Punkte), und zwar in einem Club, nicht bloß zu Hause als eine Art soziologisches Experiment (fünf Punkte). Er hatte vor, bei der nächsten Wahl Labour zu wählen (fünf Punkte). Er verdiente über vierzigtausend Pfund im Jahr (fünf Punkte), und er musste nicht besonders hart dafür arbeiten (fünf Punkte, und dann schrieb er sich noch fünf Extrapunkte dafür gut, dass er überhaupt nicht dafür arbeiten musste). Er war in einem Restaurant gewesen, in dem es Polenta mit gehobeltem Parmesan gab (fünf Punkte). Er hatte niemals ein Kondom mit Geschmack benutzt (fünf Punkte), er hatte seine Bruce-Springsteen-LPs verkauft (fünf Punkte), und er hatte sich a) einen Kinnbart wachsen lassen (fünf Punkte) und ihn b) wieder abrasiert (fünf Punkte). Abzüge gab es dafür, dass er nie Sex mit irgendwem gehabt hatte, dessen Foto im Mode- und Gesellschaftsteil einer Zeitung oder Zeitschrift erschienen war (minus zwei), und dass er, wenn er ehrlich war (und wenn Will überhaupt einen ethischen Grundsatz hatte, dann den, dass es eine Todsünde war, bei Psychotests in Zeitschriften zu schummeln), immer noch glaubte, dass man bei Frauen besser ankam, wenn man ein schnelles Auto hatte. Aber auch so kam er noch auf … Sechsundsechzig! Dem Test zufolge war er damit unter null! Er war Trockeneis! Er war Frosty der Schneemann! Er würde an Unterkühlung sterben! Will wusste nicht, wie ernst man solche Psychotests nehmen durfte, aber er konnte es sich nicht leisten, darüber nachzudenken; Männermagazin-cool zu sein war, falls man das so nennen wollte, sein erstes und einziges Verdienst, und Momente wie diesen musste man auskosten. Unter null! Viel cooler als unter null ging es nicht mehr! Er schlug die Zeitschrift zu und legte sie auf einen Stapel ähnlicher Magazine, den er im Badezimmer liegen hatte. Er hob nicht alle auf, weil er zu viele davon kaufte, aber von dieser würde er sich nicht so schnell trennen.
Will fragte sich manchmal – nicht sehr oft, weil er sich nicht oft historischen Spekulationen hingab –, wie Typen wie er wohl vor sechzig Jahren überlebt hatten. (»Typen wie er« war, wie er wusste, ein ziemlich exklusiver Personenkreis; man konnte auch sagen, vor sechzig Jahren hätte es jemanden wie ihn nicht geben können, denn vor sechzig Jahren konnte niemand einen Vater haben, der auf vergleichbare Weise sein Geld verdiente. Wenn er also an Typen wie sich dachte, meinte er nicht Typen ganz genau wie sich, er meinte einfach Typen, die den ganzen Tag im Grunde nichts machten und auch nicht viel machen wollten.) Vor sechzig Jahren gab es noch nichts von all dem, worauf Will täglich angewiesen war: tagsüber nichts im Fernsehen, keine Videos, keine Hochglanzmagazine und daher auch keine Psychotests, und obwohl es wahrscheinlich Plattenläden gab, war die Art von Musik, die er hörte, noch nicht erfunden. (Momentan hörte er Nirvana und Snoop Doggy Dogg, und 1933 hätte man wohl nicht viel gefunden, was sich so anhörte.) Blieben also Bücher. Bücher! Er hätte sich fast sicher einen Job suchen müssen, weil er sonst an die Decke gegangen wäre.
Heute dagegen war es einfach. Es gab beinahe zu viel zu tun. Man musste heute kein eigenes Leben mehr führen; man konnte einfach Zaungast im Leben anderer Menschen sein, das in den Zeitungen, in Eastenders, in Spielfilmen und erlesen traurigen Jazz-Songs oder knallharten Rap-Songs gelebt wurde. Der zwanzigjährige Will wäre überrascht und vielleicht enttäuscht gewesen, wenn er gewusst hätte, dass er sechsunddreißig Jahre alt werden würde, ohne sich ein eigenes Leben aufzubauen, aber der sechsunddreißigjährige Will war nicht besonders unglücklich darüber: Auf diese Art gab es weniger Durcheinander.
Durcheinander! Davon gab es im Haus von Wills Freund John mehr als genug. John und Christine hatten zwei Kinder – das zweite war letzte Woche zur Welt gekommen, und Will war hinzitiert worden, um es sich anzusehen –, und ihre Wohnung war, Will fand kein treffenderes Wort, ein Schandfleck. Leuchtend bunte Plastikteile überall auf dem Boden, Videobänder lagen ohne ihre Hüllen neben dem Fernseher, und der weiße Überwurf auf dem Sofa sah aus, als sei er als überdimensionales Klopapier missbraucht worden, auch wenn sich Will lieber einredete, die Flecken seien Schokolade … Wie konnten Menschen so leben?
Christine kam mit dem Baby auf dem Arm herein, während John in der Küche eine Tasse Tee für ihn machte. »Das ist Imogen«, sagte sie.
»Oh«, sagte Will. »Natürlich.« Was sollte er als Nächstes sagen? Er wusste, sie warteten auf etwas, aber er konnte sich ums Verrecken nicht daran erinnern, was er sagen sollte. »Sie ist …« Nein. Es war weg. Er konzentrierte seine Konversationsbemühungen auf Christine. »Und wie geht’s dir so, Chris?«
»Ach, du weißt schon. Ein bisschen ausgelaugt.«
»Schwer über die Stränge geschlagen?«
»Nein. Nur ein Baby zur Welt gebracht.«
»Oh. Stimmt ja.« Alles lief wieder auf das Drecksbaby hinaus.
»Das kann einen ganz schön müde machen, schätze ich.« Er hatte bewusst eine Woche gewartet, um nicht über solche Dinge sprechen zu müssen, aber es hatte ihm nichts genützt. Sie redeten trotzdem darüber.
John kam mit einem Tablett und drei Bechern Tee herein. »Barney ist heute bei seiner Großmutter«, sagte er, ohne dass Will einen Grund dafür sehen konnte.
»Wie geht es Barney?« Barney war zwei, so ging es Barney, und darum war er für niemanden außer für seine Eltern interessant, doch auch hier schien man aus unerfindlichen Gründen eine Bemerkung von ihm zu erwarten.
»Es geht ihm prächtig, danke«, sagte John. »Natürlich ist er im Moment ein richtiger Satansbraten, und er weiß nicht genau, was er von Imogen halten soll, aber … er ist süß.«
Will hatte Barney kennengelernt und wusste mit Sicherheit, dass Barney nicht süß war, also beschloss er, diese absurde Feststellung zu ignorieren.
»Und wie geht es dir, Will?«
»Mir geht es gut, danke.«
»Immer noch keine Sehnsucht nach einer eigenen Familie?«
Lieber würde ich eine von Barneys verschissenen Windeln essen, dachte er. »Noch nicht«, sagte er.
»Du machst uns Sorgen«, sagte Christine.
»Ich fühle mich ganz wohl so, danke.«
»Das mag ja sein«, sagte Christine selbstgefällig. Die beiden machten ihn langsam körperlich krank. Es war schlimm genug, dass sie überhaupt Kinder hatten; warum hatten sie den Wunsch, diesen ersten Fehler zu verschlimmern, indem sie ihre Freunde anspornten, ihrem Beispiel zu folgen? Will war seit einigen Jahren überzeugt, dass man sein Leben leben konnte, ohne sich so ins Unglück zu stürzen wie John und Christine (und er war sicher, dass sie unglücklich waren, auch wenn sie in einen unheimlichen, indoktrinierten Zustand geraten waren, der sie für ihr eigenes Elend blind machte). Man brauchte Geld, sicher – das Einzige, was dafür sprach, Kinder zu bekommen, war, dass sie für einen sorgen konnten, wenn man alt, zu nichts mehr zu gebrauchen und pleite war –, aber er hatte Geld, und das bedeutete, dass er dem Durcheinander, den Klopapier-Sofadecken und der Zwangsidee, Freunden einzureden, sie müssten sich ebenfalls ins Unglück stürzen, aus dem Weg gehen konnte.
John und Christine waren mal ganz nett gewesen. Als Will noch mit Jessica zusammen war, waren sie ein paarmal die Woche zu viert durch die Clubs gezogen. Jessica und Will hatten sich getrennt, als Jessica das frivole Lotterleben gegen etwas Solideres eintauschen wollte; Will hatte sie vermisst, vorübergehend, das Nachtleben hätte er allerdings mehr vermisst. (Sie trafen sich noch ab und zu mittags auf eine Pizza, und dann zeigte sie ihm Bilder von ihren Kindern und sagte ihm, er würde sein Leben verschwenden und wüsste gar nicht, was er verpasste, worauf er zu ihr sagte, darauf könne er gut verzichten, und dann sagte sie zu ihm, das würde ihn ohnehin überfordern, worauf er zu ihr sagte, er habe nicht vor, je herauszufinden, ob dem so sei oder nicht; danach saßen sie dann schweigend da und tauschten böse Blicke.) Jetzt, wo John und Christine Jessicas Weg in eine bessere Welt gegangen waren, hatte er keinerlei Verwendung mehr für sie. Er wollte weder Imogen sehen noch wissen, wie es Barney ging, er wollte nichts über Christines Müdigkeit hören, und mehr hatten sie mittlerweile nicht mehr zu bieten. Mit denen würde er sich nicht mehr abgeben, besten Dank.
»Wir haben uns gefragt«, sagte John, »ob du wohl Imogens Patenonkel werden möchtest?« Die beiden saßen mit so erwartungsfrohem Lächeln da, als müsse er im nächsten Moment aufspringen, in Tränen ausbrechen und sich trunken vor Glück eng umschlungen mit ihnen auf dem Teppichboden wälzen. Will lachte nervös auf.
»Patenonkel? Kirche und so? Geburtstagsgeschenke? Adoption, falls ihr bei einem Flugzeugabsturz umkommt?«
»Genau.«
»Ihr nehmt mich auf den Arm.«
»Wir glauben, dass du verborgene Tiefen hast«, sagte John.
»Ah, aber die habe ich nicht. Ich bin wirklich so oberflächlich.«
Sie lächelten immer noch. Sie schnallten es nicht.
»Hört mal. Ich bin wirklich gerührt, dass ihr gefragt habt. Aber ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Im Ernst. Das ist einfach nicht mein Ding.«
Viel länger blieb er dann nicht mehr.
Ein paar Wochen später lernte Will Angie kennen und wurde zum ersten Mal Stiefvater auf Zeit.Vielleicht hätte er sich sehr viel Ärger erspart, wenn er seinen Stolz, seinen Abscheu vor Kindern, Familie, Häuslichkeit, Monogamie und früh ins Bett gehen heruntergeschluckt hätte.
3
In der Nacht nach seinem ersten Schultag wachte Marcus ungefähr jede halbe Stunde auf. Er sah es an den Leuchtzeigern seines Dinosaurierweckers: 22.41, 23.19, 23.55, 0.35, 0.55, 1.31 … Er konnte nicht glauben, dass er am nächsten Morgen wieder hingehen musste, und am übernächsten Morgen, und am überübernächsten Morgen, und … na ja, dann wäre Wochenende, aber mehr oder weniger jeden Morgen für den Rest seines Lebens, so ziemlich. Jedes Mal, wenn er aufwachte, war sein erster Gedanke, an diesem entsetzlichen Gefühl müsse doch irgendein Weg vorbeiführen – oder darum herum oder sogar mittendurch; wenn er früher einmal Probleme hatte, fand sich normalerweise immer irgendeine Lösung – meistens bestand sie darin, dass er seiner Mutter erzählte, was ihn quälte. Aber diesmal konnte sie nicht das Geringste machen. Sie würde ihn nicht die Schule wechseln lassen, und selbst wenn, würde es keinen großen Unterschied machen. Er würde immer noch der sein, der er war, und das schien ihm das eigentliche Problem zu sein.
Er war für die Schule einfach nicht geschaffen. Nicht für die weiterführende Schule jedenfalls. Das war es. Und wie sollte er das irgendwem erklären? Es war okay, für einige Dinge nicht geschaffen zu sein (er wusste bereits, dass er für Partys nicht geschaffen war, weil er zu schüchtern war, oder für Schlabberhosen, weil seine Beine zu kurz waren), aber nicht für die Schule geschaffen zu sein, war ein Problem. Alle gingen zur Schule. Daran führte kein Weg vorbei. Einige Kinder, das wusste er, wurden von ihren Eltern zu Hause unterrichtet, aber seine Mutter konnte das nicht, weil sie arbeiten ging. Außer, er bezahlte sie, um ihn zu unterrichten – aber sie hatte ihm vor langer Zeit erzählt, dass sie in ihrem Job dreihundertundfünfzig Pfund pro Woche verdiente. Dreihundertfünfzig Pfund pro Woche! Wie sollte er an so viel Geld kommen? Nicht mit Zeitungsaustragen, so viel war klar. Es gab auch noch andere Kinder, die nicht zur Schule gingen, und das waren die Macaulay Culkins. Über den hatten sie mal was im Samstagvormittagsprogramm gebracht, und es hieß, er würde in einer Art Campingwagen von einem Privatlehrer unterrichtet. Das klang ganz okay, fand er. Mehr als okay, weil Macaulay Culkin wahrscheinlich dreihundertfünfzig Pfund in der Woche verdiente, vielleicht sogar mehr, was bedeutete, wenn er Macaulay Culkin wäre, könnte er seine Mutter dafür bezahlen, dass sie ihn unterrichtete. Aber wenn Macaulay Culkin sein bedeutete, gut schauspielern zu können, konnte er es vergessen: Er war im Schauspielern beschissen, weil er es hasste, sich vor anderen zu produzieren. Darum hasste er ja die Schule. Darum wollte er ja Macaulay Culkin sein. Darum würde er nicht in tausend Jahren, geschweige denn in den nächsten paar Tagen, Macaulay Culkin werden. Er würde morgen zur Schule gehen müssen.
Die ganze Nacht lang flogen seine Gedanken herum wie Bumerangs: Eine Idee schoss in die Ferne, den ganzen weiten Weg bis zu den Campingwagen in Hollywood, und für einen Moment, wenn er so weit wie nur möglich entfernt war von Schule und Realität, war er halbwegs glücklich; dann trat der Gedanke den Rückflug an, knallte ihm an den Kopf, und er war wieder genau dort, wo er angefangen hatte. Und die ganze Zeit kam der Morgen näher.
Beim Frühstück war er schweigsam. »Du wirst dich daran gewöhnen«, sagte seine Mutter, als er seine Frühstücksflocken aß, wahrscheinlich, weil er so elend aussah. Er nickte nur und lächelte sie an; da war schon was dran. Es hatte Zeiten gegeben, in denen er irgendwo ganz tief drin wusste, dass er sich an was auch immer gewöhnen würde, weil er gelernt hatte, dass viele schwere Dinge nach kurzer Zeit von selber leichter wurden. Am Tag, nachdem sein Vater ausgezogen war, war seine Mutter mit ihm und ihrer Freundin Corinne nach Glastonbury gefahren, und sie hatten eine herrliche Zeit im Zelt verbracht. Aber das hier würde nur noch schlimmer werden. Besser als dieser entsetzliche, grauenerregende, furchteinflößende erste Tag würde es nicht werden.
Er kam früh zur Schule, ging in den Klassenraum, setzte sich an sein Pult. Dort war er relativ sicher. Die Kinder, die ihn gestern blöd angemacht hatten, gehörten wahrscheinlich nicht zu denen, die es eilig hatten, zur Schule zu kommen; die würden irgendwo rauchen und Drogen nehmen und Leute vergewaltigen, dachte er düster. Es waren ein paar Mädchen im Raum, aber sie ignorierten ihn, falls nicht das prustende Gelächter, das er hörte, als er sein Lesebuch herausholte, etwas mit ihm zu tun hatte.
Was gab es da zu lachen? Eigentlich nichts, außer man gehörte zu den Menschen, die permanent auf etwas lauerten, worüber sie lachen konnten. Unglücklicherweise waren das seiner Erfahrung nach genau die Menschen, zu denen die meisten Kinder zählten. Sie patrouillierten wie Haie auf den Korridoren, nur lauerten sie nicht auf Menschenfleisch, sondern auf die falsche Hose, den falschen Haarschnitt oder die falschen Turnschuhe, was jedes für sich oder alles zusammen genommen ekstatische Begeisterung auslöste. Da er normalerweise die falschen Turnschuhe oder die falsche Hose trug und sein Haarschnitt immer falsch war, an jedem Tag der Woche, musste er sich nicht sehr anstrengen, damit sie sich über ihn totlachten.
Marcus wusste, dass er sonderbar war, und er wusste auch, dass er zum Teil deshalb sonderbar war, weil seine Mutter so sonderbar war. Sie kapierte einfach nicht, nichts davon. Sie predigte ihm immer wieder, nur oberflächliche Menschen ließen sich in ihrem Urteil von Kleidung oder vom Haarschnitt beeinflussen; sie wollte nicht, dass er sich Schrottsendungen im Fernsehen ansah oder Schrottmusik hörte oder Schrottcomputerspiele spielte (für sie waren sie alle Schrott), und das hieß für ihn, dass er stundenlang mit ihr diskutieren musste, falls er irgendwas machen wollte, womit alle anderen Kinder sich dauernd beschäftigten. Normalerweise musste er sich geschlagen geben, und sie war so gut im Diskutieren, dass er sich gerne geschlagen gab: Sie konnte erklären, warum es besser war, Joni Mitchell und Bob Marley (zufällig ihre beiden Lieblingssänger) als Snoop Doggy Dogg zu hören, und warum es wichtiger war, Bücher zu lesen, als auf dem Gameboy zu spielen, den sein Vater ihm geschenkt hatte. Aber nichts davon konnte er den Kindern in der Schule vermitteln. Wenn er versuchen würde, Lee Hartley – der größte, lauteste und fieseste von allen, die er gestern getroffen hatte – begreiflich zu machen, er hielte nichts von Snoop Doggy Dogg, weil Snoop Doggy Dogg die falsche Einstellung zu Frauen habe, würde Lee Hartley ihn schlagen oder ihm gemeine Sachen sagen, die er nicht hören wollte. In Cambridge war es weniger schlimm gewesen, denn da hatte es jede Menge Kinder gegeben, die nicht für die Schule geschaffen waren, und jede Menge Mütter, die sie so gemacht hatten, aber in London war das anders. Die Kinder waren härter und gemeiner und verständnisloser, und er fand, wenn seine Mutter schon wollte, dass er die Schule wechselte, nur weil sie einen besseren Job gefunden hatte, dann sollte sie wenigstens so anständig sein, mit diesem Du-da-müssen-wir-darüber-reden-Kram aufzuhören.
Er war zu Hause ganz glücklich, Joni Mitchell zu hören und Bücher zu lesen, aber in der Schule nutzte ihm das wenig. Das war seltsam, denn die meisten Menschen hätten wohl das Gegenteil vermutet – dass viele Bücher lesen helfen müsste –, aber das tat es nicht: Es machte ihn anders, und weil er anders war, fühlte er sich nicht wohl, und weil er sich nicht wohlfühlte, konnte er spüren, wie er sich von allen und allem abkapselte, den Kindern, den Lehrern und dem Unterricht.
Nicht an allem war seine Mutter schuld. Manchmal lag es eher an ihm selbst als an ihr, dass er so sonderbar war. Wie das Singen … Wann würde er das mit dem Singen lernen? Ihm ging ständig irgendeine Melodie durch den Kopf, aber ab und zu, wenn er nervös war, rutschte ihm diese Melodie irgendwie raus. Aus irgendeinem Grund konnte er den Unterschied zwischen Innen und Außen nicht erkennen, weil da kein Unterschied zu bestehen schien. Es war, als ginge man an einem warmen Tag in einem beheizten Pool schwimmen, da konnte man auch aus dem Wasser steigen, ohne den Unterschied zu merken, weil die Temperatur gleich blieb; das schien auch beim Singen zu passieren. Na, jedenfalls gestern war ihm in der Englischstunde ein Lied rausgerutscht, während die Lehrerin vorlas; wenn man unbedingt ausgelacht, so richtig schallend ausgelacht werden wollte, gab es anscheinend nichts Besseres, als laut loszusingen, während der Rest der Klasse sich schweigend langweilte. Das übertraf sogar einen miesen Haarschnitt.
An diesem Morgen ging bis zur ersten Stunde nach der Pause alles gut. Während der Anwesenheitskontrolle war er still, er ging auf dem Flur allen anderen aus dem Weg, und dann kam eine Doppelstunde Mathe, das machte er gerne und darin war er gut, obwohl sie Sachen durchnahmen, die er schon gehabt hatte. In der Pause ging er zu Mr Brooks, einem der anderen Mathelehrer, um sich für dessen Computer-AG zu melden. Er war stolz auf diese Tat, instinktiv wäre er lieber im Klassenzimmer geblieben und hätte gelesen, aber er hatte nicht gekniffen; er war sogar quer über den Schulhof gegangen. Aber in Englisch wurde es wieder schlimm. Sie arbeiteten mit einem dieser Bücher, in denen von allem etwas stand; die Stelle, die sie durchnahmen, war aus Einer flog übers Kuckucksnest. Er kannte die Geschichte, weil er den Film mit seiner Mutter gesehen hatte, also sah er ganz klar, so klar, dass er am liebsten aus der Klasse gerannt wäre, was kommen würde. Als es kam, wurde es sogar noch schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Ms Maguire ließ eins der Mädchen, von dem sie wusste, dass es gut vorlesen konnte, den Abschnitt vorlesen (Marcus war gut im Vorlesen, aber weil er neu war, fragte man ihn gar nicht erst), und dann versuchte sie, eine Diskussion in Gang zu bringen.
»Schön, eins der Dinge, um die es in diesem Buch geht, ist … Wie wissen wir, wer verrückt ist und wer nicht? Denn, wisst ihr, wir sind alle ein bisschen verrückt, und wenn irgendwer beschließt, wir seien ein bisschen verrückt, wie können wir … wie können wir ihn überzeugen, dass wir es nicht sind?« Schweigen. Einige Kinder seufzten, sahen sich an und verdrehten die Augen. Eine Sache war Marcus aufgefallen, nämlich, dass man, wenn man erst später an eine Schule kam, sofort sagen konnte, wie gut die Lehrer mit einer Klasse fertig wurden. Ms Maguire war jung und nervös und hatte einen schweren Stand, schätzte er. Die Klasse war unberechenbar.
»Dann sagen wir es anders. Woran merken wir, dass Leute verrückt sind?«
Jetzt kommt’s, dachte er. Jetzt kommt’s. Es ist so weit.
»Wenn sie ohne Grund im Unterricht singen, Miss.«
Gelächter. Aber dann wurde alles noch viel schlimmer, als er erwartet hatte. Alle drehten sich um und sahen ihn an; er sah Ms Maguire an, aber sie grinste breit und gezwungen, und sie sah ihm nicht in die Augen.
»Okay, das ist ein Weg, es zu merken. Wenn jemand so etwas macht, könnte man ihn schon für ein bisschen überkandidelt halten. Aber um Marcus mal einen Moment beiseite zu lassen …«
Mehr Gelächter. Er wusste, was sie tat und warum, und er hasste sie.
4
Zum ersten Mal sah Will Angie – oder sah sie nicht, wie sich später herausstellte – bei Championship Vinyl, einem kleinen Plattenladen auf der Holloway Road. Er stöberte herum, vertrieb sich die Zeit mit der halbherzigen Suche nach einer alten R&B-Anthologie, die er besessen hatte, als er noch jünger war, eine von denen, die er geliebt und verloren hatte; er hörte, wie sie dem mürrischen und depressiven Verkäufer sagte, sie suche nach einer Pinky-und-Perky-Platte für ihre Nichte. »Finden Sie das nicht schrecklich? Stellen Sie sich vor, fünf zu sein und nicht zu wissen, wer Pinky und Perky sind! Was bringen sie den Kindern heute nur bei!?«
Sie wollte nur nett sein, aber Will hatte die bittere Erfahrung gemacht, dass Nur-nett-sein-Wollen bei »Championship Vinyl« verpönt war; sie erntete, wie er es hatte kommen sehen, einen vernichtenden, verächtlichen Blick und ein Murmeln, das andeutete, sie verschwende die wertvolle Zeit des Verkäufers. Zwei Tage später saß er zufällig neben derselben Frau in einem Cafe auf der Upper Street. Er erkannte ihre Stimme (sie bestellten beide einen Cappuccino und ein Croissant), die blonden Haare und ihre Jeansjacke. Sie standen beide auf, um sich eine der ausliegenden Zeitungen zu holen – sie nahm den Guardian, also blieb ihm nur die Mail–, und er lächelte, aber sie erkannte ihn ganz offensichtlich nicht, und er hätte es dabei belassen, wäre sie nicht so hübsch gewesen.
»Ich mag Pinky und Perky«, sagte er in, wie er hoffte, sanftem, freundlichem und humorvoll-väterlichem Tonfall, aber er sah sofort, dass er einen ganz entsetzlichen Fehler begangen hatte, dass das nicht dieselbe Frau war, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatte, wovon er sprach. Er hätte sich die Zunge herausreißen und sie mit dem Fuß in den Holzboden stampfen können.
Sie sah ihn an, lächelte nervös und sah sich aus dem Augenwinkel nach dem Kellner um; vermutlich rechnete sie sich aus, wie lange der Kellner brauchen würde, um sich quer durch den Raum auf Will zu stürzen und ihn zu überwältigen; Will verstand sie und konnte es ihr nachfühlen. Wenn sich ein vollkommen Unbekannter im Cafe neben einen setzte und das Gespräch damit eröffnete, einem leise zu sagen, dass er Pinky und Perky mochte, musste man ja erwarten, im nächsten Moment enthauptet und unter den Fußbodenbrettern versteckt zu werden.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Ich habe Sie verwechselt.« Er wurde rot, und dieses Erröten schien sie zu beruhigen: Seine Verlegenheit war immerhin so etwas wie ein Indiz für geistige Gesundheit. Sie widmeten sich wieder ihren Zeitungen, aber die Frau wurde von unterdrücktem Lachen geschüttelt. »Es tut mir leid«, sagte sie schließlich. »Ich muss Sie einfach fragen. Mit wem haben Sie mich verwechselt? Ich habe versucht, mir die Geschichte zusammenzureimen, aber es gelingt mir nicht.«
Also erklärte er es, und sie lachte wieder, und schließlich bekam er die Chance, noch mal von vorne anzufangen und ein normales Gespräch zu führen. Sie redeten über das Morgens-nicht-Arbeiten (zum Nachmittags-auch-nicht-Arbeiten bekannte er sich nicht), den Plattenladen und Pinky und Perky, natürlich, und über diverse andere Figuren aus dem Kinderfernsehen; er hatte noch nie einen solchen Kaltstart in eine Beziehung versucht, aber als sie ihren zweiten Cappuccino ausgetrunken hatten, hatte er eine Telefonnummer und eine Einladung zum Abendessen.
Als sie sich wieder trafen, erzählte sie ihm gleich von ihren Kindern; am liebsten hätte er seine Serviette auf den Boden geworfen, den Tisch umgestoßen und wäre weggerannt.
»Und?«, sagte er. Etwas Besseres hätte er natürlich nicht sagen können.
»Ich dachte nur, du solltest es wissen. Für manche Leute macht das einen Unterschied.«
»In welcher Hinsicht?«
»Für Männer, meine ich.«
»Na ja, das habe ich schon verstanden.«
»Es tut mir leid, ich mache es dir nicht besonders leicht, was?«
»Du machst alles richtig.«
»Es ist nur so, dass … also, wenn das ein richtiges Rendezvous ist, und ich habe das Gefühl, das ist es, dann, dachte ich, sollte ich es dir sagen.«
»Danke. Aber das ist wirklich kein Problem. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn du keine Kinder hättest.« Sie lachte. »Wirklich? Warum?«
Eine gute Frage. Warum? Selbstverständlich hatte er es gesagt, weil er geglaubt harte, damit cool und einnehmend zu klingen, aber das konnte er ja schlecht sagen.
»Weil ich noch nie mit einer Mutter aus war, und das wollte ich schon immer mal. Ich glaube, in so was bin ich gut.«
»In was?«
Richtig. Gut in was? Worin war er gut? Das war die große Preisfrage, zu der ihm noch nie irgendeine Antwort eingefallen war. Vielleicht würde er gut mit Kindern können, obwohl er sie hasste und alle, die dafür verantwortlich waren, sie in die Welt zu setzen. Vielleicht hatte er John, Christine und Baby Imogen zu voreilig abgeschrieben. Vielleicht war es das! Onkel Will!
»Ich weiß nicht. Gut in Kinderkram. Rumalbern und so.«
Das musste er sein. Das war doch jeder, oder? Vielleicht hätte er schon die ganze Zeit mit Kindern arbeiten sollen. Vielleicht war das ein Wendepunkt in seinem Leben! Man musste allerdings sagen, dass Angies Schönheit nicht ganz unerheblich für die Entscheidung war, seine Affinität zu Kindern neu zu überdenken. Zu dem langen blonden Haar gehörten, wie er nun wusste, ein ruhiges, offenes Gesicht, große blaue Augen und außerordentlich sexy wirkende Augenfältchen – sie war schön auf eine einnehmende, gesunde Julie-Christie-Art. Genau das war der Punkt. Wann war er je mit einer Frau ausgegangen, die wie Julie Christie aussah? Menschen, die wie Julie Christie aussahen, gingen nicht mit Menschen wie ihm aus. Sie gingen mit Filmstars, mit englischen Peers oder mit Formel-1-Fahrern aus. Was ging hier vor? Er kam zu dem Schluss, dass es an den Kindern liegen musste; Kinder stellten einen Makel dar, wie ein Muttermal oder Fettleibigkeit, der ihm eine Chance eröffnete, die er sonst nie gehabt hätte. Möglicherweise demokratisierten Kinder schöne alleinstehende Frauen.
»Eins kannst du mir glauben«, hörte er Angie sagen, obwohl er die meisten Überlegungen, die dieser Feststellung vorangegangen waren, verpasst hatte, »als alleinerziehende Mutter wird man sehr viel empfänglicher für feministische Klischees. Du weißt schon, alle Männer sind Schweine, eine Frau ohne Mann ist wie ein … ein … Irgendwas ohne irgendwas, das keinerlei Bezug zum ersten Irgendwas hat, so was alles.«
»Das glaube ich gerne«, sagte Will mitfühlend. Er war jetzt Feuer und Flamme. Wenn alleinerziehende Mütter wirklich alle Männer für Schweine hielten, dann konnte er absahnen. Er konnte für alle Zeiten mit Frauen ausgehen, die wie Julie Christie aussahen. Er nickte und runzelte die Stirn und schürzte die Lippen, während Angie schimpfte, und legte sich dabei die neue Strategie zurecht, die sein ganzes Leben verändern konnte.
Während der nächsten paar Wochen war er Will der Gute, Will der Erlöser, und er genoss es. Und unkompliziert war es auch. Bei Maisy, Angies mysteriös-ernster Fünfjähriger, die ihn für durch und durch unsolide zu halten schien, konnte er nicht landen. Aber bei Joe, dem Dreijährigen, hatte er fast auf Anhieb gewonnen, hauptsächlich deshalb, weil Will ihn bei ihrer ersten Begegnung an den Beinen festgehalten und mit dem Kopf nach unten hängen lassen hatte. Das reichte. Mehr war nicht nötig. Er wünschte sich, die Beziehungen zu vollwertigen menschlichen Wesen wären auch so unkompliziert. Sie gingen zu McDonald’s. Sie gingen ins Science Museum und ins Natural History Museum. Sie unternahmen eine Bootsfahrt auf der Themse. Bei den sehr seltenen Gelegenheiten, bei denen er über mögliche eigene Kinder nachgedacht hatte (immer betrunken, immer in der stürmischen ersten Phase einer neuen Beziehung), hatte er sich stets eingeredet, die Vaterschaft würde ein einziger Anlass für schöne Erinnerungsfotos sein, und Vaterschaft nach dem Angie-Modell war genau so: Er konnte Hand in Hand mit einer schönen Frau spazieren gehen, vor ihnen tollten die Kinder, und alle konnten ihn dabei sehen, und wenn er das einen Nachmittag lang gemacht hatte, konnte er wieder heimgehen, wenn er wollte.
Und dann war da der Sex. Sex mit einer alleinerziehenden Mutter, entschied Will nach seiner ersten Nacht mit Angie, schlug alles, was er bisher an Sex erlebt hatte. Wenn man sich die richtige Frau aussuchte, eine, die vom Vater ihrer Kinder schlecht behandelt und schließlich verlassen worden war und seitdem niemand Neuen kennengelernt hatte (weil man wegen der Kinder nicht ausgehen konnte und außerdem viele Männer Kinder nicht mochten, und auch das Chaos nicht, das regelmäßig um diese Kinder tobte wie ein Wirbelsturm) … Wenn man sich eine von denen aussuchte, dann liebte sie einen dafür. Urplötzlich war man attraktiver, ein besserer Liebhaber, ein besserer Mensch.
Soweit er sehen konnte, war es ein rundum glückliches Arrangement. All diese lauwarmen Paarungen, die in der Welt der kinderlosen Singles stattfanden, zwischen Menschen, für die eine Nacht in einem fremden Bett nur ein Fick unter vielen war … sie wussten nicht, was sie verpassten. Sicher, es gab da rechtschaffene Menschen, Männer wie Frauen, die von seiner Logik abgestoßen und entsetzt gewesen wären, aber das konnte ihm nur recht sein. So hatte er weniger Konkurrenz. Sein großer Trumpf bei der Affäre mit Angie war letztendlich, dass er nicht jemand anderer war. Das hieß in diesem Fall, dass er nicht Simon war, ihr Ex, der Probleme mit dem Alkohol und der Arbeit hatte und dann, um kein peinliches Klischee auszulassen, auch noch seine Sekretärin bumste. Will fand es leicht, nicht Simon zu sein; er hatte eine natürliche Gabe dafür, nicht Simon zu sein, er war brillant darin. Im Grunde war es fast unfair, dass etwas, das ihm so leicht fiel, ihm überhaupt einen Vorteil bringen sollte, aber so war es: Er wurde mehr dafür geliebt, dass er nicht Simon war, als er je dafür geliebt worden war, einfach er selbst zu sein.
Selbst das Ende hatte, als es kam, ungeheuer viel für sich. Will hatte immer Schwierigkeiten mit dem Schlussmachen gehabt: Es war ihm nie recht gelungen, den Stier bei den Hörnern zu packen, und die Folge waren bisher immer ein wenig unsaubere Übergänge gewesen. Aber mit Angie war es unkompliziert – ja, es war sogar so unkompliziert, dass er das Gefühl hatte, da müsse irgendwo ein Haken sein.
Sie waren sechs Wochen zusammen, und er begann bereits gewisse Dinge unbefriedigend zu finden. Zunächst mal war Angie nicht sehr flexibel, und die Sache mit den Kindern konnte manchmal hinderlich werden – in der letzten Woche hatte er Karten für die Kinopremiere des neuen Mike-Leigh-Films gekauft, aber sie schaffte es erst dreißig Minuten nach Beginn des Films ins Kino, weil der Babysitter nicht gekommen war. Damals war er wirklich sauer gewesen, obwohl er glaubte, seine Verärgerung ganz gut verborgen zu haben, und sie doch noch einen recht netten Abend verbracht hatten. Und sie konnte nie bei ihm übernachten, also musste er immer zu ihr gehen, und sie hatte nicht besonders viele CDs, und Video, Satellitenschüssel oder Kabel gab es auch nicht, also blieb ihnen schließlich nichts anderes übrig, als sich an Samstagabenden Casuality und irgendein beschissenes TV-Movie über ein Kind mit einer schlimmen Krankheit anzusehen. Er begann sich gerade erst zu fragen, ob Angie wirklich das war, was er gesucht hatte, als sie beschloss, die Sache zu beenden. Sie waren in einem indischen Restaurant auf der Holloway Road, als sie es ihm sagte.
»Will, es tut mir leid, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so weitergehen kann.«
Er sagte kein Wort. Wenn in der Vergangenheit ein Gespräch mit diesen Worten begonnen hatte, bedeutete das normalerweise, dass sie etwas herausgefunden hatte oder dass er etwas Gemeines, Dummes oder unglaublich Unsensibles gesagt hatte, aber er glaubte wirklich, sich in der Beziehung mit Angie untadelig verhalten zu haben. Durch ein Schweigen gewann er Zeit, in der er seinen Gedächtnisspeicher auf eventuelle Taktlosigkeiten scannte, die ihm entfallen sein konnten, aber da war nichts. Er wäre extrem enttäuscht gewesen, wenn er etwas gefunden hätte, eine unwissentliche Treulosigkeit etwa oder eine beiläufige, unbedeutende Grausamkeit. Da diese Beziehung mit seiner Nettigkeit stand und fiel, hätte alles, was dieses Bild trüben konnte, bedeutet, dass seine Unzuverlässigkeit so tief verwurzelt war, dass sie sich nicht kontrollieren ließ.
»Es liegt nicht an dir. Du warst toll. Es liegt an mir. Na ja, an meiner Situation jedenfalls.«
»Mit deiner Situation ist alles in Ordnung. Jedenfalls was mich betrifft.« Er war so erleichtert, dass ihm danach war, großzügig zu sein.
»Da gibt es Dinge, von denen du nichts weißt. Über Simon.«
»Macht er dir Ärger? Denn wenn er das tut …« Wirst du was?, wollte er sich selbst verächtlich fragen. Wirst du dir einen Joint drehen, sobald du zu Hause bist, und sie völlig vergessen? Wirst du mit einer ausgehen, die deutlich unkomplizierter ist?
»Nein, eigentlich nicht. Naja, ich nehme an, für einen Außenstehenden muss es so aussehen. Er ist nicht sehr glücklich darüber, dass ich einen neuen Freund habe. Und ich weiß, wie das klingt, aber ich kenne ihn, und ich weiß, dass er unsere Trennung noch nicht verwunden hat. Und ich bin auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich bin noch nicht so weit, mich in eine neue Beziehung zu stürzen.«
»Bis jetzt machst du es ganz gut.«
»Die Tragödie ist, dass ich genau den Richtigen zu genau dem falschen Zeitpunkt getroffen habe. Ich hätte mit einer bedeutungslosen Affäre anfangen sollen, nicht mit … nicht mit jemandem, der …«
Das war doch eine Ironie des Schicksals, dachte er. Hätte sie nur geahnt, dass er genau richtig war; wenn es einen Mann gab, der für bedeutungslose Affären besser geschaffen war, legte er keinen Wert auf seine Bekanntschaft. Ich hab nur so getan!, wollte er ihr sagen. Ich bin schrecklich! Ich bin viel oberflächlicher, ehrlich! Aber es war zu spät.
»Ich frage mich, ob ich dich unter Druck gesetzt habe. Ich habe alles versaut, oder?«
»Nein, Will, überhaupt nicht. Du warst großartig. Es tut mir so leid, dass …«
Sie vergoss ein paar Tränchen, und er liebte sie dafür. Er hatte noch nie eine Frau weinen sehen, ohne sich verantwortlich zu fühlen, und er genoss die Erfahrung durchaus.
»Es braucht dir gar nichts Leid zu tun. Wirklich.«
Wirklich, wirklich, wirklich.
»Oh, das tut es aber.«
»Das muss es nicht.«
Wann war er das letzte Mal in der Position gewesen, Vergebung zu gewähren? Seit der Schule sicher nicht mehr, und möglicherweise auch da schon nie. Von allen Abenden, die er mit Angie verbracht hatte, genoss er den letzten am meisten. Damit war für Will alles klar. In dem Moment wusste er, dass es andere Frauen wie Angie geben würde – Frauen, die zuerst glaubten, nur einen festen Fickpartner zu wollen, und schließlich feststellten, dass ein ruhiges Leben mehr wert war als noch so viele lautstarke Orgasmen. Da er ganz ähnliche Empfindungen hegte, wenn auch aus vollkommen anderen Gründen, wusste er, dass er viel zu geben hatte. Tollen Sex, reichlich Streicheleinheiten fürs Ego, Vaterschaft auf Zeit ohne Tränen und eine Trennung ohne Schuldgefühle – was konnte ein Mann sich Besseres wünschen? Alleinerziehende Mütter – intelligente, attraktive, willige Frauen, Tausende von ihnen, überall in London – waren die beste Erfindung, von der Will je gehört hatte. Seine Karriere als Seriensoftie hatte begonnen.
5
Eines Montagmorgens weinte seine Mutter schon vor dem Frühstück, und das machte ihm Angst. Tränen am Morgen waren etwas Neues, und sie waren ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Sie bedeuteten, dass es nun ohne Vorwarnung zu jeder Tageszeit geschehen konnte; man war zu keiner Zeit davor sicher. Bis heute war es morgens okay gewesen: Sie schien jeden Tag mit der Hoffnung aufzustehen, was auch immer sie unglücklich machte, sei über Nacht irgendwie verschwunden, im Schlaf, so wie es manchmal bei Erkältungen und Bauchschmerzen war. Als sie ihm heute Morgen zugerufen hatte, er solle sich beeilen, hatte sie okay geklungen – nicht wütend, nicht unglücklich, nicht durchgedreht, eben normal und muttermäßig. Aber da saß sie nun zusammengesunken in ihrem Morgenmantel am Küchentisch und heulte, mit einem halb gegessenen Stück Toast auf dem Teller, völlig verschwollenem Gesicht und laufender Nase.
Marcus sagte nie etwas, wenn sie weinte. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er verstand nicht, warum sie es tat, und weil er es nicht verstand, konnte er ihr nicht helfen, und weil er ihr nicht helfen konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als dazustehen und sie mit offenem Mund anzuglotzen, und wenn es vorbei war, benahm sie sich so, als sei nichts geschehen.
»Möchtest du Tee?«
Er musste raten, was sie sagte, weil sie so verrotzt war.
»Ja, bitte.« Er nahm sich eine saubere Schale vom Abtropfständer und ging zum Vorratsschrank, um sich seine Frühstücksflocken auszusuchen. Das besserte seine Stimmung. Er hatte ganz vergessen, dass sie ihm am Samstagmorgen erlaubt hatte, eine Kombipackung mit mehreren Sorten in den Einkaufswagen zu legen. Er durchlebte die übliche Qual der Wahl: Er wusste, es wäre vernünftiger, zuerst die langweiligen Sachen zu nehmen, die Cornflakes und die mit Früchten drin, denn wenn er sie jetzt nicht aß, würde er sie nie essen, sie würden nur im Schrank vergammeln, seine Mutter wäre sauer auf ihn, und für die nächsten paar Monate würde er mit einer Riesensparpackung von irgendetwas Scheußlichem auskommen müssen. Er wusste all das, trotzdem entschied er sich wie immer für die Coco Pops. Seine Mutter bemerkte es nicht – bisher der erste Vorteil, den er an ihrer schrecklichen Depression entdecken konnte. Es war allerdings kein sehr großer Vorteil; alles in allem hätte er es lieber gesehen, sie wäre in der Verfassung gewesen, ihn an den Schrank zurückzuschicken. Er hätte mit Freuden auf Coco Pops verzichtet, wenn sie darauf verzichtet hätte, ununterbrochen zu weinen.
Er aß seine Pops, trank seinen Tee, nahm seine Tasche und gab seiner Mutter einen Kuss, nur einen ganz normalen, keinen schmalzigen, verständnisvollen, und ging. Keiner von ihnen sagte ein Wort. Was sollte er sonst machen?
Auf dem Schulweg versuchte er zu verstehen, was ihr fehlte. Was für ein Problem hatte sie, von dem er nichts wusste? Sie hatte Arbeit, also waren sie nicht arm, obwohl sie auch nicht reich waren – sie war Musiktherapeutin, also eine Art Lehrerin für behinderte Kinder, und sie sagte immer, die Bezahlung sei erbärmlich, lächerlich, lausig, ein Verbrechen. Aber sie hatten immer genug für die Wohnung, fürs Essen, und für Ferien einmal im Jahr, und ab und zu sogar für Computerspiele. Was konnte einen noch zum Weinen bringen, vom Geld abgesehen? Der Tod? Aber das wüsste er, wenn jemand Wichtiges gestorben wäre; so weinen würde sie nur um Großmutter, Großvater, seinen Onkel Tom und Toms Familie, und die hatten sie alle am letzten Wochenende beim vierten Geburtstag seiner Cousine Ella gesehen. Hatte es was mit Männern zu tun? Er wusste, dass sie sich einen Freund wünschte, aber das wusste er auch nur, weil sie manchmal Witze darüber machte, und er konnte sich nicht vorstellen, wieso aus den gelegentlichen Witzen darüber ein ununterbrochenes Heulen darüber werden sollte. Und überhaupt hatte sie doch Roger den Laufpass gegeben, und wenn sie so verzweifelt war, hätte sie ihn festgehalten. Was blieb also sonst? Er versuchte sich zu erinnern, worüber die Leute in Eastenders außer Geld, Tod und Liebhabern sonst noch weinten, aber das half ihm nicht weiter: Gefängnisstrafen, ungewollte Schwangerschaften, AIDS, Sachen, die nicht zur eigenen Mutter passten.
Das alles war vergessen, sobald er auf dem Schulhof war. Nicht, dass er beschlossen hätte, es zu vergessen. Es war nur so, dass sein Selbsterhaltungstrieb die Oberhand gewann. Wenn man Ärger mit Lee Hartley und dessen Spießgesellen hatte, konnte man nicht darüber nachdenken, ob seine Mutter irre wurde oder nicht. Aber heute ging alles glatt, heute Morgen jedenfalls: Er konnte sie alle an der Mauer der Turnhalle lehnen sehen, über irgendein Wertobjekt gebeugt, in sicherer Entfernung, also erreichte er den Klassenraum ohne Schwierigkeiten.
Seine Freunde Nicky und Mark waren schon da und spielten Tetris auf Marks Gameboy. Er ging zu ihnen rüber.
»Alles klar?«