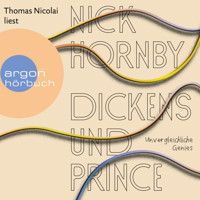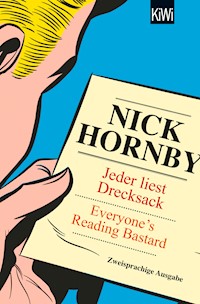9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Katies Seitensprung ist eigentlich nicht das Problem, auch wenn sie ihrem Mann spontan einen Scheidungsantrag macht, der nicht angenommen wird. David, ein frustrierter unveröffentlichter Schriftsteller, hält das Banner der Familie hoch, zu deren Unterhalt er nur bescheiden mit giftigen Zeitungskolumnen beiträgt. Aber immerhin ist er ein recht ordentlicher Hausmann und ein eingespielter Ehepartner. Katies großes Problem ist DJ GoodNews. Der moraltriefende Heiler mit dem exotischen Augenbrauenpiercing und unbestreitbaren Heilerfolgen zieht zu Katie und David und krempelt die Familie um.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Ähnliche
Nick Hornby
How to be good
Roman
Aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Nick Hornby
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Für Gil Hornby
Danksagung
Ich danke Tony Lacey, Helen Fraser, Juliet Annan, Joanna Prior, Anya Waddington, Jeremy Ettinghausen, Martin Bryant, Wendy Carlton, Susan Kennedy Petersen, Amanda Posey, Ruth Hallgarten, Caroline Dawnay, Annabel Hardman, Mary Cranitch, Anna Wright und Gaby Chiappe.
Eins
Ich stehe auf einem Parkplatz in Leeds, als ich meinem Mann sage, dass ich nicht länger mit ihm verheiratet sein möchte. Dabei ist Dave noch nicht mal bei mir auf dem Parkplatz. Er ist zu Hause und passt auf die Kinder auf, und ich habe nur angerufen, um ihn daran zu erinnern, dass er Molly eine Nachricht für ihre Klassenlehrerin mitgeben soll. Das andere … flutscht mir einfach so raus. Das ist natürlich ein Fehler. Obwohl ich offensichtlich, und das zu meiner größten Überraschung, ein Mensch bin, der seinem Ehemann sagt, dass er nicht länger mit ihm verheiratet sein möchte, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich ein Mensch bin, der es am Handy und auf einem Parkplatz sagt. Diese Selbsteinschätzung werde ich jetzt revidieren müssen. Ich würde mich zum Beispiel als einen Menschen beschreiben, der keine Namen vergisst, weil ich Namen Tausende von Malen noch gewusst und nur ein oder zwei Mal vergessen habe. Aber Ehebeendungsgespräche finden bei den meisten Menschen, wenn überhaupt, nur einmal im Leben statt. Wenn man beschließt, seins am Handy und auf einem Parkplatz in Leeds abzuwickeln, kann man nicht unbedingt behaupten, es sei nicht repräsentativ, ebenso wenig, wie Lee Harvey Oswald geltend machen konnte, es sei sonst nicht seine Art, Präsidenten zu erschießen. Manchmal müssen wir uns nach unseren einmaligen Aktionen beurteilen lassen.
Später, im Hotelzimmer, als ich nicht schlafen kann – immerhin ein kleiner Trost, dass ich zwar zu einer Frau geworden bin, die Ehen auf dem Parkplatz beendet, aber dann doch so viel Anstand habe, mich anschließend schlaflos im Bett zu wälzen –, gehe ich das Gespräch im Geiste noch einmal so detailliert ich kann durch und versuche dahinterzukommen, wie wir es in drei Minuten (meinetwegen auch zehn) von da (Mollys Zahnarzttermin) nach hier (sofortige Scheidung) geschafft hatten. Was dann in eine endlose Drei-Uhr-morgens-Grübelei darüber mündete, wie wir es in vierundzwanzig Jahren von da (Kennenlernen auf einer Collegeparty im Jahr 1976) nach hier (sofortige Scheidung) geschafft hatten.
Um die Wahrheit zu sagen, dauert der zweite Teil dieser Selbstreflexion nur deshalb so lange, weil vierundzwanzig Jahre eine lange Zeit sind und mir Unmengen von Einzelheiten ungebeten in den Sinn kommen, kleine Details am Rande, die im Grunde nicht viel zur Story beitragen. Wären meine Gedanken zu unserer Ehe verfilmt worden, würden die Kritiker schreiben, der Film bestehe aus lauter Füllmaterial, habe keinen Plot und ließe sich wie folgt zusammenfassen: zwei Leute lernen sich kennen, verlieben sich, kriegen Kinder, fangen mit Streitereien an, werden fett und übellaunig (er), beziehungsweise gelangweilt, verzweifelt und übellaunig (sie), und trennen sich. Dieser Synopsis könnte ich nichts entgegensetzen. Wir sind nichts Besonderes.
Aber das Telefonat … Ich komme einfach nicht auf die Verbindung, den Punkt, an dem aus einem relativ harmonischen und vollkommen banalen Gespräch über eine kleinere häusliche Organisationsfrage dieser alles verschlingende, welterschütternde Moment wurde, nach dem nichts mehr so war wie zuvor. An den Anfang erinnere ich mich noch beinahe Wort für Wort:
Ich: »Hiya.«
Er: »Hallo. Wie steht’s?«
Ich: »Gut, ja. Mit den Kindern alles okay?«
Er: »Ja. Molly ist hier und sieht fern, Tom ist bei Jamie.«
Ich: »Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass du Molly einen Zettel schreiben musst, den sie morgen mit in die Schule nehmen soll. Wegen dem Zahnarzt.«
Na? Und? Unmöglich, würde man da doch denken, nicht nach so einem Auftakt. Aber von wegen: Wir kriegten das hin. Ich bin fast sicher, dass der erste Sprung hier stattfand, an diesem Punkt; so, wie ich es jetzt in Erinnerung habe, war dort eine Pause, ein ungutes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Und dann sagte ich so was wie:
»Was?«, und er sagte so was wie: »Nichts.« Und dann sagte ich wieder: »Was?«, und er sagte wieder: »Nichts«, nur dass ihn meine Frage diesmal eindeutig nicht verblüffte oder amüsierte, sondern er sich zierte, was bedeutet, dass man nachbohren muss, oder? Also bohrte ich nach.
»Komm schon.«
»Nein.«
»Komm schon.«
»Nein. Was du gesagt hast.«
»Was habe ich denn gesagt?«
»Dass du nur angerufen hättest, um mir das wegen Mollys Zettel zu sagen.«
»Was ist daran falsch?«
»Es wäre nett, wenn du noch aus einem anderen Grund angerufen hättest. Du weißt schon, nur um dich mal zu melden. Um zu hören, wie es deinem Mann und deinen Kindern geht.«
»Oh, David.«
»Was, ›oh David‹?«
»Das war meine erste Frage. ›Wie geht’s den Kindern?‹«
»Ja, okay. ›Wie geht’s den Kindern?‹ Nicht, na ja, so was wie: ›Und wie geht’s dir?‹«
Wenn alles gut läuft, führt man nicht solche Gespräche. Man kann sich unschwer vorstellen, dass in anderen, besseren Beziehungen ein Telefonat, das so anfängt, nicht dazu führen würde und könnte, dass von Scheidung geredet wird. In besseren Beziehungen würde man den Zahnarztteil zügig abhaken und zu anderen Themen kommen – dem Arbeitstag oder Plänen für den Abend oder, in einer sensationell gut eingespielten Beziehung, vielleicht sogar irgendwas, das sich in der Welt außerhalb der eigenen vier Wände zugetragen hat, vielleicht ein Hustenanfall während der Nachrichten – genauso alltäglich, genauso nebensächlich, aber eben Themen, die die Substanz und vielleicht sogar die Haltbarkeit einer ganz gewöhnlichen, nicht weiter wichtigen Liebesbeziehung ausmachen. David und ich allerdings … so sieht es zwischen uns nicht aus, schon lange nicht mehr. Ein Telefonat wie unseres kommt zustande, wenn man sich jahrelang gegenseitig verletzt hat, bis jedes Wort, das man sagt oder hört, codiert und überfrachtet ist, so kompliziert und reich an Subtext wie ein anstrengendes und hochintelligentes Theaterstück. Als ich in meinem Hotelzimmer wach lag und versuchte, mir das alles zusammenzureimen, musste ich sogar anerkennen, wie clever wir diesen Code entwickelt hatten: es so weit zu bringen, erfordert jahrelange verbiesterte Spitzfindigkeit.
»Es tut mir leid.«
»Möchtest du wissen, wie es mir geht?«
»Um ehrlich zu sein, David, ich brauche nicht zu fragen, wie es dir geht. Ich höre schon, wie es dir geht. Gesund und munter genug, um auf zwei Kinder aufzupassen und mich gleichzeitig anzugiften. Und offensichtlich übellaunig, aus Gründen, die sich bislang meiner Kenntnis entziehen. Aber ich bin sicher, du wirst mich bald aufklären.«
»Woraus schließt du, dass ich übellaunig bin?«
»Ha! Du bist die Übellaunigkeit in Person. Ständig.«
»Blödsinn.«
»David, du verdienst deinen Lebensunterhalt mit Übellaunigkeit.«
Zum Teil stimmt das sogar. Seine einzigen festen Einkünfte bezieht David aus einer Kolumne, die er für unsere Lokalzeitung schreibt. Die Kolumne ziert ein Foto, auf dem er sauer in die Kamera guckt, und hat den Untertitel »Der zornigste Mann in Holloway«. Die letzte, die zu lesen ich über mich brachte, war eine Suada gegen alte Leute im Bus: Warum hielten sie nie Kleingeld bereit? Warum setzten sie sich nicht auf die Plätze, die vorne im Bus für sie reserviert waren? Warum mussten sie immer zehn Minuten vor ihrer Haltestelle aufstehen, sodass sie zwangsläufig andauernd in irritierender und unvorteilhafter Weise umfallen mussten? Na ja, man kann es sich in etwa vorstellen.
»Falls es dir entgangen ist, weil du dich zum Beispiel nie dazu herablässt, meine beschissenen Sachen mal zu lesen …«
»Wo ist Molly?«
»Sitzt im anderen Zimmer vor dem Fernseher. Scheiße. Fuck. Kacke, Pisse, Arsch.«
»Oh, wie erwachsen.«
»… weil du dich nie herablässt, meine Scheißsachen mal zu lesen, meine Kolumne ist ironisch gemeint.«
Ich lachte ironisch.
»Tja, entschuldige vielmals, wenn diese Ironie den Bewohnern des Hauses Webster Road 32 entgeht. Wir wachen jeden Tag unseres Lebens mit dem zornigsten Mann von Holloway auf.«
»Was soll das eigentlich alles?«
Wenn der Drehbuchautor eines Films über unsere Ehe eine günstige Gelegenheit suchen würde, um einer langweiligen, oberflächlichen Streiterei eine etwas tiefsinnigere Wendung zu geben, wäre das der richtige Augenblick: ihr wisst schon – ›Das ist eine gute Frage … Wohin führt uns das … Was tun wir hier … Und so weiter und so weiter … Es ist vorbei.‹ Na gut, muss noch ein bisschen überarbeitet werden, aber so würde es hinhauen. Aber da David und ich nicht Tom und Nicole sind, sind wir blind für diese hübschen kleinen metaphorischen Momente.
»Ich weiß nicht, was das alles soll. Du bist sauer, weil ich nicht gefragt habe, wie es dir geht.«
»Ja.«
»Und wie geht’s dir?«
»Leck mich am Arsch.«
Ich seufzte, direkt in die Sprechmuschel des Telefons, so, dass er es hören konnte; ich musste das Handy vom Ohr und näher an den Mund nehmen, worunter die Spontaneität etwas litt, aber ich wusste aus Erfahrung, dass mein Handy keine Begabung für nonverbale Nuancen hatte.
»Du lieber Himmel! Was war das denn?«
»Das war ein Seufzen.«
»Klingt, als wärst du einen Berg raufgelaufen.«
Eine Weile lang sagten wir nichts. Er war in einer Küche im Londoner Norden und sagte nichts, und ich war auf einem Parkplatz in Leeds und sagte nichts, und mir stieß ganz plötzlich und widerwärtig auf, wie gut ich diese Stille kannte, wie sie geformt war und wie sie sich anfühlte, all ihre stachligen kleinen Ecken. (Und natürlich ist es in Wirklichkeit gar keine Stille. Man hört den mit Flüchen gespickten Wortschwall des eigenen Ärgers, das Blut, das einem in den Ohren rauscht, und, in diesem Fall, auch den Motor eines Fiat Uno, der eine Lücke weiter einparkt.) Die Wahrheit ist, es gab keine Verbindung zwischen einer häuslichen Angelegenheit und dem Entschluss, sich scheiden zu lassen. Darum kann ich sie nicht finden. Ich glaube, es war eine Flucht nach vorn.
»Ich hab das so satt, David.«
»Was?«
»Das alles. Immer dieses Streiten. Die Anschweigerei. Die miese Stimmung. Die ganze … vergiftete Atmosphäre.«
»Oh. Das.« Es hört sich an, als sei die Gehässigkeit durch eine undichte Stelle im Dach in unsere Ehe hineingetropft, das er eigentlich hätte flicken sollen. »Tja. Na. Kann man jetzt nicht mehr ändern.«
Ich holte tief Atem, diesmal für mich und nicht für seine Ohren gedacht, darum behielt ich das Handy am Ohr. »Vielleicht doch.«
»Was soll das bedeuten?«
»Willst du wirklich so den Rest deines Lebens verbringen?«
»Nein, natürlich nicht. Hast du eine Alternative vorzuschlagen?«
»Ja, ich denke schon.«
»Dürfte ich auch erfahren, welche?«
»Das weißt du genau.«
»Natürlich weiß ich das. Aber ich will, dass du es zuerst aussprichst.«
Und als wir so weit gekommen waren, machte es mir nichts mehr aus.
»Willst du dich scheiden lassen?«
»Ich möchte fürs Protokoll festhalten, dass du es zuerst gesagt hast, nicht ich.«
»Meinetwegen.«
»Du, nicht ich.«
»Ich, nicht du. Jetzt komm, David. Ich versuche über ein trauriges, ernstes Thema zu reden, und du willst immer noch Punkte sammeln.«
»Dann kann ich ja allen erzählen, dass du mich um die Scheidung gebeten hast. Aus heiterem Himmel.«
»Ach ja, das kommt für dich also aus heiterem Himmel? Ich meine, es hat ja gar keine Anzeichen gegeben, was, so überglücklich, wie wir zusammen waren. Ist das alles, was dich interessiert? Es allen zu sagen? Geht es dir nur darum?«
»Ich hänge mich ans Telefon, sowie du aufgelegt hast. Ich will meine Version verbreiten, ehe du deine verbreiten kannst.«
»Okay, dann lege ich eben nicht auf.«
Und dann tat ich, angewidert von mir selbst und ihm und allem anderen, genau das Gegenteil und beendete das Gespräch. So bin ich dann schlaflos in einem Hotelzimmer in Leeds gelandet, wo ich das Gespräch und meinen Anteil daran Schritt für Schritt zurückzuverfolgen versuche, gelegentlich frustriert fluche, weil ich nicht einschlafen kann, Licht und Fernseher an und aus und ganz allgemein meinem Liebhaber das Leben schwer mache. Ach, ihn sollte ich vielleicht noch irgendwo in die Filmhandlung einbauen. Sie heirateten, er wurde fett und mürrisch, sie wurde verzweifelt und mürrisch, sie nahm sich einen Liebhaber.
Dass wir uns richtig verstehen: Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin Ärztin. Einer der Gründe, Ärztin zu werden, war, dass ich glaubte, ich könnte damit Gutes tun – GUT, im Gegensatz zu aufregend, gut bezahlt oder glanzvoll. Ich fand, es klang gut: »Ich werde Ärztin«, »Ich studiere Medizin«, »Ich bin Allgemeinmedizinerin mit einer kleinen Praxis im Londoner Norden«. Ich fand, es machte genau den richtigen Eindruck – professionell, irgendwie intellektuell, nicht zu protzig, respektabel, gereift, teilnahmsvoll. Ihr glaubt, Ärzten ist egal, wie Dinge aussehen, weil sie Ärzte sind? Natürlich nicht. Na, wie auch immer. Ich bin ein guter Mensch, Ärztin, ich liege in einem Hotelbett neben Stephen, einem Mann, den ich nicht besonders gut kenne, und ich habe gerade meinen Ehemann um die Scheidung gebeten.
Stephen ist ebenfalls wach – wen wundert’s.
»Alles klar bei dir?«, fragt er mich.
Ich kann ihn nicht ansehen. Vor ein paar Stunden hatten seine Hände mich überall angefasst, da, wo ich sie haben wollte, aber jetzt will ich ihn nicht in diesem Bett in diesem Zimmer in Leeds haben.
»Bisschen überdreht.« Ich steige aus dem Bett und ziehe mich an. »Ich mache noch einen kleinen Spaziergang.«
Es ist mein Hotelzimmer, also nehme ich die Schlüsselkarte mit, aber schon als ich sie in die Tasche stecke, weiß ich, dass ich nicht zurückkommen werde. Ich will nach Hause, streiten und weinen und mich schuldig fühlen, weil wir kurz davor sind, unsere Kinder fürs Leben zu traumatisieren. Das Zimmer zahlt das Gesundheitsamt. Aber die Rechnung für die Minibar wird Stephen übernehmen müssen.
Ich fahre ein paar Stunden und halte dann an einer Raststätte für eine Tasse Tee und einen Doughnut. Wäre das ein Film, würde auf der Heimfahrt irgendwas passieren, irgendwas, das die Bedeutung dieser Reise unterstreichen oder erhellen würde. Ich würde jemanden treffen oder beschließen, ein anderer Mensch zu werden, oder in ein Verbrechen verwickelt und eventuell vom Verbrecher verschleppt werden, einem Neunzehnjährigen, der Drogen nimmt und eine schlechte Schulbildung hat, und, wie sich herausstellt, sowohl intelligenter als auch mitfühlender ist als ich – eine Ironie, wenn man bedenkt, dass ich Ärztin bin und er ein bewaffneter Krimineller ist. Und er würde irgendwas von mir lernen, obwohl Gott allein weiß, was, und ich würde was von ihm lernen, und dann würden wir unsere Lebensreisen getrennt fortsetzen, an entscheidenden Punkten subtil verändert durch unsere kurze gemeinsame Zeit. Aber das ist kein Film, wie schon gesagt, darum esse ich meinen Doughnut und trinke meinen Tee und steige wieder ins Auto. (Was hab ich nur immer mit Filmen? Ich bin in den letzten Jahren nur zwei Mal im Kino gewesen, und beide Male waren es Zeichentrickfilme mit Insekten. Was weiß ich, vielleicht handeln die meisten Filme, die im Moment in den Kinos laufen, von Frauen, die ereignislose Fahrten von Leeds nach Nord-London unternehmen und irgendwo auf der M1 Tee und Doughnuts konsumieren.) Die Fahrt dauert nur drei Stunden, inklusive Doughnuts. Um sechs bin ich zu Hause, zu Hause in einem schlafenden Haus, das, wie ich jetzt bemerke, den sauren Geruch der Niederlage anzunehmen beginnt.
Bis Viertel vor acht steht hier niemand auf, darum döse ich auf dem Sofa. Ich bin froh, wieder hier zu sein, trotz der Handytelefonate und Liebhaber; ich bin froh, die Wärme meiner nichts ahnenden Kinder durch die knarrenden Dielenbretter nach unten sickern zu fühlen. Ich will nicht in unser Ehebett, nicht heute Nacht, nicht heute Morgen oder was immer wir gerade haben – nicht wegen Stephen, sondern weil ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich je wieder mit David schlafen werde. Was würde das bringen? Aber andererseits, was soll das überhaupt, Scheidung oder keine Scheidung? Das ist alles so fremd für mich – ich habe zahllose Gespräche mit oder über Menschen geführt, die »getrennte Schlafzimmer« haben, als sei in einem Bett zu schlafen das Einzige, was eine gute Ehe ausmacht, aber so schlimm es auch werden kann, gemeinsam in einem Bett zu schlafen ist immer das geringste Problem gewesen; der Rest des Lebens ist das Schlimme. Es hat in letzter Zeit, seit unsere Probleme angefangen haben, Momente gegeben, in denen ich beim Anblick von David im wachen, aktiven, bewussten, gehenden, sprechenden Zustand hätte kotzen können, so sehr widerte er mich an; aber nachts sieht das ganz anders aus. Wir haben immer noch Sex, in einer leidenschaftslosen, sachlichen Art und Weise, aber der Sex ist es nicht: es liegt eher daran, dass wir in den letzten rund zwanzig Jahren gelernt haben zu schlafen, besonders gemeinsam zu schlafen. Ich habe Parkbuchten für seine Ellbogen, seine Knie und seinen Hintern entwickelt, und niemand sonst ist so gut an mich angepasst wie er, vor allem nicht Stephen, der – obwohl schlanker und größer und was weiß ich was, das ihn nach landläufiger Meinung einer Frau auf der Suche nach einem Bettgenossen empfehlen könnte – irgendwie alle möglichen Körperteile an lauter falschen Stellen hat; gestern Nacht gab es Momente, in denen ich mich düster fragte, ob David wohl der einzige Mensch ist, neben dem ich es je bequem finden werde, ob unsere Ehe und vielleicht zahllose andere Ehen nur überlebt haben, weil irgendein Gewicht/Größen-Verhältnis existiert, das niemals richtig erforscht wurde, und wenn einer der Partner auch nur den Bruchteil eines Millimeters davon abweicht, hat die Beziehung keine Chance. Und es ist nicht nur das. Wenn David schläft, kann ich ihn in den Menschen zurückverwandeln, den ich noch liebe: ich kann meine Vorstellung davon, wie David sein sollte oder irgendwann mal gewesen ist, seiner schlafenden Gestalt überstülpen, und die sieben Stunden, die ich mit diesem David verbringe, retten mich mit Ach und Krach über den nächsten Tag mit dem anderen David.
Also. Ich döse auf dem Sofa, Tom kommt im Schlafanzug herunter, schaltet den Fernseher ein, holt sich eine Schale Cornflakes, setzt sich in einen Sessel und guckt einen Zeichentrickfilm. Er sieht nicht zu mir hin, sagt nichts.
»Guten Morgen!«, sage ich fröhlich.
»Hi.«
»Wie geht’s dir?«
»Ganz gut.«
»Wie war es gestern in der Schule?«
Aber er ist schon wieder unerreichbar; die Vorhänge an dem zweiminütigen Zeitfenster, durch das mein Sohn mir morgens Gelegenheit gibt, mit ihm zu kommunizieren, sind zugezogen worden. Ich stehe vom Sofa auf und setze Wasser auf. Molly ist als Nächste unten und hat bereits ihre Schuluniform an. Sie macht große Augen, als sie mich sieht.
»Du hast gesagt, du wärst weg.«
»Bin wieder zurückgekommen. Ich hab euch zu sehr vermisst.«
»Wir haben dich nicht vermisst. Oder, Tom?«
Keine Antwort von Tom. Das sind offensichtlich die Alternativen, die ich habe: blanke Aggression seitens meiner Tochter, stumme Gleichgültigkeit von meinem Sohn. Nur ist das natürlich reines Selbstmitleid, und sie sind weder aggressiv noch gleichgültig, sondern einfach Kinder, die nicht plötzlich über Nacht die Intuition von Erwachsenen entwickelt haben, auch nicht, wenn es eine Nacht wie die letzte war.
Und schließlich kommt auch noch David, wie üblich in T-Shirt und Boxershorts. Er will Wasser aufsetzen, macht kurz ein verwirrtes Gesicht, als er merkt, dass das bereits geschehen ist, und lässt dann erst einen verschlafenen Blick durch das Zimmer schweifen, um eine Erklärung für die unerwartete Kesselaktivität zu suchen. Er findet sie lang gestreckt auf dem Sofa.
»Was machst du denn hier?«
»Ich bin nur vorbeigekommen, um zu kontrollieren, wie es ohne mich um deine Qualitäten als Erziehungsberechtigter steht. Ich bin beeindruckt. Du bist als Letzter auf, die Kinder machen sich selbst Frühstück, der Fernseher läuft …«
Ich bin natürlich ungerecht, weil das Leben nun mal so abläuft, ob ich nun hier bin oder nicht, aber warum soll ich erst seinen Angriff abwarten: ich bin ein großer Anhänger von Präventivschlägen.
»Aha«, sagt er. »Diese zweitägige Fortbildung ist einen Tag früher zu Ende. Was war, habt ihr alle doppelt so schnell wie sonst Scheiße geredet?«
»Ich war nicht richtig in Stimmung.«
»Kann ich mir denken. Für was bist du denn in Stimmung?«
»Können wir später darüber reden? Wenn die Kinder in der Schule sind?«
»Oh, ja, natürlich. Später.« Dieses letzte Wort spuckt er geradezu aus, mit tiefster, aber eigentlich unerklärlicher Verbitterung – als sei ich bekannt dafür, Dinge »später« zu machen, als sei jedes einzelne unserer Probleme aus meiner fanatischen Angewohnheit, Dinge aufzuschieben, erwachsen. Ich lache ihm ins Gesicht, was wenig dazu beiträgt, die Atmosphäre zu entspannen.
»Was?«
»Was ist falsch daran, wenn ich vorschlage, so etwas später zu besprechen?«
»Erbärmlich«, sagt er, gibt mir aber keinen Anhaltspunkt dafür, warum. Natürlich ist es verlockend, es auf seine Art zu machen und meinen Scheidungswunsch vor unseren beiden Kindern zu besprechen, aber einer von uns muss sich wie ein Erwachsener benehmen, wenn auch nur vorübergehend, also schüttle ich den Kopf und nehme meine Tasche. Ich will nach oben gehen und schlafen.
»Einen schönen Tag noch, Kinder.«
David starrt mich an. »Wo willst du hin?«
»Ich bin hundemüde.«
»Ich dachte, eins der Probleme mit unserer Arbeitsteilung ist, dass du die Kinder nie zur Schule bringen kannst. Ich dachte, da bliebe dir ein grundlegendes mütterliches Recht vorenthalten.«
Ich muss schon in der Praxis sein, bevor die Kinder morgens das Haus verlassen. Und obwohl ich dafür dankbar bin, hat meine Dankbarkeit mich nie daran gehindert, mein Los zu beklagen, wenn wir darüber stritten, wer was zu tun hat. Und David weiß selbstredend, dass ich nicht ernsthaft den Wunsch habe, die Kinder zur Schule zu bringen, was auch der Grund dafür ist, warum er mich jetzt so genüsslich an meine früheren Klagen erinnert. David ist, wie ich, ein Meister in der Kunst des Ehekriegs, und einen Moment lang kann ich aus mir heraustreten und seine boshafte Geistesgegenwart bewundern. Eins zu null für dich, David.
»Ich bin die halbe Nacht auf gewesen.«
»Macht doch nichts. Die Kinder werden begeistert sein.«
Bastard.
Ich habe natürlich schon früher an Scheidung gedacht. Wer hätte das nicht? Ich habe mir schon vorgestellt, geschieden zu sein, bevor ich überhaupt verheiratet war. In meiner Vorstellung war ich eine gute, tolle, allein lebende, berufstätige Mutter, die eine fantastische Beziehung zu ihrem Ex hatte – gemeinsame Teilnahme an Elternsprechtagen, wehmütige Abende mit alten Fotos, so was alles – und eine ganze Reihe von kurzen Affären mit bohemienhaften jüngeren oder älteren Männern (siehe Kris Kristofferson, »Alice lebt hier nicht mehr«, mein Lieblingsfilm, als ich siebzehn war). Ich erinnere mich, diese Vorstellung noch am Vorabend meiner Hochzeit mit David gehabt zu haben, und das hätte mir wahrscheinlich zu denken geben müssen, tat es aber nicht. Ich glaube, was mir Sorgen machte, war das Fehlen von Ecken und Kanten in meiner Biografie: ich wuchs in einer grünen Vorstadt auf (Richmond), meine Eltern waren und sind glücklich verheiratet, in der Schule war ich Klassensprecherin, ich machte meine Hochschulreife, ich studierte, ich fand einen netten Mann, ich verlobte mich mit ihm. Den einzigen Raum für die Art kultivierter, metropolitaner Abwechslung, nach der ich mich sehnte, sah ich im Nach-Eheleben, darum konzentrierte ich darauf meine mentale Energie.
Ich hatte sogar eine Traumvorstellung vom Moment der Trennung. David und ich sehen uns Reiseprospekte an; er will nach New York, ich will auf Safari nach Afrika, und weil das die x-te Irrsinnsdiskussion in Folge ist, sehen wir uns an – dann lachen wir zärtlich, umarmen uns und beschließen, uns zu trennen. Er geht nach oben, packt seine Sachen und zieht aus, möglichst in eine Wohnung nebenan. Später am selben Tag essen wir zusammen zu Abend, gemeinsam mit unseren neuen Lebenspartnern, die wir im Lauf des Nachmittags wunderbarerweise kennengelernt haben, und alle verstehen sich prächtig und necken einander liebevoll.
Aber jetzt erkenne ich, wie fantastisch diese Fantasie wirklich ist; ich beginne schon zu ahnen, dass aus den sentimentalen Abenden über alten Fotos nichts werden wird. Es ist sogar sehr viel wahrscheinlicher, dass die Fotos mitten durchgeschnitten werden – wie ich David kenne, ist das bereits geschehen, gestern Abend, kurz nach unserem Telefonat. Nach kurzer Überlegung ist es eigentlich klar: wenn man sich so hasst, dass man nicht mehr im selben Haus leben kann, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man später zusammen Campingurlaub machen möchte. Das Dumme an meiner Fantasie war, dass sie direkt von der glücklichen Hochzeit zur glücklichen Trennung schaltete – aber zwischen Hochzeiten und Trennungen passieren nun mal unglückliche Dinge.
Ich steige ins Auto, setze die Kinder ab, fahre nach Haus. David ist bereits in seinem Arbeitszimmer und hat die Tür geschlossen. Heute ist kein Kolumnentag, also schreibt er wahrscheinlich entweder an einem Firmenprospekt, an dem er Unsummen verdient, oder an seinem Roman, an dem er gar nichts verdient. Er wendet mehr Zeit für seinen Roman als für die Prospekte auf, was nur dann Anlass zu Streitereien gibt, wenn es schlecht zwischen uns steht; wenn wir uns verstehen, möchte ich ihn unterstützen, für ihn sorgen, ihm helfen, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn nicht, will ich seinen saublöden Roman in Fetzen reißen und ihn zwingen, sich einen vernünftigen Job zu suchen. Ich habe vor einiger Zeit ein bisschen in dem Roman gelesen und fand ihn grauenvoll. Er heißt »Green Keepers« und ist eine Satire auf die englische Post-Diana-Kultur der neuen Empfindsamkeit. Der letzte Abschnitt, den ich las, handelte davon, wie die gesamte Belegschaft von »The Green Keepers«, einer Firma, die Bananen-Ellbogencreme und Brie-Fußlotion und ähnlich amüsant nutzlose Kosmetika verkauft, Hilfe in einer Trauergruppe sucht, als der Esel, den sie adoptiert hat, stirbt.
Es stimmt, ich bin in keinster Weise zur Literaturkritikerin qualifiziert, nicht zuletzt deshalb, weil ich keine Bücher mehr lese. Das habe ich mal getan, früher, als ich ein anderer, glücklicherer, engagierterer Mensch war, aber jetzt schlafe ich jeden Abend mit »Corellis Mandoline« auf der Brust ein, einem Buch, über dessen erstes Kapitel ich immer noch nicht hinaus bin, obwohl ich mich seit sechs Monaten damit abmühe. (Das liegt übrigens nicht am Autor, und ich bin sicher, das Buch ist bis ins Kleinste so genial, wie meine Freundin Becca mir gesagt hat. Es liegt an meinen Augenlidern.) Und trotzdem, obwohl ich längst keine Ahnung mehr habe, was passable Literatur ausmacht, weiß ich, dass »Green Keepers« ein schreckliches Buch ist: mokant, ungnädig, selbstgerecht. Ziemlich genau wie David, beziehungsweise wie der David, der in den letzten Jahren zum Vorschein gekommen ist.
Am Tag, nachdem ich es gelesen hatte, behandelte ich eine Frau, deren Baby im Mutterleib gestorben war; sie musste durch die Geburtswehen, obwohl sie wusste, dass es eine Totgeburt würde. Natürlich riet ich ihr, sich einer Trauergruppe anzuschließen, und natürlich dachte ich dabei an David und sein gehässiges Buch, und natürlich zog ich eine bittere Befriedigung daraus, ihm, als ich nach Hause kam, zu sagen, dass wir nur deswegen jeden Monat pünktlich unsere Raten zahlen könnten, weil ich mein Geld damit verdiente, genau die Dinge zu empfehlen, die er so verächtlich fand. Das war auch so ein reizender Abend gewesen.
Wenn die Tür zu Davids Arbeitszimmer geschlossen ist, bedeutet das, er darf nicht gestört werden, selbst wenn seine Frau ihn um die Scheidung gebeten hat. (Zumindest vermute ich das – es ist nicht so, dass wir für diesen speziellen Fall eine Abmachung getroffen hätten.)
Ich mache mir noch eine Tasse Tee, nehme den Guardian vom Küchentisch und gehe wieder zurück ins Bett.
Ich finde in der Zeitung nur einen Artikel, der mir lesenswert erscheint: eine verheiratete Frau hat Ärger, weil sie einem fremden Mann in der Club Class eines Flugzeugs einen geblasen hat. Der Mann, auch verheiratet, hat ebenfalls Ärger, aber mich interessiert die Frau. Bin ich so? Nicht nach außen, nicht für die Welt, das nicht, aber in Gedanken. Irgendwie habe ich jede Orientierung verloren, und das finde ich beängstigend. Ich kenne Stephen, natürlich kenne ich Stephen, aber wenn man seit zwanzig Jahren verheiratet ist, erscheint einem jeder sexuelle Kontakt mit einem anderen schamlos, ausschweifend, fast schon vertiert. Auf einer Ärztetagung einen Mann kennenzulernen, mit ihm etwas trinken zu gehen, mit ihm noch mal etwas trinken zu gehen, sich mit ihm zum Abendessen zu verabreden und ihn nachher zu küssen, und schließlich zu arrangieren, nach einer Konferenz in Leeds mit ihm zu schlafen … Das ist mein Äquivalent dazu, mich vor den Passagieren eines vollbesetzten Flugzeugs bis auf BH und Slip auszuziehen und eine »sexuelle Handlung«, wie es in den Zeitungen heißt, an einem Wildfremden vorzunehmen. Ich schlafe umgeben vonseiten des Guardian ein und habe Träume, die sexuell, aber keineswegs erotisch gefärbt sind, Träume, in denen alle möglichen Leute etwas mit anderen Leuten anstellen, wie in der Höllenvision eines Künstlers.
Als ich aufwache, ist David in der Küche und macht sich ein Sandwich.
»Hallo«, sagt er und deutet mit dem Messer auf das Brotschneidebrett. »Auch eins?« Irgendetwas an der entspannten Häuslichkeit dieses Angebots treibt mir die Tränen in die Augen. Scheidung bedeutet, nie mehr ein Sandwich gemacht zu bekommen – jedenfalls nicht von seinem Exehemann. (Ist das wirklich wahr oder nur sentimentales Geschwafel? Ist es unvorstellbar, dass David mir irgendwann in Zukunft einmal anbieten wird, mir eine Scheibe Käse zwischen zwei Brotscheiben zu legen? Ich sehe David und komme zu dem Schluss, ja, es ist unvorstellbar. Wenn David und ich geschieden sind, wird er für den Rest seines Lebens zornig sein – nicht, weil er mich liebt, sondern weil das genau seine Art ist. Ich kann mir noch gerade eben eine Situation vorstellen, in der er mich nicht überfahren würde, wenn ich die Straße überquere – zum Beispiel wenn Molly müde ist und ich sie trage –, aber es ist schwer vorstellbar, dass er jemals einen schlichten Akt der Freundlichkeit anbieten würde.)
»Nein danke.«
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher.«
»Wie du willst.«
Das passt schon eher. Ein leicht pikierter Unterton hat sich eingeschlichen, als seien seine unermüdlichen Bemühungen, Love not War zu machen, auf fortgesetzte Feindseligkeit gestoßen.
»Willst du drüber reden?«
Er zuckt die Achseln: »Ja. Über was?«
»Na ja. Über gestern. Was ich am Telefon gesagt habe.«
»Was hast du am Telefon gesagt?«
»Ich sagte, dass ich mich scheiden lassen will.«
»Tatsächlich. Mannomann. Nicht sehr nett, oder? Nicht sehr nett von einer Frau, so was zu ihrem Mann zu sagen.«
»Bitte lass das.«
»Was erwartest du von mir?«
»Dass du vernünftig mit mir redest.«
»Okay. Du willst die Scheidung, ich nicht. Und das bedeutet, solange du nicht beweisen kannst, dass ich gewalttätig oder gefühlskalt oder was weiß ich bin oder dass ich mit einer anderen gebumst habe, musst du ausziehen und kannst dann, wenn du fünf Jahre lang woanders gelebt hast, deine Scheidung haben. Wenn ich du wäre, würde ich bald in die Gänge kommen. Fünf Jahre sind eine lange Zeit. So was sollte man nicht aufschieben.«
Natürlich hatte ich an das alles noch nicht gedacht. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, es würde reichen, die Worte auszusprechen; schon allein den Wunsch zu äußern, sei Beweis genug, dass meine Ehe nicht funktionierte.
»Was wäre, wenn ich … du weißt schon.«
»Nein, weiß ich nicht.«
Ich bin auf das alles nicht vorbereitet. Es scheint wie von selbst herauszukommen.
»Ehebruch.«
»Du? Meine kleine Betschwester?« Er lacht. »Zuerst musst du mal einen finden, der mit dir ehebrechen will. Dann musst du aufhören, Dr. Katie Carr, Mutter von zwei Kindern zu sein, und mit ihm ehebrechen. Und selbst dann wäre es egal, weil ich mich trotzdem nicht von dir scheiden lasse. So.«
Ich schwanke zwischen Erleichterung – ich bin gerade eben noch von dem Abgrund zurückgetreten, dem Geständnis, nach dem es kein Zurück gegeben hätte – und Empörung. Er glaubt, ich hätte nicht den Nerv, das zu machen, was ich gestern Nacht gemacht habe! Und was noch schlimmer ist, er glaubt, ich würde sowieso keinen finden, der es mit mir machen würde! Natürlich überwiegt die Erleichterung. Meine Feigheit wiegt schwerer als seine Beleidigung.
»Du willst also das, was ich gestern gesagt habe, einfach ignorieren?«
»Ja. Ich glaub schon. Alles Schwachsinn.«
»Bist du glücklich?«
»Ach du lieber Himmel.«
Es gibt eine bestimmte Gruppe Menschen, die auf die grundlegendsten und drängendsten Fragen mit einer mittelschweren, ungeduldigen Gotteslästerung reagieren; David ist ein eingeschworenes Mitglied dieser Gruppe. »Was hat das denn damit zu tun?«
»Was ich gestern sagte, habe ich gesagt, weil ich nicht glücklich bin. Und ich glaube, du bist es auch nicht.«
»Scheiße, natürlich bin ich nicht glücklich. Bescheuerte Frage.«
»Warum nicht?«
»Aus den ganzen, beschissenen, üblichen Gründen.«
»Und zwar?«
»Dass meine blöde Frau mich um die Scheidung gebeten hat, zum Beispiel.«
»Mit meiner Frage wollte ich dir dabei helfen zu verstehen, warum deine blöde Frau dich um die Scheidung gebeten hat.«
»Was, du willst dich scheiden lassen, weil ich nicht glücklich bin?«
»Unter anderem, ja.«
»Wie großherzig von dir.«
»Ich bin nicht großherzig. Ich hasse es, mit jemandem zusammenzuleben, der so unglücklich ist.«
»Pech.«
»Nein. Kein Pech. Ich kann was daran ändern. Ich kann nicht mit jemand zusammenleben, der so unglücklich ist. Du machst mich rasend.«
»Ach, Scheiße, mach doch, was du willst.«
Und dann kehrt er mit dem Sandwich zu seinem satirischen Roman zurück.
Wir sind dreizehn Leute hier in der Gemeinschaftspraxis, fünf Allgemeinmediziner und dann all die anderen, die den Laden am Laufen halten – ein Manager, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Vollzeit- und Teilzeit-Sprechstundenhilfen. Ich komme so ziemlich mit allen gut aus, aber meine spezielle Freundin ist Becca, eine andere Allgemeinmedizinerin. Wenn es geht, essen Becca und ich zusammen zu Mittag, und einmal im Monat gehen wir eine Pizza essen und was trinken, und sie weiß mehr über mich als jeder andere in der Praxis. Becca und ich sind grundverschieden. Sie hat eine fröhlich-zynische Grundeinstellung zu unserer Arbeit und warum wir sie tun, sieht keinen Unterschied zwischen der Arbeit im medizinischen Bereich oder, zum Beispiel, in einer Werbeagentur und findet die moralische Befriedigung, die ich aus meiner Arbeit ziehe, zum Totlachen. Allerdings reden wir, wenn wir nicht über die Arbeit reden, meistens über sie. Oh, sie fragt mich immer nach Tom und Molly und David, und ich kann normalerweise mit einem Beispiel für Davids Unhöflichkeit aufwarten, das sie amüsiert, aber irgendwie gibt es über ihr Leben mehr zu erzählen. Sie sieht sich Sachen an, und sie macht Sachen, und ihr Liebesleben ist chaotisch genug, um Stoff für Geschichten mit zeitaufwendigen Verwicklungen und Wendungen zu liefern. Sie ist fünf Jahre jünger als ich und seit einer langwierigen und schmerzlichen Trennung von ihrem Uni-Freund Single. Heute Abend schwelgt sie in Verzweiflung wegen eines Kerls, mit dem sie sich im letzten Monat drei Mal getroffen hat: Sie glaubt nicht, dass irgendwas daraus wird, sie ist nicht sicher, ob sie zusammenpassen, auch wenn sie im Bett harmonieren … Normalerweise fühle ich mich alt und bin brennend interessiert, wenn sie über solche Dinge spricht – geschmeichelt, weil ich ins Vertrauen gezogen werde –, genieße den Nervenkitzel der ganzen Trennungen und Neubekanntschaften aus zweiter Hand und bin sogar unterschwellig eifersüchtig auf die marternde Einsamkeit, die Becca in periodischen Intervallen durchleidet, wenn gerade nichts anliegt. Das alles erscheint mir als Indiz knisternden Lebens, einer elektrischen Aktivität in Kammern des Herzens, die bei mir schon vor langer Zeit stillgelegt wurden. Aber heute Abend langweilt es mich. Wen interessiert das? Triff dich mit ihm oder lass es, ist mir doch egal. Was hast du schon zu verlieren? Ich dagegen, eine verheiratete Frau, die einen Liebhaber hat …
»Na ja, wenn du nicht sicher bist, warum dann eine Entscheidung erzwingen? Warum arrangiert ihr euch nicht einfach eine Zeit lang?« Ich kann den gelangweilten Ton in meiner Stimme hören, aber ihr fällt er nicht auf. Ich langweile mich nicht, wenn ich mich mit Becca treffe. So ist das nicht abgemacht.
»Ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich mit ihm zusammen bin, kann ich mit niemand sonst zusammen sein. Ich mache Mit-ihm-Sachen anstatt Single-Sachen. Morgen Abend gehen wir zum Screen on the Green und sehen uns einen chinesischen Film an. Ich meine, dagegen ist nichts zu sagen, wenn man sich bei einem sicher ist. Dann macht man eben so was, oder? Aber wenn man sich nicht sicher ist, ist es bloß vertane Zeit. Ich meine, wen soll ich da schon kennenlernen, beim Screen on the Green? Im Dunkeln? Wo man nicht reden darf?«
Plötzlich überkommt mich das unstillbare Verlangen, mir beim Screen on the Green einen chinesischen Film anzusehen – je chinesischer, desto besser. Das ist auch so eine Kammer meines Herzens, die keine elektrische Aktivität erkennen lässt – die Kammer, die früher flimmernd zum Leben erwachte, wenn ich einen Film sah, der mich bewegte, oder ein Buch las, das mich inspirierte, oder Musik hörte, bei der ich hätte weinen können. Ich hatte diese Kammer selbst stillgelegt, aus den üblichen Gründen. Und ich scheine einen Pakt mit einem kulturlosen Teufel geschlossen zu haben: Wenn ich nicht versuche, sie wieder zu öffnen, wird mir gerade genug Energie und Optimismus zugeteilt, um einen Arbeitstag hinter mich zu bringen, ohne mich aufhängen zu wollen.
»Entschuldige. Das muss sich für dich alles furchtbar dumm anhören. Es hört sich für mich selbst dumm an. Hätte ich gewusst, dass ich mal eine von den Frauen werde, die mit verheirateten Freundinnen zusammenhocken und über ihr Leben als Single jammern, hätte ich mich erschossen. Wirklich. Ich höre damit auf. Auf der Stelle. Ich werde nie wieder davon reden.« Sie holt parodistisch tief Atem und redet dann weiter, noch ehe sie ausgeatmet hat.
»Aber er könnte ja okay sein, oder nicht? Ich meine, woher soll ich das wissen? Das ist das Problem. Ich hetze mich dermaßen ab, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob sie nett sind oder nicht. Das ist wie Heiligabend einkaufen gehen.«
»Ich habe eine Affäre.«
Becca lächelt geistesabwesend, hält kurz inne und redet weiter.
»Du knallst alles Mögliche in den Korb. Und nach Weihnachten …«
Sie beendet den Satz nicht, wahrscheinlich, weil sie einzusehen beginnt, dass ihre Analogie sie nicht weiterbringt und Männerbekanntschaften nichts mit Weihnachtseinkäufen gemein haben.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
Sie lächelt wieder. »Nein. Nicht so richtig.« Ich bin ein Geist geworden, einer von der komisch-hilflosen, unbedrohlichen Sorte, die man aus Kinderbüchern und alten Fernsehserien kennt. So laut ich auch brülle, Becca wird mich nie hören.
»Dein Bruder ist doch Single, oder?«
»Mein Bruder ist ein geringfügig beschäftigter Depressiver.«
»Ist das was Genetisches? Oder bloß die Umstände? Denn wenn es was Genetisches ist … das wäre ein Risiko. Allerdings erst später. Ich meine, Kinder sind ja eher selten depressiv, oder? So was kommt erst später. Und ich bin schon so alt, dass ich nicht mehr da sein werde, wenn sie depressive Erwachsene geworden sind. Tja. Vielleicht ist der Gedanke doch nicht schlecht. Wenn er will, bin ich dabei.«
»Ich geb’s weiter. Ja, ich glaube, er hätte auch gerne Kinder.«
»Gut. Ausgezeichnet.«
»Weißt du, was du nicht gehört hast?«
»Nein.«
»Als ich sagte, ›hast du mir zugehört‹, und du sagtest ›nein‹.«
»Nein.«
»Also …«
»Er ist in meinem Alter, oder? Mehr oder weniger?«
Und wir reden über meinen Bruder, seine Depressionen und seinen Mangel an Ehrgeiz, bis Becca jede Lust verloren hat, seine Kinder zu gebären.
Zwei
Ein paar Wochen lang geschieht gar nichts. Wir führen keine weiteren Gespräche; wir halten die Verabredungen ein, die wir bereits getroffen hatten, was bedeutet, Abendessen mit anderen Paaren mit Kindern, die grob geschätzt in derselben Einkommensklasse sind und aus der gleichen Ecke kommen wie wir. Stephen hinterlässt drei Nachrichten auf meinem Handy, und ich reagiere auf keine davon. Niemand hat mein Fehlen beim zweiten Tag der Ärztetagung in Leeds bemerkt. Ich bin ins Ehebett zurückgekehrt, und David und ich haben Sex, einfach, weil wir da sind und nebeneinanderliegen. (Der Unterschied zwischen Sex mit David und Sex mit Stephen ist wie der Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst. Bei Stephen ist alles Intuition und Fantasie und Erforschen und der Schock des Neuen, und das Ergebnis ist … ungewiss, falls ihr mich versteht. Es fasziniert mich, aber ich bin nicht unbedingt sicher, was es zu bedeuten hat. David hingegen drückt einen Knopf, dann einen anderen Knopf, und zack! Es tut sich was. Es ist so romantisch wie einen Aufzug zu bedienen – aber auch genauso praktisch.)
Wir, die wir in dieser Einkommensklasse sind und aus derselben Ecke kommen, haben größtes Vertrauen in die Macht der Worte: Wir lesen, wir reden, wir schreiben, wir haben Therapeuten und Berater und sogar Priester, die nichts lieber tun, als uns zuzuhören und zu sagen, was wir tun sollen. Daher ist es so etwas wie ein Schock für mich, dass meine Worte, bedeutsame Worte, wie mir in dem Moment schien, Worte, die mein Leben hätten verändern müssen, nicht mehr als Seifenblasen waren: David wedelte sie weg und sie zerplatzten, und nichts lässt darauf schließen, dass es sie je gegeben hat.
Also was nun? Was geschieht, wenn Worte uns nicht weiterhelfen? Würde ich ein anderes Leben in einer anderen Welt leben, einer Welt, in der Taten mehr zählen als Worte und Gefühle, würde ich irgendwas tun, irgendwohin gehen, vielleicht sogar irgendwen schlagen. Aber David weiß, dass ich nicht in der Welt lebe, und hat meinen Bluff durchschaut; er hält sich einfach nicht an die Regeln. Einmal hatten wir Tom zu so einem Totschieß-Spiel auf der Kirmes mitgenommen; man musste einen elektronischen Rucksack anziehen, und wenn man getroffen war, machte er ein Geräusch und man war tot. Man konnte natürlich einfach den Biep ignorieren und weiterspielen, wenn man ein ganz anarchistischer Spielverderber sein wollte, schließlich ist ein Biep ja nur ein Biep. Und wie sich herausstellte, hatte ich genau das getan, als ich David um die Scheidung bat. Ich habe ein biependes Geräusch gemacht, das David nicht zur Kenntnis nimmt.
Es fühlt sich ungefähr so an: Du betrittst einen Raum und die Tür schließt sich hinter dir, und zuerst gerätst du in Panik und suchst nach einem Schlüssel, einem Fenster oder sonst irgendwas, und als dir dann klar wird, dass es keinen Weg hinaus gibt, versuchst du, das Beste aus dem zu machen, was du hast. Du probierst den Stuhl aus, und er ist gar nicht mal unbequem, und da sind ein Fernseher und ein paar Bücher, und ein gut gefüllter Kühlschrank ist auch da. Ihr wisst schon, es gibt Schlimmeres. Und dass ich ihn um die Scheidung gebeten habe, war die Panik, aber ich komme schon bald in das Stadium, in dem ich mich umschaue und sehe, was ich habe. Und was ich habe, stellt sich heraus als zwei wunderbare Kinder, ein hübsches Haus, einen guten Job, einen Mann, der mich nicht schlägt und im Aufzug die richtigen Knöpfe drückt … das kann ich aushalten, denke ich. Ich kann so ein Leben führen.
Eines Samstagabends gehen David und ich mit Giles und Christine essen, Freunden von uns, die wir seit dem College kennen, und David und ich vertragen uns, es ist ein nettes Restaurant, ein altmodischer Italiener in Chalk Farm, wo es Grissini und Wein in Korbflaschen und wirklich gutes Kalbfleisch gibt (und falls wir uns darauf geeinigt haben, dass Ärzte, solange sie nicht ausgesprochene Dr.-Death-Typen sind, die kleine Kinder und alte Menschen totspritzen, einfach keine schlechten Menschen sein können, dann ist mir doch wohl ein bisschen Kalbfleisch von Zeit zu Zeit vergönnt); und irgendwann nach der Hälfte des Abends, David ist gerade mitten in einer seiner Zornigster-Mann-von-Holloway-Tiraden (falls es wen interessiert: eine wüste Hetzrede gegen die Entscheidungsprozesse bei Madame Tussaud’s), fällt mir auf, dass Giles und Christine sich vor Lachen krümmen. Und sie lachen noch nicht mal über David, sondern mit ihm. Und obwohl ich Davids Tiraden, seinen wie es scheint unstillbaren und allumfassenden Zorn satthabe, sehe ich plötzlich, dass er über die Gabe verfügt, andere Menschen zu erheitern, und ich empfinde freundliche, beinahe warme Gefühle für ihn, und als wir nach Hause kommen, gönnen wir uns noch eine Runde Knöpfedrücken.
Und am nächsten Morgen gehen wir mit Molly und Tom ins Spaßbad, und Molly wird von einer der mickrigen Wellen umgeworfen, die die Wellenmaschine erzeugt, und verschwindet unter zwanzig Zentimetern Wasser, und wir alle vier, sogar David, müssen kichern, und in dem Moment, als wir uns wieder einkriegen, erkenne ich plötzlich, was für eine furchtbare Meckerziege ich geworden bin. Das ist keine sentimentale Anwandlung: mir ist durchaus bewusst, dass diese Momentaufnahme von der glücklichen Familie genau das ist, eine Momentaufnahme, und ein ungeschnittenes Video noch mehr festgehalten hätte, eine Trotzreaktion von Tom, noch bevor wir im Schwimmbad ankamen (hasst es, mit uns schwimmen zu gehen, wollte lieber zu Jamie), und eine Suada von David nach dem Schwimmen (ich erlaube den Kindern nicht, sich am Automaten Chips zu ziehen, weil wir direkt zum Mittagessen nach Hause fahren; David kann sich nicht verkneifen, mir vorzuhalten, ich sei das lebende Beispiel für den blairistischen Bevormundungsstaat). Ich will damit nicht sagen, dass mein Leben ein einziger langer Sommer ist und ich nur zu selbstbezogen bin, um es zu bemerken (obwohl es durchaus so sein könnte, und ich nur zu selbstbezogen bin, um es zu merken), sondern dass glückliche Momente möglich sind, und solange glückliche Momente möglich sind, habe ich kein Recht, mehr zu verlangen, wenn man den verheerenden Schaden bedenkt, den ich damit anrichten könnte.
An diesem Abend habe ich einen wüsten Streit mit David, und am nächsten Tag taucht Stephen bei der Arbeit auf, und plötzlich habe ich mir das halb volle Glas über die Bluse gekippt.
Der Streit ist eigentlich nicht der Rede wert: Es ist bloß ein Streit zwischen zwei Leuten, die einander nicht gern genug haben, um nicht zu streiten. Es beginnt mit irgendwas wegen einer Plastiktüte, die ein Loch hatte (ich wusste nicht, dass sie ein Loch hatte, und sagte David, er solle sie nehmen, um … Ach, was soll’s); es endet damit, dass ich David sage, er wäre ein talentloser und gemeiner Drecksack, und er mir sagt, er könne meine Stimme nicht mehr hören, ohne kotzen zu müssen. Die Sache mit Stephen ist wesentlich ernster. Am Montagmorgen ist Sprechstunde ohne Termin, und ich bin gerade mit einem Knaben fertig, der plötzlich auf die Idee verfallen ist, er hätte Afterkrebs. (Hat er nicht. Er hat einen Furunkel – die Folge einer etwas unbekümmerten Einstellung zur Körperhygiene, könnte ich mir vorstellen, aber ich will allen weitere Details ersparen.) Und als ich zum Empfang gehe, um das nächste Krankenblatt zu holen, sehe ich Stephen im Wartebereich sitzen, den Arm in einer unverkennbar selbst gebundenen Schlinge.
Eva, unsere Sprechstundenhilfe, lehnt sich über das Pult und beginnt zu flüstern.
»Der Typ mit der Schlinge. Er sagt, er ist gerade erst in die Gegend gezogen, und er hat keine Meldebestätigung und keine Versicherungskarte und will nur mit Ihnen sprechen. Sagt, jemand hätte Sie ihm empfohlen. Soll ich ihn zum Teufel schicken?«
»Nein, ist schon gut. Ich nehme ihn sofort dran. Wie heißt er?«
»Mmmm …« Sie schaut auf den Notizblock, der vor ihr liegt. »Stephen Garner.«
Das ist sein richtiger Name, obwohl ich ja nicht wissen konnte, dass er ihn benutzen würde. Ich sehe zu ihm hin.
»Stephen Garner?«
Er springt auf. »Ja, hier.«
»Kommen Sie bitte mit durch?«
Als ich durch den Flur gehe, entgeht mir nicht, dass sich mehrere Leute im Wartezimmer drohend an Eva wenden, um sich über Mr Garners Vordrängen zu beschweren. Ich fühle mich schuldig und möchte mich außer Hörweite begeben, aber wir kommen nur langsam voran zum Sprechzimmer, weil Stephen, mit offensichtlichem Vergnügen, auch noch ein Hinken vortäuscht. Ich schiebe ihn ins Zimmer, und er setzt sich breit grinsend hin.
»Was fällt dir eigentlich ein?«, frage ich ihn.
»Wie sollte ich dich sonst wiedersehen?«
»Nein, verstehst du, das war die Botschaft, die ich damit rüberbringen wollte, dass ich dich nicht zurückgerufen habe. Ich will dich nicht sehen. Fertig. Aus. Ich habe einen Fehler gemacht.«
Ich klinge wie ich selbst, kühl und etwas widerborstig, aber ich fühle mich nicht wie ich. Ich bin ängstlich, nervös, und ich fühle mich viel jünger, als ich bin, und die Halbwüchsige, die sich da herausschält, ertappt sich dabei, dass sie fragt, ob Eva wohl bemerkt hat, wie attraktiv Mr Garner ist. (Ich wünsche mir, dass sie heute irgendwann sagt: »Hast du den Typ mit der Armschlinge gesehen? Woooow!« Und ich könnte mich gerade noch zurückhalten, etwas Selbstgefälliges darauf zu sagen.)
»Können wir irgendwo eine Tasse Kaffee trinken gehen und darüber reden?«
Stephen ist Pressesprecher einer Interessengruppe, die sich für politische Flüchtlinge einsetzt. Er macht sich solche Sorgen über das Asylrecht und den Kosovo und Ost-Timor, dass er manchmal nachts nicht schlafen kann, wie er mir gestanden hat. Er ist, wie ich, ein guter Mensch. Aber in einer Arztpraxis aufzutauchen und eine Verletzung vorzutäuschen, um eine der Ärztinnen zu belästigen … Das ist nicht gut. Das ist böse. Ich bin verwirrt.
»Ich habe da draußen ein Wartezimmer voll Patienten. Im Gegensatz zu dir geht es ihnen allen ausnahmslos nicht sehr gut. Ich kann mich nicht einfach in die Kaffeepause verdrücken, wenn ich Lust habe.«
»Gefällt dir meine Schlinge?«
»Bitte geh wieder.«
»Sobald du mir gesagt hast, wann wir uns treffen können. Warum bis du mitten in der Nacht aus dem Hotel verschwunden?«
»Ich hatte ein ungutes Gefühl.«
»Weswegen?«
»Mit dir zu schlafen, obwohl ich einen Mann und zwei Kinder habe, wahrscheinlich.«
»Oh. Deshalb.«
»Ja. Deshalb.«
»Ich gehe nicht weg, bis wir uns verabredet haben.«
Der Grund dafür, dass ich ihn nicht rausschmeißen lasse, ist, dass ich das alles eigenartig prickelnd finde. Vor ein paar Wochen, ehe ich Stephen kennenlernte, gehörte ich nicht zu den Frauen, die Männer dazu bringen, Verletzungen vorzutäuschen, nur um sich ein paar kostbare Sekunden zu erschleichen. Ich meine, ich sehe absolut präsentabel aus, und ich weiß, dass ich, wenn ich mir Mühe gebe, meinem Ehemann eine gewisse mürrische Bewunderung abringen kann, aber bis heute mache ich mir keine Illusionen über mein Talent, im anderen Geschlecht rasendes Verlangen zu wecken. Ich war Mollys Mama, Davids Frau, die Ärztin um die Ecke; ich war zwei Jahrzehnte lang monogam. Das heißt nicht, dass ich asexuell wäre, denn ich hatte Sex, aber Sex mit David, und Anziehungskraft und der ganze Rest haben nichts mehr damit zu tun: wir schlafen miteinander, weil wir uns geeinigt haben, nicht mehr mit anderen zu schlafen, nicht, weil wir die Hände nicht voneinander lassen können.
Und jetzt, wo Stephen bettelnd vor mir steht, kann ich mich eines winzigen Anflugs von Eitelkeit nicht erwehren. Eitelkeit! Ich sehe mich zufällig im Spiegel in meinem Sprechzimmer, und einen Moment lang, nur für eine Sekunde, kann ich sehen, warum sich jemand die Mühe macht, seinen Arm in eine Schlinge zu stecken. Immerhin