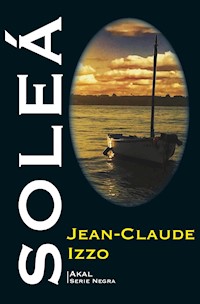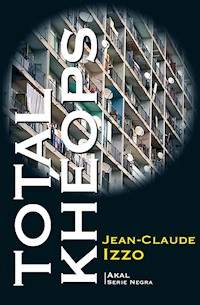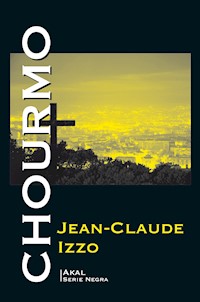11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Im Hafen von Marseille steht die Zeit still. Die Aldebaran liegt fest, der Reeder ist Konkurs gegangen. An Bord drei Männer. Sie leisten Widerstand, wollen sich nicht damit abfinden, den Frachter zu verlassen. Wohin sollen sie auch gehen? Während sie ohne wirkliche Hoffnung darauf warten, wieder auslaufen zu können, beginnen sie zu reden, diese Seemänner, die sich ans Schweigen gewöhnt haben. Sie reden um ihr Leben, erzählen sich ihre Vergangenheit, Geschichten von Frauen, die auf sie warten oder die sie verloren haben, von Kindern, die sie nicht haben aufwachsen sehen, von Ländern, die sie nicht vergessen können. Um sie herum Marseille, Stadt des Exils, Schmelztiegel. In dieser Stadt voller Erinnerungen suchen die drei Männer ihre Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Ähnliche
Über dieses Buch
Im Hafen von Marseille liegt die Aldebaran fest, der Reeder ist Konkurs gegangen. Die letzten drei Männer an Bord warten ohne wirkliche Hoffnung darauf, wieder auslaufen zu können. Sie erzählen von ihrer Vergangenheit, von Liebe und Liebschaften, auf der Suche nach einer Zukunft in einer Stadt voller Erinnerungen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jean-Claude Izzo (1945–2000) war lange Journalist. Sein erster Roman Total Cheops, 1995 veröffentlicht, wurde sofort zum Bestseller, seine Marseille-Trilogie zählt inzwischen zu den großen Werken der internationalen Kriminalliteratur.
Zur Webseite von Jean-Claude Izzo.
Ronald Voullié (*1952) ist seit vielen Jahren Übersetzer »postmoderner« Philosophen wie Baudrillard, Deleuze, Guattari, Lyotard oder Klossowski. In den letzten Jahren kamen auch Übersetzungen von Kriminalromanen hinzu.
Zur Webseite von Ronald Voullié.
Katarina Grän (*1960) studierte Romanistik und Slawistik. Sie unternahm längere Reisen durch die USA und die Sowjetunion und absolvierte eine Ausbildung zur Rundfunkjournalistin. Sie ist als Krimiautorin und Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Katarina Grän.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jean-Claude Izzo
Aldebaran
Roman
Aus dem Französischen von Katarina Grän und Ronald Voullié
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Les marins perdus bei Flammarion, Paris.
Die Übersetzung aus dem Französischen wurde unterstützt durch das Centre national du livre des Französischen Kulturministeriums.
Originaltitel: Les Marins perdus (1997)
© by Flammarion 1997
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30401-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 02.06.2022, 18:34h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ALDEBARAN
1 — Ein grauer Morgen, Bésame mucho pfeifend2 — Nachts sind wir von aller Welt verlassen3 — Wir schwimmen nicht im Überfluss, aber am Hungertuch nagen wir auch nicht4 — Die Mädchen vom Blauen Papagei5 — Erinnerungen, die den Schiffbruch ankündigen6 — Wie ein Glas Rum, in einem Zug hinuntergestürzt7 — Auf Regen folgt schönes Wetter, aber die Tränen bleiben8 — Einige nicht wieder gutzumachende Fehler9 — Gegen Zynismus ist keiner gefeit10 — Das einfache Glück, das vom Himmel auf das Meer hinabsteigt11 — Es ist nicht einfach, das Wahrscheinliche mit dem Unwahrscheinlichen in Einklang zu bringen12 — Wer weiß morgen noch, auf welcher Insel Kalypso Odysseus verführte?13 — Die Geschichte vom Mädchen, das die Vazaha suchte14 — Man hat nur das im Leben: das Leben selbst15 — Auf der Aldebaran wird auch Domino gespielt16 — Ti sento addosso e non ci sei17 — Noch weit entfernt vom Tor der Glückseligkeit18 — Ein Wort ist manchmal leider ein Wort19 — Hauptsache, man kommt ohne Schaden davon20 — Ein Rendezvous, Furcht einflößend, ausweglos21 — Wozu nützt die Wahrheit? Das ist hier die Frage22 — Das Mittelmeer, ein Meer, das uns zum Narren hält23 — Man kann dem Ärger nicht entrinnen, wenn er einen antreibt24 — Jeder trägt ein Stück Unglück in sich25 — Brütende Hitze erstickt jeden Laut, alles keimt, stirbt, modert und fault …26 — Und wie jetzt den Schlusspunkt setzen? Das ist hier die Frage27 — Das Gewesene bestimmt das SeinEpilog — Mittag in Marseille, und das Leben geht weiterMehr über dieses Buch
Über Jean-Claude Izzo
Jean-Claude Izzo: Einige Zitate über über Izzo, Marseille, Schreiben und Essen
Alexandra Schwartzbrod: Begegnung am Ende der Trilogie
Über Ronald Voullié
Über Katarina Grän
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jean-Claude Izzo
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Meer
Für Laurence
Der ewige Wanderer hat kein Recht auf Heimkehr.
Michel Saunier
1
Ein grauer Morgen, Bésame mucho pfeifend
Marseille trug an diesem Morgen die Farben der Nordsee. Diamantis stürzte in der verlassenen Messe einen hastig gebrühten Nescafé hinunter, dann stieg er aufs Deck hinab, Bésame mucho pfeifend, die Melodie, die ihm am häufigsten in den Kopf kam. Genau genommen die einzige, die er pfeifen konnte. Er zog eine Camel aus einer zerknitterten Schachtel, steckte sie an und lehnte sich an die Reling. Diamantis störte dieses Wetter nicht. Heute jedenfalls nicht. Seine Stimmung war schon seit dem Aufstehen trübe.
Er ließ seinen Blick über das Meer schweifen, weit hinaus, als ob er so den Moment hinausschieben könnte, in dem er wie jeder von der Besatzung der Aldebaran eine Entscheidung treffen musste. Entscheiden war nicht seine Stärke. Seit fünfundzwanzig Jahren ließ er sich vom Leben treiben. Von einem Frachter zum nächsten. Von einem Hafen in den anderen.
Ein Gewitter zog auf, und die Frioul-Inseln in der Ferne waren nur noch ein dunkler Fleck. Man konnte kaum den Horizont erkennen. Ein wahrhaft aussichtsloser Tag, dachte Diamantis. Ohne sich einzugestehen, dass die letzten Tage nicht anders gewesen waren. Fünf Monate lagen sie nun schon an der Kette, die Seeleute von der Aldebaran, ans äußerste Ende des sechs Kilometer langen Digue du Large verbannt. Weit weg von allem. Nichts zu tun. Und ohne Geld. In Erwartung eines Käufers für diesen elenden Frachter – aber niemand wusste, ob je ein Käufer auftauchen würde.
Die Aldebaran war am 22. Januar in Marseille eingelaufen. Aus La Spezia in Italien, um zweitausend Tonnen Mehl für Mauretanien aufzunehmen. Alles hatte geklappt, doch drei Stunden später legte das Handelsgericht das Schiff an die Kette. Als Sicherheit für Schulden ihres Reeders. Constantin Takis, ein Zypriote. Seitdem war er wie vom Erdboden verschluckt. »Verdammter Hurensohn«, hatte Abdul Aziz, Kapitän der Aldebaran, nur gesagt und den Gerichtsbescheid angewidert an seinen Ersten Offizier Diamantis weitergereicht.
In den ersten Wochen hatten sie noch geglaubt, dass die Sache sich schnell aufklären würde. Seeleuten fehlt es nicht an Hoffnung. Im Gegenteil, die Hoffnung hält sie am Leben. Wer auch nur einmal in seinem Leben zur See gefahren ist, weiß das nur zu gut. Um den Tatsachen nicht ins Gesicht sehen zu müssen, taten Abdul Aziz, Diamantis und die sieben Männer der Besatzung jeden Tag so, als würden sie am nächsten Morgen auslaufen. Maschinen warten, Deck schrubben, elektrische Anlagen überprüfen, Kommandobrücke kontrollieren.
Das Leben an Bord musste weitergehen. Das war die Hauptsache.
Abdul Aziz bewies seinen Männern, dass er bei den Plackereien an Land ein ebenso guter Kapitän war wie auf hoher See. Um die Aldebaran bildete sich – ohne Zweifel dank seines Organisationstalents – schnell eine Welle der Solidarität. Armenküchen lieferten Nahrung und Getränke. Löschboote versorgten sie mit Trinkwasser. Die Hafenverwaltung sorgte für die Müllabfuhr und die Reinigung der Wäsche. Und – welche Erleichterung – seit dem dritten Monat schickte die Seemannsmission den Not leidenden Familien Geld.
»Ein Glück, dass wir hier festsitzen«, hatte Abdul gesagt. »Woanders hätten wir krepieren können. Du siehst, Diamantis, ich mag diese Stadt.«
Auch Diamantis liebte Marseille. Schon bei seinem ersten Landgang hatte er sich in die Stadt verliebt. Er war knapp zwanzig gewesen. Schiffsjunge an Bord des Trampschiffes Ecuador, eines alten, verrosteten Frachters, der nie über Gibraltar hinausgekommen war. Diamantis konnte sich gut an jenen Tag erinnern. Die Ecuador war um die Riou-Inselgruppe herumgefahren und dann, hinter den Frioul-Inseln, hatte sich die Reede vor seinen Augen aufgetan. Wie ein Streifen aus weiß-rosa Licht, der das Blau des Himmels vom Blau des Meeres trennte. Wie eine Erleuchtung. Marseille, hatte er damals gedacht, ist eine Frau, die sich denen anbietet, die vom Meer kommen. Er hatte das sogar in seinem Bordbuch notiert. Ohne zu wissen, dass er damit den Gründungsmythos der Stadt ausdrückte. Die Geschichte von Gyptis, jener ligurischen Prinzessin, die sich Protis, dem phokäischen Seemann, in der Nacht hingab, in der er in den Hafen einlief. Seitdem hatte Diamantis seine Landgänge nicht mehr gezählt.
Aber jetzt war alles anders. Sie waren in Marseille gestrandet – verlorene Seeleute. Diamantis hatte das am Ende des ersten Monats begriffen. Als man sie aufforderte, Mole D zu verlassen und an Liegeplatz 111 festzumachen, am Ende des Quai Wilson, am Digue du Large. Der Hafen wimmelte von solchen Geschichten. Die Partner hing in Rouen schon seit drei Jahren fest. Niemand wusste mehr, wem das Schiff gehörte; es wurde verkauft, wieder verkauft, weiterverkauft, ohne jemals seinen Platz zu verlassen. Mehr in ihrer Nähe, in Port-de-Bouc, lag die Africa, ein Massengutfrachter, seit achtzehn Monaten am Kai. Die Alcyon, ein Roll-on-Roll-off-Frachter, und die Fort-Desaix, ein Trampschiff, in Sète. Das hatte man Diamantis erzählt. Und Abdul Aziz natürlich auch.
All dies war den beiden Männern nicht unbekannt, als sie auf der Aldebaran anheuerten. Immer mehr Frachter ereilte in den Häfen dieses Schicksal, wenn sie irgendwelchen Reedern gehörten, die mit der Fracht Roulette spielten. Nur Containerschiffe und Öltanker von internationalen Flotten blieben verschont. Aber darüber sprachen Abdul Aziz und Diamantis nie. Aus Aberglauben. Die Aldebaran würde wieder auslaufen. Unter dem Kommando von Aziz. Da gab es keinen Zweifel. Mit fünfundfünfzig kam es für ihn nicht in Betracht, sein Schiff zu verlassen. Er hatte das Kommando auf der Aldebaran in La Spezia übernommen, und er würde sie ihrem Eigentümer zurückbringen. Ganz gleich, wer das war. Und egal, wohin. Das hatte er vorgestern Abend vor versammelter Mannschaft noch einmal bekräftigt.
In der Messe hatte er mit betont emotionsloser Stimme das Gerichtsurteil verlesen, das ihm am Nachmittag zugestellt worden war.
»Die Aldebaran wird beschlagnahmt als Sicherheit für die Schulden einer Gesellschaft, die sich nach Aussagen der Gläubiger im Besitz des Reeders befindet. Obgleich die Gesellschaft, zu der die Aldebaran gehört, rechtlich keine Verbindung zur verschuldeten Gesellschaft aufweist …«
Die Mannschaft hörte schweigend zu, ohne ein Wort von diesem juristischen Kauderwelsch zu verstehen. Der Rechtsanwalt, der ihnen von Amts wegen zugeteilt worden war, erklärte es ihnen Wort für Wort. Aber das war überflüssig. Jeder hatte das Wesentliche begriffen. Selbst die beiden Birmanen in der Besatzung. Es wird noch ein gutes Weilchen dauern, bis das Schiff wieder ausläuft.
»Nur wenn der Frachter verkauft wird, und obendrein zu besten Konditionen, könnt ihr ausbezahlt werden«, fiel Abdul dem Anwalt ins Wort, der gerade zu einem kunstvollen juristischen Höhenflug ansetzte. »Das heißt es. Und das kann morgen oder in sechs Monaten sein. Oder vielleicht in einem Jahr. Ich will nicht, dass ihr euch Illusionen macht. In Sète«, führte er aus, »sollte die Fort-Desaix, ein Frachter wie unserer, letzte Woche versteigert werden. Nicht ein Käufer hat sich sehen lassen … Das ist es, was ihr wissen müsst. Ich kenne eure familiären Probleme. Ich habe die gleichen. Also, ich halte niemanden zurück. Ich habe mich erkundigt. Für diejenigen, die gehen möchten, sind Abfindungen – wenn auch niedrige – möglich. Denkt darüber nach, und gebt mir morgen früh Bescheid. Ich bleibe. Mein Platz ist hier. Aber das wisst ihr ja alle.«
Er schaute jedem Einzelnen in die Augen, nur den Rechtsanwalt ließ er außen vor. Dann fügte er hinzu: »Es tut mir schrecklich Leid … das Ganze. Ich hätte euch keine Hoffnung machen dürfen. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir wieder auslaufen würden. Ich glaube immer noch daran, aber …« Er stand auf. Er wirkte erschöpft.
»Guten Abend, Freunde.«
Er verließ den Raum, den Blick in der Ferne verloren, mit zusammengepressten Lippen. Steif. Mit dem Stolz eines Verzweifelten.
Diamantis sah ihm nach. Er wusste, dass Abdul Aziz sich in seine Kabine zurückziehen wollte. Mit geschlossenen Augen in seiner Koje ausgestreckt würde er sich mit der Musik von Duke Ellington trösten. Er hatte sämtliche Stücke von ihm auf Kassetten, die er über einen Walkman hörte. Ein Geburtstagsgeschenk seiner Frau Céphée. Er war nicht wieder rausgekommen, nicht mal zum Essen. Die Geschichte machte ihn fertig. Abdul Aziz mochte keine Niederlagen.
Diamantis warf seine Kippe ins Wasser. Das offene Meer fehlte ihm. Das Landleben hatte ihn nie gereizt, nicht einmal in einem Hafen. Nach fast zwanzig Jahren Seefahrt war das Meer zu seiner zweiten Haut geworden. Dort, und nur dort, fühlte er sich frei. Da fühlte er sich weder tot noch lebendig, nur anderswo. Ein Anderswo, in dem er ein paar Gründe fand, er selbst zu sein. Das genügte ihm.
Er hatte sich nichts aufgebaut und hatte keine Familie mehr, keine Frau, die auf ihn wartete. Da war nur Mikis, sein Sohn, achtzehn dieses Jahr. Die Hälfte von dem, was Diamantis verdiente, war für ihn, um das Studium in Athen zu bezahlen. Mikis mochte die Literatur, und Diamantis stellte sich manchmal vor, dass sein Sohn schreiben und Romane von seinen Reisen erzählen würde. Aber in Wirklichkeit hatte Diamantis nur eine Angst: dass Mikis auch zur See fahren würde. In seiner Familie vererbte sich das seit Generationen.
»Ich bin mein ganzes Leben hinter meinem Vater hergelaufen«, erzählte er Abdul eines Abends. »Bis zu seinem Tod. Was sollte ich dann anders tun, als zur See zu fahren. Ohne sie konnte ich nicht mehr leben. Mein einziger Versuch, an Land festzumachen und sesshaft zu werden, war die Heirat mit Melina. Wir haben uns in Agios Nikolaos auf der Insel Psará niedergelassen, wo mein Vater ein Haus gekauft hatte. Aber was willst du auf einer Insel machen, die den Ziegen gehört? Wir haben ein Kind gemacht! Abends habe ich ihm Homer vorgelesen, um es in den Schlaf zu wiegen. Vier Jahre später ging ich wieder auf See. Melina ist nach Athen zurückgekehrt, zu ihrer Familie. Mit Mikis im Arm. Als ich zwei Jahre später wieder kam, hat sie mit der Scheidung auf mich gewartet. Ich bin eine Woche geblieben, dann bin ich wieder gegangen und habe nie mehr vorbeigeschaut. Es ist das erste Mal seit Mikis Geburt, dass ich so lange an Land bleibe.«
»Und wie fühlst du dich dabei?«
»Mir ist, als wüsste ich nicht mehr, wer ich bin. Und du?«, hatte Diamantis gefragt.
»Heute geht es mir wie dir. Es ist alles so unklar. Mein Leben. Céphée, die Kinder. All das. Ich frage mich, was ich überhaupt will in meinem Leben.«
Diese Antwort hatte Diamantis überrascht, so offen und direkt, auch so ungewöhnlich intim. Eigentlich hatte er nur wissen wollen, wie Abdul Seemann geworden war. Das erste Mal ist für einen Seemann so wichtig, wenn nicht wichtiger, wie das erste Mädchen, das er in seinem Bett gehabt hat. Dieselbe Angst. Derselbe Taumel. Und dass man diese Liebe, einmal aus dem Hafen ausgelaufen, nie wieder los wird. Das dachte Diamantis jedenfalls.
Die beiden Männer waren schon einige Male zusammen gefahren. Auf anderen Frachtern, für andere Reeder, aber immer in diesen Rollen. Aziz der Kapitän. Diamantis sein Erster Offizier. An diese Rangordnung hatten sie sich immer gehalten. Mit Vertrauen. Mit Respekt. Nie hatten sie über ihr Leben gesprochen. Über dieses Leben an Land, wo sie sich, wären sie sich begegnet, gewiss nicht viel zu sagen gehabt hätten. Nicht einmal auf der langen Fahrt nach Saigon vor sechs Jahren hatten sie viele Worte gewechselt. Wir werden langsam alt, hatte Diamantis damals gedacht.
Abdul hatte über Diamantis’ Erstaunen geschmunzelt. »Ich habe deine Frage nicht beantwortet, stimmts?«
»Doch, schon. Aber … Denk mal nach, Abdul … Nach all der Zeit. Was ist los mit uns? Werden wir verdammt noch mal sentimental, oder was?«
»Es kommt davon, dass wir so lange an Land sind … So lange. Das verändert uns. Das Meer ist nicht mehr zwischen uns. Und wir entdecken die Leere. Und die Angst, unterzugehen.«
»Hast du Angst?«
»Angst davor, hier zu enden, ja. Nicht mehr aufs Meer hinauszufahren, meine ich. Kein Schiff mehr zu haben.« Abdul versank in Schweigen.
Sie waren zwischen Winde und Ankerkette entlanggegangen, vorbei an den Ankerklüsen bis zur äußersten Spitze des Bugs. Abdul lehnte sich auf die Reling und betrachtete die Sterne. Schließlich zeigte er in den Himmel.
»Siehst du, der Stern dort, das ist Cepheus. Meine Frau, Céphée. Mein guter Stern. Hast du auch einen?«
»Ich bin ihnen allen gefolgt«, scherzte Diamantis. »Keiner hat es wirklich gut mit mir gemeint.«
»Ich bin durch Zufall Seemann geworden. In meiner Familie gibt es seit Generationen nur Händler. Eines Tages hat Walid, mein älterer Bruder – wir sind zwei Jungs und drei Mädchen –, Beirut verlassen, um in Dakar einen Laden aufzumachen. Es lief gut. Mein Vater hat mich hingeschickt, um zu helfen. Ich war dreiundzwanzig und fuhr zum ersten Mal über das Meer. Das war auf der Espérance. Ein Postschiff, das bis zum Krieg nach Neukaledonien gefahren war. Die Espérance, Hoffnung, du verstehst, was ich meine!
Ich hab die ganze Reise fast nur auf dem Deck verbracht. So irre war das. Liebe auf den ersten Blick, wenn du so willst! In Dakar, stell dir vor, hab ich mich gelangweilt wie eine tote Ratte. Sowie ich nur konnte, bin ich zum Hafen gelaufen, um die Schiffe anzuschauen. Und was für Schiffe ich da gesehen habe! Bald hab ich mich mit einem Typ in meinem Alter angefreundet, Mamoudi. Sein Vater arbeitete für eine amerikanische Reederei, die European Pacific and Co. Er hat mich ihm vorgestellt. Zehn Tage später heuerte ich nach Botany Bay an, dem Hafen von Sydney. Auf der Columbia Star.«
Sie hatten ihr Gespräch spät abends auf der Terrasse von Chez Roger et Nénette fortgeführt, einem winzigen Restaurant beim Alten Hafen. Dort wurden hervorragende Pizzas serviert, aber vor allem kleine Lasagne mit Tomatensauce nach Art der Region, dazu gab es in derselben Sauce zubereitete Lerchen. Eine Köstlichkeit. Sie waren mit dem Fahrrad bis zum Trockendock gefahren. Dort hatten sie den Bus ins Zentrum genommen. Die Fahrräder waren ein Geschenk der Gewerkschaft der Hafenarbeiter. Fünf Fahrräder. Heute war nur noch eins übrig. Die anderen waren ihnen an der Bushaltestelle geklaut worden!
»Als ich Mamoudi kennen gelernt habe«, fuhr Abdul fort, »hatte seine Frau gerade ein Kind gekriegt. Ein Mädchen. Wir haben zusammen gefeiert. Es war sein erstes Kind. Und du wirst mir nicht glauben, Diamantis, die Kleine, das ist Céphée!«
Diamantis sagte nichts. Er hörte zu. Dank dem Wein, einem Rosé aus Bandol – »Domaine de Cagueloup«, hatte der Wirt hervorgehoben und ihnen die Flasche gezeigt –, konnte er das Unbehagen überwinden, in Abduls Privatleben einzudringen. Er ahnte, dass ihre Beziehung nie mehr die gleiche sein würde. Sich gegenseitig zu öffnen – und Diamantis war ebenso bereit dazu –, hieß sich einzugestehen, dass man schlicht und einfach gestrandet war.
»Eines Morgens, achtzehn Jahre später, mache ich einen Zwischenstopp in Dakar. Ich fuhr auf der Eridan, dem ersten Schiff, das man mir anvertraute. Ich besuchte Mamoudi. Ich hatte regelmäßig von mir hören lassen. Eine Postkarte oder so. Von hier, von da … Das war das Mindeste, was ich ihm schuldig war. Und wer macht mir die Tür auf?«
»Das Mädchen.«
»Verdammt, Diamantis, ich war wie festgenagelt! Diese Göre, die ich im Arm gehalten hatte, war eine Göttin geworden. Eine Schönheit. Ich habe viele Frauen gesehen, gekannt … Wie du sicher auch. Aber sie …«
Diamantis ertappte sich dabei, wie er auf einmal an Melina dachte. Er hatte sie geliebt, sicher. Aber aus Vernunft. Oder aus Trotz. Was aufs Gleiche hinauslief. Sein Vater war gerade gestorben, und er hatte sich gesagt oder versucht, sich davon zu überzeugen, dass er nun genug von der Welt gesehen hatte. Dass er aufhören könnte. Der Mann, der ihm in seiner Kindheit so sehr gefehlt hatte, dem er von Hafen zu Hafen nachgelaufen war, in der Hoffnung, eine Nacht, einen Tag, eine Woche mit ihm zusammen zu sein, dieser Mann war zurückgekehrt, um in seinen Armen zu sterben. Auf Psará. Melina war mit ihren Eltern zur Beerdigung gekommen. Er kannte sie seit seiner Kindheit. An jenem Abend hatten sie sich geliebt. Am Abend der Beerdigung. Nein, Diamantis, sagte er zu sich selbst, du spinnst. Melina war schön. Sie war für dich. Du hast sie wirklich geliebt.
»Woran denkst du?«, fragte Abdul.
»An Melina. Auch sie war schön.«
Abdul brach in Gelächter aus. »Die Frauen, die man liebt, sind immer schön. Sonst würden wir nicht mit ihnen schlafen! Es gibt Tausende, die schöner sind als Céphée, ich weiß. Ich bin ihnen in allen Häfen der Welt begegnet … Aber sie … Was in ihren Augen lag, war nur für mich. Das ist Liebe. Das hab ich begriffen, als sie an dem Tag die Tür aufmachte. Vielleicht hat sie sich daran erinnert, wie ich sie als Baby im Arm gehalten habe. Meine Hände unter ihrem kleinen Hintern …«
Abdul war ein wenig betrunken. Diamantis verlor sich in Gedanken. Die Erinnerungen wühlten die Vergangenheit auf, wie einen abgestandenen Tümpel. Er hätte sich das Ganze am liebsten aus dem Kopf geschlagen. Denn hinter Melina zeichnete sich das Gesicht einer anderen Frau ab. Ein junges Mädchen von achtzehn Jahren, das er wahnsinnig geliebt und grußlos verlassen hatte. Er hatte sie sitzen lassen.
Das war vor zwanzig Jahren gewesen, in Marseille. Er hatte nie versucht, sie während seiner kurzen Aufenthalte wieder zu sehen oder herauszufinden, was aus ihr geworden war. Nicht einmal, seit er hier festsaß. Aber in diesem Augenblick vermisste er sie schrecklich. Amina. Ihr Bild drängte sich ihm auf. Jetzt war es geschehen und unausweichlich. Nun wusste er, womit er seine Zeit verbringen würde. Sie wieder zu finden. Wie um endlich mit seinem Leben aufzuräumen.
»Nehmen wir noch einen?«, Abdul zeigte auf die leere Flasche.
Diamantis ließ sich nicht zweimal bitten. Der Wein ist zum Erinnern da, nicht zum Vergessen.
2
Nachts sind wir von aller Welt verlassen
Abduls Blick folgte Diamantis durch das Fenster seiner Kabine. Wo mag er so früh hingehen?, fragte er sich. Er hatte das letzte Fahrrad, das der Besatzung geblieben war, nicht genommen, und das erregte seine Neugier.
Zum ersten Mal seit sie in Marseille festsaßen, machte Abdul sich Gedanken über Diamantis’ Ausflüge an Land. Er brach morgens auf, aber meist mit dem Fahrrad, und zwei oder drei Stunden später kam er wieder. Manchmal blieb er auch den ganzen Tag fort. In diesem Fall ging er zu Fuß. Wie heute. Aber er ging nur mit seinem Einverständnis. Und ohne sich je vor den Aufgaben zu drücken, die jeder auf dem Schiff zu erfüllen hatte. Eines Nachmittags hatte er sogar der Mannschaft geholfen, den Rost in Angriff zu nehmen, der sich auf dem Schiff breit machte. Am Abend hatte Abdul ihn ein wenig trocken darauf aufmerksam gemacht, dass ein Erster Offizier dort nicht hingehörte.
Diamantis hatte geantwortet, dass der Rost auch nicht auf das Schiff gehörte.
Abdul hatte gelächelt. »Ich weiß. Das mit dem Rost war nur, damit die Männer was zu tun haben. Damit es niemandem einfällt, an Deck herumzugammeln. Es kommt langsam zu Spannungen unter den Männern. Vor allem zwischen den beiden Birmanen und dem Rest der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass die Aldebaran, bevor ich sie übernommen habe, vierundzwanzig Monate eingemottet war. Deshalb können wir den Rost abkratzen, solange wir wollen, das wird nichts mehr nützen.«
»Ich bin wie sie, Abdul. Ich hab auch Lust, draufzuhauen. Und sei es auch nur auf diesen Schrotthaufen. Und ich will dir was sagen, es geht mir besser. Den Männern auch. Wir haben uns das in den Kopf gesetzt, und es erinnert zumindest an das Leben eines Seemanns.«
An diesem Abend begannen sie zu reden.
Danach war nichts mehr wie früher. Es wurde ihm bewusst, wie viel »Tiefgang« dieser wenig gesprächige Mann hatte. Geahnt hatte er es immer schon. Diamantis hätte schon lange sein Freund sein können. Er hätte sich ihm anvertrauen, ihn um Rat fragen können. Und vielleicht wäre manches ganz anders gekommen. Vielleicht wäre er immer noch der stolze Kapitän Abdul Aziz und nicht der jämmerliche Kommandant dieses verdammten Seelenverkäufers. Die entscheidenden Fragen, dachte er, stellt man sich immer zu spät. Wenn man im Leben gescheitert ist. Wenn es kein Zurück mehr gibt.
Er zog seinen Stuhl ans Kabinenfenster, um Diamantis weiter nachsehen zu können. Dieser schlenderte lässig über den Digue du Large. Mit dem Gang eines Mannes, der kein Ziel hat. Er schien zu humpeln, als ob seinem linken Bein ein paar Zentimeter fehlten. Aber das war nur ein Eindruck, als ob der Mann nicht auf festen Boden gehörte. Er selbst hatte immer auf seine Haltung, sein Äußeres großen Wert gelegt. Diese Vorliebe für eine stattliche Erscheinung hatte er von seinem Vater. »Halt dich gerade«, konnte der nicht oft genug wiederholen. »Ein gebeugter Mann ist ein gebeutelter Mann.« Und er fügte hinzu: »Sieh mir in die Augen. Wenn du etwas angestellt hast, ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen!« So war er seinem Vater gegenübergetreten, als er aus Sydney zurückgekommen war. Aufrecht, Aug in Aug. Die beiden Männer hatten sich abgeschätzt. Schließlich sagte sein Vater nur: »Willkommen daheim, mein Sohn.« Eine Woche später war er als Offiziersanwärter bei der Handelsmarine eingeschrieben.
Abdul hatte sich gefreut, als Diamantis in Genua das Fallreep hinaufgeklettert kam. Ihm war nur gesagt worden: »Wir haben einen Ersten Offizier für Sie gefunden.« Er hatte nicht damit gerechnet, einen Ersten Offizier zu bekommen. Eigentlich hatte er mit niemandem gerechnet. Die Aldebaran hatte ausgedient. Abdul wusste das. Sie war nur ein alter Massengutfrachter. Für den konnte man arme Teufel anheuern, die es irgendwann auf die See verschlagen hatte wie andere in die Fabrik. Jeder musste eben seine drei Groschen verdienen, um zu überleben und die Familie zu ernähren. Heute war es einfacher, einen auslaufenden Kahn zu finden als einen guten Job. So war das in Europa. So war es überall.
Abdul sah Diamantis noch einige Augenblicke nach. Er blieb plötzlich stehen, steckte sich eine Zigarette an, knüllte das Päckchen zusammen, warf es in die Luft und trat dagegen, bevor es zu Boden fiel. Ein sauberer Treffer, der die Papierkugel weit ins Meer beförderte.
Komischer Kerl, dachte Abdul. Was der wohl auf der Aldebaran verloren hatte. Das verstand er immer noch nicht.
»Jeder hat seine eigenen Sorgen«, murmelte er. Die seinen machten ihm schon genug zu schaffen. Er setzte sich an den Schreibtisch. An der Wand hatte er ein Foto von Céphée und den Kindern befestigt und ein weiteres, auf dem er seinem Vater die Hand reichte. Darüber war eine Postkarte aus Deir el-Qamar gepinnt, seinem Geburtsort im Osten von Beirut, die Walid ihm vor der Abreise nach La Spezia geschickt hatte. »Man hat uns für Großvaters Haus entschädigt«, hatte er geschrieben. »Du siehst, der Libanon wird neu aufgebaut. Endlich ist Frieden zwischen unseren Volksgruppen. Dein Platz ist immer noch bei uns. Es gibt genug Arbeit für unsere beiden Familien.«
Abduls Blick glitt von einem Bild zum nächsten und ruhte schließlich auf den Formularen, die er der Mannschaft geben musste. Jeder Mann würde tausendfünfhundert Francs erhalten. Als pauschale Abfindung. Die Männer verpflichteten sich, keine weiteren Rechte geltend zu machen, selbst wenn das Schiff verkauft würde. Das war natürlich Betrug. So wurden die Übernahmekosten für den neuen Reeder gesenkt. Aber zumindest würden sie nicht alles verlieren. Abdul glaubte nicht mehr an einen Freikauf der Aldebaran. Eigentlich gab es nicht mehr viel, an das er glaubte. Doch, eines: Er war überzeugt, dass sein Leben zu einem Abschluss gekommen war. Das hatte er Céphée gerade geschrieben. »Ich glaube, nachts sind wir von aller Welt verlassen …« Der erste Satz aus seinem Brief.
Bevor er seine Kabine verließ, notierte Abdul im Bordbuch: »k.b.V.«, keine besonderen Vorkommnisse. Wie jeden Tag. Nur, dass das heute nicht stimmte. Heute würde die gesamte Besatzung das Todesurteil der Aldebaran unterschreiben. Und seines mit.
Diamantis hatte einige Gewohnheiten angenommen. Etwa den Besuch in einem Bistro an der Place de Lenche, unterhalb vom Panier-Viertel, nur wenige Schritte vom Alten Hafen entfernt. Der ehemalige Hafenarbeiter Toinou Bertani hatte es vor mittlerweile fast drei Jahren übernommen. Mittags servierte er etwa zwanzig Mahlzeiten für einige Stammgäste. Provenzalische Küche, einfach, aber hervorragend. Diamantis kam morgens gern dorthin. Er setzte sich auf die Terrasse, unter die Platanen, trank zwei oder drei Kaffee und las die Zeitung.
Einmal hatte Toinou sich zu ihm an den Tisch gesetzt und gesagt: »Soll ich dir einen Pastis ausgeben?«
Bis dahin hatten sie nur die üblichen Gemeinplätze ausgetauscht. Gerade genug, um kein anonymer Kunde zu sein. Am Vorabend hatte ein Bericht über die Aldebaran in der Zeitung gestanden. Mit einem Foto von der Besatzung. Da hatte Toinou zu seiner Frau Rossana gesagt: »Verdammt, aber das ist doch der Typ, der jeden Morgen bei mir Kaffee trinkt.«
»Armer Kerl!«, meinte Rossana, nachdem sie den Artikel gelesen hatte. »Das ist bestimmt nicht lustig für die. Die haben wahrscheinlich nicht mal was Vernünftiges zu essen.«
Diamantis hatte den Aperitif nicht abgelehnt und auch nicht Toinous Einladung nach dem dritten Pastis, das Tagesgericht mit ihnen zu teilen. »Wenn es für zwanzig reicht …« Diesen Mittag standen frische Nudeln mit Gemüseragout in Olivenöl auf der Speisekarte. Ein Hochgenuss. Die beiden hatten nur einen Traum: Ein »richtiges« Restaurant aufzumachen.
Aber Rossana betonte: »Nicht wie am Hafen. Günstig muss es sein. Wenn ein Arbeiter von der Terrasse auf die Tische guckt und sieht, dass die kleinen Teller in die großen gelegt sind, dann sagt er sich, so was ist nichts für mich.«
Diamantis wurde schnell klar, dass es noch dauern würde, bis sie ihr Restaurant eröffnen konnten. Hier gab man gern Kredit. Aus Prinzip. »Du wirst noch auf der Straße landen, wenn du so weitermachst.«
»Ich bin fast sechzig. Wenn ich Pleite mache, geh ich einfach in Rente. Nichts leichter als das. Und wenn ich nicht genug habe, helfen mir mein Sohn und meine Tochter!«
Bruno und Mariette. Diamantis war ihnen schon öfter begegnet. Bruno, das Ebenbild seines Vaters, hatte Hafenarbeiter werden wollen, und Toinou hatte ihn nicht davon abhalten können. Mariette leitete ein kleines Immobilienbüro in der Rue Saint-Ferréol. Fröhlich, rundum mit sich zufrieden und mit berückenden, haselnussbraunen Augen ausgestattet. Toinou und Rossana, Bruno und Mariette – Diamantis hatte eine Familie für sich gefunden. Er fühlte sich wohler in ihrer Gesellschaft als bei Venetsanou, einem entfernten Cousin, der in Marseille lebte.
Einmal hatte er Venetsanou besucht, nachdem er erfahren hatte, dass die Aldebaran nicht so bald wieder auslaufen würde. Diamantis hatte ihn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Er hatte eine »Marseiller Griechin« geheiratet, ihr drei Kinder gemacht und mit seinem Schwager das kleine Bauunternehmen seines Onkels weitergeführt. Mit durchschlagendem Erfolg. Seitdem wohnten sie in einer kleinen Villa im Montebello-Tal, auf den Hügeln der Stadt, hinter Notre-Dame-de-la-Garde.
»Ihr habt es gut hier.«
»Ja, das ist ein gutes Viertel. Und das Gymnasium gleich nebenan ist eins der Besten für die Kinder. Ich will ja nichts sagen, aber Marseille hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob es dir in der kurzen Zeit aufgefallen ist, aber es ist voller Ausländer.«
Diamantis glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
»Das ganze Stadtzentrum ist verseucht. Gut, im Rathaus sind sie dabei, aufzuräumen, aber … Wir gehen nicht mehr auf die Canebière, so einfach ist das. Wir gehen nicht über die Place Castellane hinaus. Wir holen alles hier, in unserer Nähe. Der Markt, die Läden, die Kinos …«
Diamantis schaute immer noch verständnislos.
Venetsanou lächelte verschwörerisch. »Na, die Kameltreiber aus Nordafrika!«
Sie waren erst beim Aperitif. Die Mahlzeit fing ja gut an. Auf der Aldebaran waren zwei Birmanen, einer von der Elfenbeinküste, einer von den Komoren, ein Türke, ein Marokkaner und ein Ungar. Abdul Aziz war Libanese und er selber Grieche. Wer war wem fremd, wenn man einmal auf See war? In den fast dreißig Jahren, in denen er mit Menschen aller Rassen der Erde auf sämtlichen Weltmeeren gefahren war, hatte sich die Rassenfrage nie gestellt. Das gab er Dimitri zur Antwort.
»Menschliche Probleme habe ich erlebt, ja. Auch Machtprobleme. Fragen der Kompetenz und der Inkompetenz. Aber ich hab nie gesehen, dass ein Schwarzer weniger wert ist als ein Weißer.«
»Darum geht es doch nicht, Diamantis. Sie kommen nach Frankreich, und sie wollen alles.«
»Wie du. Mit sechzehn hast du eingesehen, dass du nicht dein ganzes Leben nach Schwämmen tauchen wolltest. Also hast du Symi verlassen und bist nach Marseille zu deinem Onkel Caginolas gekommen. Er hat dich mit ihm arbeiten lassen, und heute bist du dein eigener Herr …«
»Und ich habe eine Familie gegründet, ja, und ich habe ihr ein Dach über dem Kopf geschaffen. Und mein Geld verprasse ich hier. Ein echter Franzose! Ich habe gedient!«
Der Ton war hitzig geworden. Diamantis hatte seinen Teller zurückgeschoben. Tintenfische in Wein und Tomaten, wie sie auf den Inseln zubereitet wurden. Nena hatte sich Mühe gegeben. Aber offenbar kannte sie sich mit Steak und Frites oder Würstchen mit Kartoffelbrei besser aus. Weder die Sauce noch der Fisch schmeckte.
Nun kamen alte Rechnungen aufs Tapet. Auch Melina stammte aus Symi, und Dimitri war verliebt in sie gewesen. Eines Sommers war er zurückgekommen und hatte um ihre Hand angehalten. »Ich liebe Diamantis. Er ist es, auf den ich warte«, hatte sie ihm geantwortet. Dimitri hatte sie verspottet. Sie würde alt werden wie Penelope. In der ewig vergeblichen Hoffnung auf seine Heimkehr.
»Was kann man von einem Seemann schon erwarten?«, hatte er gefragt.
»Nichts. Ich hatte nicht wenige Abenteuer auf der Universität. Ich habe immer noch welche. Aber ich liebe nur ihn. Begreifst du das? Wenn ich heirate, ein Kind habe, dann mit ihm.«
An dem Tag, als Melina Diamantis verkündete, dass sie die Scheidung wollte, gestand sie ihm: »Ich bereue nichts, bitte verstehe. Aber es ist besser so. Besser für die vielen glücklichen Momente, die wir zusammen gehabt haben.« Diamantis verstand, was er alles verlor. Melina hatte ihm ihre Jugend geschenkt, und er hatte sie auf See vergeudet. Keiner von beiden fand an jenem Abend Worte für ihren Schmerz. Sie liebten sich, langsam. Nur um ihren Tränen einen Sinn zu geben. Die folgenden Abende hatte Diamantis in den Bars von Athen verbracht. Und sich volllaufen lassen, während er auf ein Schiff zum Anheuern wartete.
»Weißt du was Neues von Melina?«, fragte Dimitri mit einer boshaften Spitze.
»Sie wird wieder heiraten«, log Diamantis. »Du siehst, hättest du gewartet …«
Nena verließ den Tisch, Tränen in den Augen.
»Du bist ein Arschloch!«, schrie Dimitri. »Du hattest kein Recht, das zu sagen. Wir sprechen nicht mehr darüber, Nena und ich. Das Thema ist vergangen und vergessen.«
Diamantis trank schweigend aus und stand auf. Am liebsten hätte er Dimitri eine geknallt. Aber das hätte die Vergangenheit nicht ausgelöscht und nichts an der Gegenwart geändert.
In der Tageszeitung breitete Hass sich auf allen Seiten aus. Bosnien, Ruanda, Tschetschenien, Irland. Diamantis wäre am liebsten wieder ausgelaufen. Sich in einer Sternennacht mitten auf dem Ozean verlieren. Sich auflösen zwischen Himmel und Meer. Doch die Chancen, dass dies bald geschehen würde, waren gering. Er hatte sich bei der Seemannsmission erkundigt. In Marseille gab es nur wenige Schiffe, auf denen man anheuern konnte. Er musste zu seinem Ausgangspunkt zurück. Nach La Spezia. Oder woandershin.
»Na«, fragte Toinou. »Wie hast du dich entschieden?«
»Ich bleibe. Ich warte mit Abdul. Obwohl ich glaube, wir sind bescheuert, alle beide. Er hat das Kommando für den Frachter übernommen, verstehst du, und er lässt sich nicht so leicht davon abbringen. Er will ihn irgendwo hinbringen. Ich bin als Erster Offizier mit ihm an Bord gegangen. Und ich gehe dahin, wo er hingeht. Ich weiß sowieso nicht, wo ich hingehen soll.«
»Nach Hause. In der Zwischenzeit.«
Das konnte Toinou nicht verstehen. Es war Diamantis unmöglich, sich zu sagen: »Ich geh nach Hause und warte.« Das war die Krux im Leben der Seefahrer. Warten gab es nicht. Nur aufzubrechen hatte einen Sinn. Fortgehen und wiederkommen. Sogar die mit Familie dachten so. Die meisten zumindest. Denn Diamantis wusste wohl, dass heute viele zur See fuhren, weil sie an Land nichts Besseres fanden. Nedim, der Funker auf der Aldebaran, war so einer. Mit achtzehn hatte er zum ersten Mal das Meer gesehen, als er zum Militärdienst einberufen wurde. Bei der Armee hatte er Funker gelernt. Als er an Land keine Arbeit fand, hatte er sich auf See umgeschaut.
»Ich wurde nicht einmal seekrank«, hatte er eines Abends erzählt. »Der Koch aber meckerte ständig, weil ich selbst bei schlechtem Wetter für vier aß. Da hat er eines Abends gefragt: ›Nedim, was meinst du, ist es das Meer, was sich bewegt, oder sind es die Berge?‹ Ich hab fünf Sekunden gebraucht, um zu verstehen, und weniger als eine Minute, um aufs Deck zu kotzen! Jetzt wird mir bei der kleinsten Bö hundeelend.«
»Das funktioniert immer bei den Bauern!«, hatte Gregory, der Maschinist, gegrinst.
»Wer wird nicht seekrank?«, hatte Diamantis gefragt.
»Ich«, hatte Ousbène posaunt.
»Aha. Und wie schläfst du bei Sturm?«
»Auf dem Rücken«, hatte er gelacht.
»Ich auch«, hatte Diamantis geantwortet. »Sobald du auf der Seite schläfst, bist du reif fürs Klo! Das ist mir in dreißig Jahren nicht passiert!«
»Ich lege mich auch auf den Rücken«, fuhr Nedim fort. »Das ändert nichts. Ich merke, wie es rauf und runter geht.«
»Wegen dem Idiot, der dir was von Bergen erzählt hat«, sagte Ousbène.
»Das war ein Grieche. Die sind die größten Dummköpfe.«
Alle waren in Gelächter ausgebrochen. Und Nedim merkte erst jetzt seinen Schnitzer. »Oh! Verdammt! Tut mir Leid. Hat nichts mit dir zu tun. War nur ganz allgemein.«
So fühlte Diamantis sich wohl. Mit Männern, die so redeten, ohne Hintergedanken.
Toinou sah ihn aus seinen großen, vorstehenden, leicht blutunterlaufenen, aber vor Freundlichkeit strahlenden Augen an. Er verstand nicht, was in Diamantis’ Kopf vorging, aber das war nicht so wichtig.
»Hör zu«, sagte er sehr ernst. »Du kannst kommen, wann du willst. Du bist hier zu Haus. Und du kannst deinen Freund mitbringen, den Kapitän. Ihr braucht euch nicht zu genieren. Ich glaub, wenn du bleibst, ist es ein bisschen wegen ihm. Wegen dem Respekt, den du für ihn empfindest. Aus Freundschaft …«
»Nein, Toinou«, hätte Diamantis antworten können. »Ich bleibe, weil ich allein bin.« Aber er sagte nichts dergleichen. Er sagte nur: »Danke, Toinou.«
3
Wir schwimmen nicht im Überfluss, aber am Hungertuch nagen wir auch nicht
Als Abdul spät abends auf die Aldebaran zurückkehrte, saß Diamantis in der Messe. Er hatte eine Landkarte vor sich auf dem Tisch ausgebreitet. Eine alte, römische Karte. Daneben ein Block, auf dem er sich Notizen machte. Er trug Shorts, und sein Oberkörper war nackt. Stickige Gewitterluft drang durch die offene Tür. Als Abdul eintrat, sah er auf.
»Nun? Sind nur noch wir zwei übrig?«
Abdul antwortete nicht. Er zog sein Hemd aus, angelte sich einen Stuhl und setzte sich an den Tisch. »Ich wusste nicht, dass du dich für Kartografie begeisterst?«
»Du weißt nichts von mir, Abdul. Und andersrum ist es genauso. Wie lange kennen wir uns? Zehn Jahre? Über unsere Mannschaft weiß ich mehr.«
»Du bist auch nicht gerade gesprächig.«
»Wenn es mir schlecht geht, wenn ich Zweifel habe, vertiefe ich mich in die Kartografie.« Diamantis zeigte auf die Karte. »Mir wird deutlich, dass das, was einmal Wahrheit war, heute Lüge ist. Dass die Wahrheit immer relativ ist.«
»Das musst du mir erklären.« Abdul holte eine Schachtel Zigarillos aus der Tasche und steckte sich eine an, ohne Diamantis davon anzubieten.
»Es ist ganz einfach, Abdul. Was machen wir hier, wir beide, auf diesem verdammten Frachter? Du und ich, wir hätten abhauen können. Du hast bestimmt deine Erklärung dafür. Ich hab auch eine. Aber in Wirklichkeit wissen wir sehr wohl, du so gut wie ich, dass wir uns was vormachen. Das sind alles nur Lügen. Die Wahrheit ist, dass wir nicht heimkehren wollen.«
»Oder nicht können«, gab Abdul zurück.
Diamantis sah auf. Ihre Blicke begegneten sich. Abdul sagte sich, dass er mit dieser Bemerkung ins Schwarze getroffen hatte. Irgendetwas hielt Diamantis davon ab, zurückzukehren. So erklärte er sich, dass er nicht mit den anderen abgehauen war.
»Das läuft aufs Gleiche hinaus. Ich glaube, dass das, was wir Wahrheit nennen, einfach die Ehrlichkeit ist, mit der wir unsere Situation akzeptieren. Und es ist immer eine Lüge, sobald wir Leben, Liebe oder Geschichte groß schreiben. Oder nicht?«
Abdul beugte sich über die Karte. Er hatte jetzt keine Lust zu antworten. Das hätte zwangsläufig bedeutet, über sich zu sprechen, über Céphée, über ihr gemeinsames Leben, das zerfiel. Abdul hatte Diamantis zwingen wollen, die Maske fallen zu lassen, aber Diamantis hatte den Spieß umgedreht.
Ihre Blicke trafen sich wieder, und sie beschlossen, es für den Moment dabei zu belassen. An dem Punkt, an dem sie angekommen waren, würden sie ohnehin noch lange bleiben.
»Diese Karte«, erklärte Diamantis, »ist die Tabula Peutingeriana, eine römische Landkarte aus dem 3. Jahrhundert, hier ist Rom, in der Mitte.«
»Sie ist großartig.«
»Mein Vater hat sie mir geschenkt, einige Monate vor seinem Tod. Er hat sie in einer Opiumhöhle in Shantou von einem italienischen Seemann gekauft, der dringend Geld brauchte. Das war 1954, glaube ich. Aber ich erinnere mich an seine Heimkehr. Er hatte die Karte auf dem Tisch ausgebreitet wie einen Schatz, dann hat er mich auf den Schoß genommen und mir eine fabelhafte Geschichte erzählt. Ich war vier Jahre alt, ich verstand kein Wort von seiner Geschichte, aber sie klang wunderschön. Jedes Mal, wenn er nach Hause kam, begann er erneut. Mit mir auf seinem Schoß. So hatte ich mit zwölf verstanden, dass nur die Kartografie Meer und Land bis ins Kleinste hinterfragt. Das heißt, die Welt und unsere Sicht der Welt. Verstehst du?«
»Ja, ja. Voll und ganz.«
»Ich glaube, ich wäre gern Kartograf geworden. Oder Geograf. Aber … Seemann ist im Grunde das Gleiche. Auf jeder Reise zeichnet man die Welt neu. So sehe ich das.«
Abdul war begeistert, und während er Diamantis zuhörte, hatte er das Bild vor sich: der Junge und sein Vater. »Dein Vater war 1954 in China?«
»Ja, an Bord eines verrotteten Frachters. Noch schlimmer als unserer. Uralt, völlig aus den Fugen, nicht mal mit Funk. Ich habe nie erfahren, wie er hieß. Mein Vater nannte ihn Cafard, Küchenschabe. Einer von diesen Kähnen, die auf dem Schrottplatz verkauft werden. Griechische Reeder hatten ihn in Rotterdam für nichts erstanden. Sie ließen solche Schiffe noch jahrelang fahren. Das Risiko und die Gefahren gingen natürlich zulasten der Mannschaft. Die Cafard transportierte Kriegsmaterial. Als sie in Shantou ankamen, hatten die Kommunisten gerade die Macht übernommen. Von dem bombardierten Hafen war nichts übrig geblieben. Nur ein paar Opiumhöhlen.«
»Was haben sie mit dem Material gemacht? Haben sie es den Kommunisten ausgeliefert?«
»Keine Ahnung. Ich glaube, das hätte wohl auch nichts mehr geändert. Warum?«
»Nur so. Reine Neugier.«
»Weiter nichts?«
»Nein. Aber … Ich hab mich oft gefragt, ob es nicht gerade diese kleinen Nichtigkeiten waren, die den Lauf der Geschichte geändert haben.«
»Die Geschichte vielleicht. Nicht ihren Lauf.«