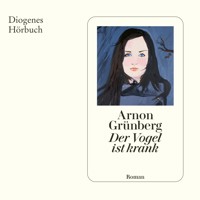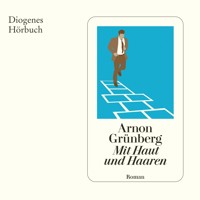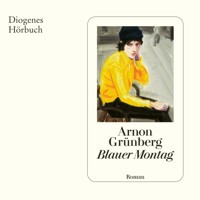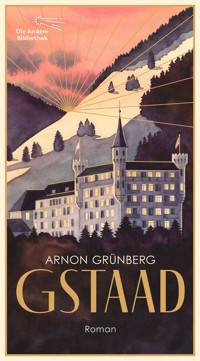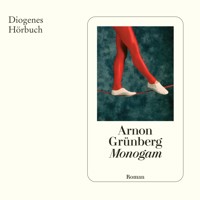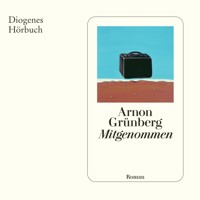11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Auf der Suche nach der Amour fou begegnet der junge Philosophiestudent Marek van der Jagt in seiner Heimatstadt Wien Andrea und Milena. Er hofft, dass die Touristinnen aus Luxemburg ihn in die Geheimnisse der Liebe einweihen. Mareks Bruder Pavel erlebt eine wunderbare Nacht, doch Marek selbst macht eine frustrierende Entdeckung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Ähnliche
Arnon Grünberg
Amour fou
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann
Diogenes
Grünberg, van der Jagt und meine Vermutungen
Ich habe vor Arnon Grünberg Angst. Ich versuche dagegen anzukämpfen, aber vergeblich. Mehrere Jahre schon sind wir befreundet, und nie habe ich ihn anders erlebt als liebenswürdig, zuvorkommend und herzlich. Aber gerade das macht mich besorgt, denn ich kenne auch seine Bücher.
Diese handeln von höflichen Leuten. Doch hinter ihrer Höflichkeit verbirgt sich der Schrecken – bei manchen die blanke Wut, bei anderen Vorsicht und Angst. Deduktiv, ja abstrakt leiten sie ab, wie man sich verhalten soll, in welchen Situationen man lächeln oder ernst sein muß und was man wann zu sagen hat, um nicht ungünstig aufzufallen. Ob es um einen Diplomaten geht (Gnadenfrist), um einen mittelständischen Familienvater (Tirza), einen überkorrekten Offizier (Mitgenommen) oder einen Philosophiestudenten (Amour fou), sie alle haben gemeinsam, daß hinter ihrer gesitteten Fassade das Entsetzen wohnt. Eine Weile scheint alles bei ihnen mit rechten Dingen zuzugehen, aber plötzlich geschieht es, daß der Major aus dem Wunsch, seiner Frau eine respektable Familie zu schenken, ein Kind stiehlt, daß der Diplomat zum Terroristen und der Familienvater zum Gewalttäter wird. Am harmlosesten von ihnen scheint zunächst Philosophiestudent Marek, der Held dieses Buches, das eigentlich Die Geschichte meiner Kahlheit heißt. Der deutschsprachige Verlag wollte aber einen anderen Titel, und Grünberg, höflich wie er ist, erhob keine Einwände.
Jeder gute Schriftsteller hat einen beschränkten Kreis von Motiven, die ihm gehören und die er Buch für Buch umkreist, erforscht, erzählend durchdenkt. Eines von Grünbergs Hauptthemen ist die Zweifelhaftigkeit des Unterfangens, höflich zu sein. Wie soll man sich also nicht fürchten, wenn man sieht, wie höflich Grünberg selbst ist? Seine Hauptfiguren sind zu Dingen imstande, vor denen so mancher wilde Kerl zurückschrecken würde, aber äußerlich sind sie leise, liebenswürdig und gut darin, sich chamäleonhaft anzupassen. Bis sie den Moment erreichen, da ihnen das plötzlich nicht mehr gelingt.
Wie viel hat Grünberg eigentlich geschrieben? Es ist schwer zu sagen, denn da sind nicht nur die Romane, von denen längst nicht alle übersetzt sind (Der jüdische Messias, vielleicht sein Hauptwerk, erscheint jetzt auf Deutsch), da sind auch Kurzgeschichten, Reportagen, Theaterstücke und Unmengen Zeitungsartikel, darunter eine tägliche, jawohl tägliche Kolumne in Hollands größter Tageszeitung. Wie macht er es, so viel zu arbeiten, in so kurzer Zeit, ohne daß man ihn je als von Schaffensqualen gepeinigtes Genie erleben müßte? Wie schafft er das, wo er doch ständig irgendwohin reist, manchmal als Reporter, manchmal als Vorleser eigener Werke und manchmal einfach so, niemals überarbeitet zu wirken, sondern stets entspannt, gelassen und im Einklang mit sich?
Seine Produktivität ist so groß, daß er nebenbei noch Bücher für andere Autoren schreiben könnte. Und manchmal tut er das auch. Zum Beispiel für Marek van der Jagt; so heißt das Pseudonym, unter dem Amour fou zunächst erschien. Noch einmal zu debütieren, ein zweites Mal als Neuling aufzutreten ist ein Wunschtraum vieler Autoren, aber Grünberg hat ihn tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Erst als technisch versierte Journalisten – so etwas gibt es offenbar in Holland – entdeckten, daß die E-Mails des mysteriösen Marek van der Jagt eigentlich aus New York kamen, wo Arnon Grünberg lebt, und als ein italienischer Linguist durch Computeranalyse festgestellt hatte, daß die »grammatische Signatur« (was auch immer das ist, aber es ist offenbar etwas) von Marek van der Jagt mit jener Grünbergs übereinstimmte, ließ dieser das Pseudonym fallen.
Daß dieser Roman voll Witz ist, mindert nicht seine Traurigkeit, sein Humor ist keiner, der lachen macht; es ist ein Humor der Qual, der Düsternis und Entblößung. Es ist wohl auch kein Zufall, daß er in Wien spielt, der Hauptstadt einer furchterregenden Bürgerlichkeit und dem Geburtsort der Psychoanalyse. Er enthält zwei der erschütterndsten und zugleich brillantesten Szenen des erotischen Scheiterns, die vorführen, wie Sex aussieht, wenn gar nichts mehr gutgeht; er enthält außerdem – und das ist natürlich kein Zufall – die glaubhafteste groteske Mutterfigur der neueren europäischen Literatur, ein Mama-Monster voller Witz, Charme und Grausamkeit. Und auch an die zwei vergnügungsbereiten Mädchen aus Luxemburg, an Mareks traurigen Vater, wie sein Sohn erstarrt in Höflichkeit und innerem Rückzug, an die sanft nymphomanische Bine Oertel mit ihrer ständig Essen zubereitenden Mutter oder an den hilflosen Psychotherapeuten Hirschfeld muß man nach dem Lesen noch lange zurückdenken. Wirklich unvergeßlich ist aber die Figur des Erzählers, Autors und Protagonisten Marek: geistreich und begriffsstutzig, scharf im Beobachten, geübt im Verdrängen, liebeskrank, kränker noch vor Schüchternheit, ein Meister des Selbsthasses wie der sanften Melancholie. Und natürlich der Höflichkeit.
Manchmal frage ich mich, ob es sich womöglich genau umgekehrt verhält. Vielleicht ist der Autor Grünberg eigentlich eine Schöpfung des im Verborgenen lebenden Genies Marek van der Jagt. Tatsächlich könnte man sich Grünberg auch gut als Romanfigur erklären: die überwältigende Produktivität, seine Fähigkeit, zur gleichen Zeit scheinbar an mehreren Orten zu sein, seine unangestrengte Aufmerksamkeit für die Menschen um ihn, seine genialische Begabung – das alles ergäbe endlich Sinn. Der scheue Dichter Marek aus Wien, der sich einen kosmopolitischen holländischen Autor ausdenkt, der irgendwann als Experiment den wunderlichen Träumer Marek van der Jagt erfindet – das ist eine Hypothese, die mir gefallen könnte.
Aber nein, da ist kein Marek, es gibt nur Grünberg, den ich fürchte, bewundere und nie durchschauen werde. Einen wie ihn könnte weder van der Jagt noch ein anderer Kollege erfinden. Das könnte, wenn überhaupt, nur Arnon Grünberg.
Wie alte Frauen reich werden können
Ich bin früh kahl geworden. Daß es irgendwann dazu kommen könnte, war nicht ausgeschlossen, aber daß es so schnell gehen würde, war doch eine Überraschung.
Dies ist die Geschichte meiner Kahlheit, und ich habe nicht vor, nach diesem Buch auch nur ein einziges weiteres Wort zu Papier zu bringen.
Es gibt Schriftsteller, die nur eine einzige Geschichte in sich tragen; sie schreiben über den Krieg, eine fürchterliche Krankheit oder eine verschwundene Tochter, die nach vier Jahren in einem Brunnen entdeckt wird. Im Vergleich dazu nimmt sich die Geschichte meiner Kahlheit eher bescheiden aus. Doch auch kleine Geschichten können bedeutsam sein.
Mama war eine kühle Frau von Welt, die armen Leuten viel Gutes tat, jedoch niemals ohne ihren Koffer mit Diamanten verreisen konnte.
Sie starb genau drei Wochen nach meinem achtzehnten Geburtstag.
Kaum ein Jahr danach war mein Papa wieder verheiratet; seine neue Frau hieß Eleonore.
Papa war nicht so von Welt. Er aß wie ein Schwein, auch bei offiziellen Anlässen, was Mama ihm nie verzeihen konnte. Vielleicht verdächtigte sie ihn heimlich, daß er sie vor allem wegen des guten Rufs ihrer Familie geheiratet hatte und auch ein wenig wegen ihres Geldes. Papa hat jahrelang geschuftet, um diesen Verdacht zu zerstreuen, doch Mama sagte: »Wenn ich deinen Vater sehe, rieche ich die Armut.«
Eleonore hatte schon zwei Männer verloren, den ersten bei einem Autounfall, den zweiten durch Krebs. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes war sie vom Schmerz so überwältigt, daß sie beschloß, viel Geld zu machen. Das tat sie auch. Und darüber, wie sie das viele Geld gemacht hatte, schrieb sie ein Buch mit dem Titel: Wie alte Frauen reich werden können.
Es wurde ein sagenhafter Erfolg. Nicht nur in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, auch in vielen anderen Ländern.
Mindestens dreimal im Monat sagte sie: »Es gibt schon wieder eine neue Auflage, was für ein Erfolg, Marek, was für ein wahnsinniger Erfolg!« Damit rief sie mir meine eigenen, gescheiterten Schreibambitionen in Erinnerung.
Papas Freunde sahen in Eleonores Reichtum den Beweis, daß er nur reiche Frauen lieben konnte, doch in Wahrheit hatte er sich selbst schon ein ordentliches Vermögen zusammenverdient, als er sie kennenlernte.
An dem Tag, als er zum zweiten Mal heiratete, tanzte er mit Eleonore Walzer und flüsterte mir ins Ohr: »Die besten Ehen sind Vernunftehen, Marek. Leidenschaft ist was für hysterische Frauen.«
Mama hatte nicht nur viel für arme Leute und hilfsbedürftige Künstler getan, sie hatte auch ihre leidenschaftlichen Anwandlungen. Zahllose arme Künstler waren ihre Liebhaber gewesen, auch wenn ich hier unterstreichen möchte, daß zwischen der Liebe meiner Mutter und der Armut der Künstler keinerlei Zusammenhang bestand. »Je ärmer, desto lieber« war jedenfalls nicht ihr Grundsatz. Gewisse Liebhaber waren so eifersüchtig, daß sich Mama am Ende eine elegante Damenpistole kaufte und eines Abends bei uns zu Hause den Kronleuchter in Stücke schoß.
Einmal, als Papa und Eleonore mich an einem Sonntag nachmittag nach Eisenstadt mitgenommen hatten, weil sie dort so ein nettes kleines Restaurant kannten und außerdem meinten, daß ich als Jüngster am meisten unter Mamas Tod zu leiden hatte, fragte ich: »Eleonore, müßtest du nicht eigentlich auch das Gegenstück zu deinem Buch schreiben: Wie junge Frauen reich werden können?« Doch sie tat, als würde sie mich nicht hören, und sagte: »Ist dieses Restaurant nicht romantisch, Fer?«
Sie war ganz anders als Mama, sie haßte Hilfsbedürftige wie die Pest, und mit Waffen durfte man ihr schon gar nicht kommen.
Bis ein unglücklicher Sturz Mama von diesem Leben erlöste, schrieb ich Gedichte in der Tradition Paul Celans. Daß ich mit dem Dichten aufgehört habe, hat mit dem Sturz nichts zu tun, ich schrieb sowieso kaum noch, der Sturz war gewissermaßen nur der Gnadenstoß.
Mit vierzehn jedoch hielt ich mich für einen Künstler. Ich veranstaltete literarische Salons in unserem Wohnzimmer, und wenn Mama guter Laune war, gesellte sie sich zu uns und sang. Mama war in jungen Jahren Opernsängerin gewesen, eine recht vielversprechende sogar, doch dann bekam sie ihr erstes Kind.
Zu meinen literarischen Salons lud ich vor allem Klassenkameraden und Nachbarskinder ein. Mama hatte eine riesige Hütesammlung. Wir durften uns alle einen Hut aussuchen und ihn uns aufsetzen. Die Mädchen kramten in Mamas Kosmetikfächern und schminkten sich vor dem großen Toilettenspiegel. Die Jungen rauchten Zigarren, denn Mama hatte nichts gegen Tabak, selbst rauchte sie lange, dünne Zigaretten, und ab und zu forderte sie ein Kind auf, etwas von seinem Vater zu erzählen.
So thronte ich in meinem Salon, in meiner Samtrobe mit meinen alkoholfreien Cocktails, meinen Pistazien und meinem Lachstoast – neben meiner Mama in ihrem Abendkleid, die für uns etwas aus dem heiteren Repertoire vortrug und, wenn wir ein wenig bettelten, auch ein Gedicht von Rilke. Mit »wir« meine ich ehrlichkeitshalber nur mich, die anderen interessierten sich vor allem für die Hüte und die Zigarren, auch wenn natürlich immer ein paar dabei waren, die sich auf den Lachs stürzten, als hätten sie schon seit drei Wochen nichts mehr gegessen.
Manche Eltern beschwerten sich bei meiner Mutter: »Finden Sie nicht, daß Kinder in diesem Alter keine Zigarren rauchen sollten?« Doch dann sagte sie: »Sie haben Ihre Meinung, ich habe meine. Ich habe nichts gegen Tabak.« So war Mama.
Helmuth, ein leicht autistischer und zurückgebliebener Junge, mit dem sonst niemand etwas zu tun haben wollte, wurde auch immer eingeladen.
Mama hatte einen Narren an ihm gefressen. In unbeobachteten Momenten kaufte sie Kleidung für ihn, die er jedoch nie trug, weil ihr Geschmack und der seiner Eltern nicht übereinstimmten.
Papas Kollegen fanden Mama ein wenig exzentrisch, doch wenn man so viel Geld hatte wie sie, war das eine fast unvermeidliche Begleiterscheinung. Niemand hat je gesagt: »Geht denn das?« oder »Ist das nicht etwas übertrieben?« Im Grunde hat ihr nie jemand widersprochen, denn Widerspruch vertrug sie nicht.
Mama hatte nicht viel von der Welt erobert, es war bei einem kleinen Stück Boden geblieben. Doch über dieses Stück regierte sie wie eine Fürstin. Sie hieß Constanza, doch sie konnte ihren Namen nicht ausstehen.
Mit Mamas Hüten auf dem Kopf sprangen wir durch den Garten. Mama hatte den Bedienten aufgetragen, reichlich Sorbeteis zu machen, und wenn wir das Eis vertilgt hatten, die Lieder gesungen und die Zigaretten aufgeraucht waren, sammelte sie die Hüte wieder ein und sagte: »Jetzt müßt ihr mich allein lassen.«
Mama konnte stundenlang auf ihre Hutsammlung starren. Manchmal stellte ich mich neben sie, dann legte sie ihren Arm um mich und sagte: »Wenn diese Hüte sprechen könnten.«
Ich habe zwei Brüder. Daniel, der älteste, fiel mindestens zwanzigmal im Jahr in Ohnmacht. Angeblich litt er an Blutarmut. Mittlerweile ist er ein ziemlich berühmter Dirigent.
Pavel, der mittlere, ist heute ein genialer Wirtschaftswissenschaftler. Er ruft mich oft an und sagt, daß ich lernen müsse, praktischer zu werden und zu denken. Er arbeitet für die Weltbank, in manchen Flugzeugen hat er ein eigenes Schlafzimmer.
Sechs Jahre nach meiner Geburt erwartete meine Mama noch ein viertes Kind. Es sollte ein Mädchen werden, doch es wurde kein Mädchen, es wurde eine Fehlgeburt.
Es fiel in die Toilette.
»Es ist mir entglitten«, sagte sie.
Beim Abendessen sagte Papa zu ihr: »Du kannst aber auch gar nichts.«
Dann wendete er sich an uns und sagte: »Eure Mutter kann überhaupt nichts mehr. Nicht mal ein Kind kriegen.«
Dennoch hörte ich ihn an jenem Abend weinen, im Badezimmer, und ich bin mir ganz sicher, daß er nicht heulte, weil Mama nichts konnte, sondern weil seine Tochter leblos in die Kloschüssel gefallen war.
»Es war noch kein Mensch, es war ein Haufen Blut«, sagte Mama, die alles immer gern plastisch beschrieb und selbst von einer Fehlgeburt erzählte, als handle es sich um einen Tierfilm. »Und ich hatte Magenschmerzen, als hätte ich eine verdorbene Muschel gegessen.«
»Jetzt reicht’s«, brüllte Papa.
Ich selbst habe, wie gesagt, schon mit vierzehn angefangen, hermetische Gedichte zu schreiben, zur großen Enttäuschung meiner Mama, die es gerne gesehen hätte, wenn ich Ballettänzer geworden wäre, und zum ebenso großen Ärger meines Vaters, weil Gedichte nichts mit Erfolg zu tun hatten.
Mein zweiter Gedichtband, den ich – genau wie den ersten – eigenhändig zusammengeheftet hatte, hieß Tote Sprachen.
Ich schickte ihn an alle Verlage, auch an vierundzwanzig obskure. Niemand wollte den Band herausgeben. Einer hat sogar unter einem der Standardablehnungsbriefe hinzugefügt: »Ihre Sprache ist in der Tat tot.«
Als ich den fünfzehnten Ablehnungsbrief bekommen hatte, kaufte ich der Ordnung halber einen Fotoapparat. Fotografieren war zwar nicht dichten, aber viele hielten es doch für einen kreativen Beruf.
Von da an versteckte ich mich in Parks hinter den Büschen und fotografierte die Spezies Mensch.
Ich tat alles der guten Ordnung halber: Ich lebte ein geordnetes Leben. Bis mir die Haare ausgingen.
Die Geschichte meiner Kahlheit beginnt mit Blondie – der Sängerin, und um ganz genau zu sein: mit ihrem Lied Call me.
Ich saß in einem der vielen Wiener Kaffeehäuser. Vor mir auf dem Tisch lag ein Schnellhefter, ein Seminarreader mit Zusammenfassungen wichtiger philosophischer Werke.
Mama war seit drei Jahren tot, doch ich muß zugeben, daß der Tod meines Gedichtbands mir mehr zu Herzen gegangen war als der Tod meiner Mutter.
Eine Frau, die mir gegenübersaß und an einem Irish Coffee nippte, beugte sich plötzlich zu mir und sagte: »Gefällt Ihnen das auch so?«
Es kommt öfter vor, daß Leute mich ansprechen. Ich bin mit einem Äußeren gesegnet, das die Leute offenbar gerne ansehen. Ich bin von durchschnittlicher Größe, habe breite Schultern, braunes, glänzendes und leicht gewelltes Haar, und meine Haut ist makellos und olivfarben. Viele halten mich für einen Brasilianer. Soweit ich es überprüfen konnte, habe ich nichts Brasilianisches im Blut.
Ich gebe zu, daß die Aufmerksamkeit für meine Person meist nachließ, sobald ich über meine Toten Sprachen zu reden begann, doch solange ich nur schweigend nickte, konnte ich ganze Abende in Gesellschaft der schönsten Männer und Frauen verbringen.
Ich verstand nicht, was die Dame mit dem Irish Coffee von mir wollte. Darum lächelte ich. Flegelhaftigkeit lehne ich ab. Es mag ja Leute geben, die Höflichkeit als eine leere Form betrachten, aber selbst leere Formen sind der Formlosigkeit bei weitem vorzuziehen.
»Das Lied«, sagte sie, »schön, nicht? Call me, wissen Sie, was das bedeutet?«
Ich habe mich nie als einen Charmeur betrachtet, trotz meines Äußeren. Im Gegenteil: Leute – ob es sich nun um Männer, Frauen oder Kinder handelte – interessierten mich nicht besonders. Nicht mehr jedenfalls. Ich hatte mich für sie interessiert, das schon, doch auch Interesse muß auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich wollte immer noch Tote zum Leben erwecken. Das Interesse des Charmeurs jedoch gilt nicht den Toten, sondern dem Lachen der Lebenden.
Die Dame am anderen Ende des Tisches trug einen Pelzmantel, ich schätzte sie auf Anfang Fünfzig. Ich bin nicht gut im Alterschätzen bei Damen. Auf dem Tisch lag ihre Sonnenbrille. An einem der Bügel konnte man den Namen des Designers erkennen.
»Mögen Sie die Musik nicht?«
»Ich mag eher klassische Musik«, sagte ich, »ich bin so erzogen worden.«
Sie nahm einen Schluck von ihrem Irish Coffee und lachte.
»Wird es dann nicht langsam Zeit, Ihre Erziehung selbst in die Hand zu nehmen?«
»Ich studiere Philosophie«, sagte ich.
Sie spitzte die Lippen, als wolle sie damit sagen, daß sie meine Antwort recht bedenklich fand. Es kann natürlich auch sein, daß sie mir ihre Lippen zeigen wollte.
»Und ich gebe Nachhilfeunterricht«, sagte ich.
»Und wem?« fragte sie.
»Leuten eben.«
»Jung, alt?«
»Vor allem jungen Leuten«, sagte ich, »Leuten mit …« Ich suchte das richtige Wort und entschied mich schließlich für »Lernstörungen«. Das deckte viel ab.
Die Farbe ihrer Lippen weckte Gedanken an Wintersport. Papa war verrückt auf Skifahren. Wenn es so etwas wie Glück gab – etwas, woran er im höchsten Grade zweifelte –, aber dennoch: Wenn es also so etwas wie Glück gab, bestand es für ihn darin, mit immer schneller werdender Geschwindigkeit einen verschneiten Berghang hinabzusausen.
»Lernstörungen«, sagte sie spöttisch.
»Eigentlich habe ich momentan nur einen Schüler«, sagte ich, »Max. Seine Lernstörungen sind ziemlich außergewöhnlich.«
»Interessieren Sie sich für Lernstörungen?« fragte sie, und wieder hörte ich Spott heraus.
Bis vor kurzem hatte ich mich für einen Künstler gehalten und geglaubt, daß Isolation und Künstlertum unzertrennlich zusammengehörten. Bis ich merkte, daß ich in diesem Wahn vollkommen allein war. Seitdem studierte ich Philosophie und verdiente mein Geld als Nachhilfelehrer. Ich war ein Nachhilfelehrer.
Vielleicht hatte ich mich nie in Beziehungen zu anderen Menschen verloren, weil ich glaubte, daß die Isolation meinen Gedichten zugute käme. Verloren hatte ich mich in Gedanken an tote Sprachen, Papier, Bücher, Theorien über die Liebe, Pistazienschalen, Mamas Hüte. Meine Naivität, auf die meine Umgebung mich gelegentlich hinwies, betrachtete ich als eine Tugend. Nach wie vor sehe ich ein gewisses Maß an Naivität als eine positive Eigenschaft an, Zynismus ist die Waffe der Geschlagenen. Natürlich hatte es ein paar flüchtige Romanzen in meinem Leben gegeben, doch von ihnen ist mir vor allem die Erleichterung im Gedächtnis geblieben, die mich überkam, wenn eine solche Verstrickung wieder zu Ende war, wenn mein Fleisch sich wieder vom Fleisch der anderen gelöst hatte und man wieder von zwei Körpern reden konnte. Eine Romanze war doch in erster Linie eine wortlose Angelegenheit, etwas, dem man sprachlos gegenüberstand, auf der Suche nach dem einen Wort, das nicht alles wieder zerstören würde.
Ich war verlassen, und man hatte mich verlassen, einmal hatte man mich gegen einen genialen Cellisten eingetauscht, doch es war ein Gefühl, als habe es nicht wirklich mit mir zu tun, als betreffe es eine andere Person. Körperliche Liebe durfte einfach keine emotionale Angelegenheit werden.
»Gefällt Ihnen mein Studium nicht?« fragte ich höflichkeitshalber. »Hatten Sie etwas anderes erwartet? Ab und zu hält man mich für einen Studenten am Konservatorium.«
»Philosophie«, sagte die Dame, »ach ja. Haben Sie vielleicht auch einen Lieblingsphilosophen?«
Ich wollte eine wohlüberlegte Antwort geben, eine Antwort, die von der Fähigkeit zeugte, Wissen anzuwenden, wie man sie eben von einem Philosophen in spe erwartete, doch die fremde Frau war schon aufgestanden und verließ den Tisch.
Ihre Sonnenbrille und ihr Handtäschchen hatte sie liegenlassen.
Ich las weiter in meinem Reader. Ich habe die elegante Erscheinung meiner Mutter geerbt, aber auch die Schüchternheit von meinem Papa.
Schon bei der ersten Begegnung quält mich der Gedanke, den anderen zu enttäuschen – eine Qual von der Art, daß es meist bei ersten Begegnungen bleibt. Wenn ich schon begehre, begehre ich heimlich. Am liebsten auf tausend Kilometer Entfernung, oder fünfundzwanzig Jahre später. Oder noch besser: mit dem Tod dazwischen.
Nach fünf Minuten kam sie zurück. Sie setzte sich nicht mehr hin.
»Auf der Damentoilette«, sagte sie, »unter den Handtüchern, liegt eine Streichholzschachtel. Wenn Sie sich die holen, wissen Sie, wo ich Sie morgen um vier Uhr erwarte.«
Sie trank noch einen Schluck im Stehen, spitzte die Lippen zum x-ten Male und setzte die Sonnenbrille auf.
Wieder mußte ich an unsere Wintersporturlaube denken. Papa, der einen Hang nach dem anderen hinabsauste, und Mama, die im Mantel in der Hotellounge auf ihn wartete. Wenn sie mit jemandem redete, war es immer das Personal. Bisweilen sagte sie zu einem vorübereilenden Ober: Leiste mir doch ein wenig Gesellschaft.
»Wie soll ich denn auf die Damentoilette kommen?« fragte ich.
Die Frage schien sie zu amüsieren.
»Na, aber«, sagte sie, »Sie werden doch wissen, wie Sie auf eine Damentoilette kommen?«
Sie streichelte noch einmal über ihren Pelzmantel, so wie manche Hundeliebhaber ihr Tierchen streicheln.
»Ihr Haar«, sagte sie.
»Was ist damit?« fragte ich.
»Fahren Sie mit der Hand mal kurz da durch.«
Ich fuhr mit der Hand durch mein Haar.
»So«, sagte sie, »das sieht schon viel besser aus.«
Ich sah die seltsame Frau an. Wien hat viele seltsame Bewohner, und viele dieser seltsamen Bewohner, reich oder arm, hatte meine Mama zu uns ins Haus geholt. Sie hatte so ihre Launen, und dann holte sie Leute ins Haus.
In der Vergangenheit hatte ich mich eine Weile intensiv mit der Amour fou beschäftigt, und wenn ich dieser Frau mit fünfzehn begegnet wäre, hätte ich sie wahrscheinlich für die Amour fou persönlich gehalten. Streichholzschachteln auf Damentoiletten unter einem Stapel Handtücher, so hatte ich es mir vorgestellt, so hatte ich die Surrealisten, jedenfalls einige von ihnen, verstanden, aber nun ja, Interpretationen sagen vor allem etwas über den Interpreten.
Jetzt war sie nur eine der vielen älteren Damen, die sich von meinem brasilianischen Äußeren betören ließen.
Die Frau ging fort, ohne mich zu grüßen. Was ich als Herausforderung auffaßte, nicht als ein Zeichen von Unhöflichkeit oder krankhafter Scheu.
Noch immer sang Blondie; ich hätte schwören können, es war schon zum dritten Mal dasselbe Lied.
Ich zögerte und versuchte, die Zusammenfassung von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten in mich aufzunehmen, doch vergeblich. Ich las Sätze, ohne sie zu verstehen, und wenn ich beim Nebensatz angekommen war, hatte ich den Hauptsatz schon wieder vergessen.
Wenn Mama nicht gestürzt wäre – es geschah bei einem Urlaub in den Bergen –, wäre ich nie auf den Gedanken verfallen, Streichholzschachteln auf Damentoiletten zu suchen und auf kuriose Anträge von Damen in Pelzmänteln einzugehen. Doch plötzlich fühlte ich sie mir so nah wie eine Taube, die auf meinem Kopf saß und Körner aus meinen Haaren pickte.
Mama, die auf ihre Weise eine schweigsame Frau war, hatte solche Dinge bestimmt auch getan. Fremde in Cafés ansprechen und dann Nachrichten auf Streichholzschachteln auf der Damentoilette hinterlassen. Irgendwo muß sie die armen Künstler doch kennengelernt haben?
Drei Viertel der Leute, die zu ihrer Einäscherung kamen, hatten mein Vater, meine Brüder und ich noch nie gesehen. »Wer ist das?« fragte ich Papa die ganze Zeit. »Kenne ich den Herrn?« Und er antwortete: »Wir können niemanden hinauswerfen.«
Mama lebte, als würde die Welt ihr gehören, und sie tat alles dafür, diese Illusion aufrechtzuerhalten.
Zu guter Letzt ging ich auf die Damentoilette. Die Taube auf meinem Kopf pickte immer noch.
Vor der Tür der Damentoilette zögerte ich erneut.
Ich sah mich um, sah niemanden, fühlte mich trotzdem lächerlich und schuldbewußt und ging auf die Herrentoilette, wo ich mir die Hände wusch. Dort war gerade ein Mann und pinkelte, und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, die Herrentoilette ohne Grund betreten zu haben. Der Gedanke, ständig unter Beobachtung zu stehen, auch auf der Toilette, klebte dank meiner Erziehung an mir wie eine Klette.
Mein Vater hieß Ferdinand, und mehr als einmal hatte er gesagt: »Auch auf der Toilette ist man nicht allein.« An guten Tagen nannte er sich selbst Ferdi, und Eleonore hatte sich den Kosenamen »Fer« für ihn ausgedacht.
Der Mann stellte sich neben mich und wusch sich die Hände.
Er lachte mich im Spiegel an.
Mein Äußeres löst bei den Leuten die unterschiedlichsten Dinge aus, meist Positives, doch immer noch habe ich nicht gelernt, daraus Kapital zu schlagen. Vielleicht schrecke ich vor den Konsequenzen zurück. Mama war eine schöne Frau, und in einem seiner mitteilsamen Momente sagte Papa einmal, daß sie mit ihrer Schönheit die Menschen ins Unglück stürzte.
Ich ging zum zweiten Mal zur Damentoilette und riß die Tür auf.
Ich konnte ja immer noch sagen: »Oh, Entschuldigung, ich hab mich geirrt.«
Die Damentoilette war leer.
Links vom Waschbecken durchsuchte ich einen Stapel Handtücher. Ich kam mir vor wie ein Voyeur und Schmutzfink. Gleichzeitig wußte ich, daß Mama schrecklich über mich hätte lachen müssen. Sie mochte Schmutzfinken lieber als Tauben. Wenn Tote sprechen könnten, hätte sie jetzt gesagt: »Marek, gut so, endlich fängst du an zu leben, endlich.« Vielleicht hätte sie mich sogar geliebt, einen klitzekleinen Moment lang. Mama war großzügig mit Geld, aber um so geiziger mit Liebe.
Und genau wie Hüte sind auch Tote von Natur aus schweigsam.
Ich fand tatsächlich eine Streichholzschachtel. Es stand nicht viel darauf. Ich hatte auf eine Nachricht gehofft, eine Schachtel, vollgekritzelt mit Plänen für einen ganzen Sommer und noch einen Teil des Herbstes, endend mit der Frage: »Kommst du auch?«
Doch es war einfach so eine Schachtel, wie sie in besseren Restaurants und Hotels an der Bar liegen. Darauf standen der Name und die Adresse eines Lokals, das ich nicht kannte. Es war eine Cocktailbar namens ›Die Vier Rosen‹.
Ich kannte wenige Cocktailbars. Abends blieb ich lieber zu Hause.
Als Mama noch lebte, konnte man bei uns zu Hause abends genug erleben, mehr als in jeder Cocktailbar. Und in letzter Zeit hatte ich immer mehr das Bedürfnis, mich zurückzuziehen, auch wenn ich nicht genau wußte, wovon.
Ich ging wieder zu meinem Tisch. Die Streichholzschachtel hatte ich mir in die Tasche gesteckt. Dort bewahrte ich alle wichtigen Dinge auf, denn ich hatte Angst, daß Papa und Eleonore mein Zimmer während meiner Abwesenheit durchsuchten.
Mama war auf eigenen Wunsch verbrannt worden, obwohl dem Rest der Familie ein Begräbnis lieber gewesen wäre. Sie hatte einen Brief hinterlassen, den ich vorlesen sollte. Einen Brief, den sie lange vor ihrem Tod geschrieben hatte.
Es hatte eine kurze Trauerfeier in einer Kapelle gegeben.
Ein uns allen völlig unbekannter Herr streute Rosenblätter über ihrem Sarg aus.
Rolf Szlapka, Mamas Blumenhändler, schluchzte herzzerreißend.
Papa saß regungslos auf einem Stuhl, den Hut im Schoß.
Leute traten heran, um ihm die Hand zu schütteln, doch als sie Papas wütenden Blick sahen, wichen sie erschrocken zurück.
Der Sonderling streute weiter seine Rosenblätter. Eine Rose nach der anderen zerpflückte er über Mamas Sarg. Er fing an, mir auf die Nerven zu gehen.
Dann kam ein Herr vom Begräbnisunternehmen und flüsterte: »Wir müssen langsam los.«
Papa nickte, und immer noch stand dieser Sonderling an Mamas Sarg und zerpflückte seine Rosen. Papa hatte beschlossen, daß meine Brüder und ich den Sarg hinaustragen sollten, doch plötzlich hatte ich Angst, daß der Sarg uns zu schwer würde, daß ich hinfallen, mir der Sarg aus den Händen gleiten und Mama in ihrem schönen Kleid auf der Straße landen würde. Es hatte die ganze Nacht geregnet, und überall waren Pfützen.
»Papa«, flüsterte ich, »ich fühl mich nicht gut, ich hab Angst, daß der Sarg mir zu schwer wird, ist es dir recht, wenn jemand anders das für mich übernimmt?«
Zuerst sagte Papa nichts; der Hut lag noch immer auf seinem Schoß, er warf einen kurzen Blick darauf, dann flüsterte er: »Wenn du es nicht kannst, darfst du es nicht machen, dann frage ich jemand anderen.«
»Ich kann schon«, sagte ich, »das ist es nicht.«
»Nein, Marek«, sagte er, jetzt etwas lauter, »du darfst nichts tun, was du nicht kannst.«
Alle sahen mich an, selbst Herr Szlapka hörte kurz auf zu schluchzen. Dann erhob Papa sich langsam und sagte: »Gehen wir.«
Der Mann einer Großtante aus Feldkirch nahm meinen Platz am Sarg ein, ich lief hinterher, den Blick auf meine Schuhe gerichtet, die ich für diese Gelegenheit extra blank geputzt hatte. Man redete ohnehin schon viel über uns, wir brauchten nicht noch mehr Anlaß zu Gerede zu geben.
Die Einäscherung selbst fand erst zwei Tage später statt, und bei jener Gelegenheit mußte ich den Brief vorlesen, den Mama geschrieben hatte.
»Wie oft habe ich mich während des Frühstücks nach diesem Moment gesehnt«, schrieb sie.
Mama war nicht immer nur eine sprühende Persönlichkeit, sie hatte auch ihre tief depressiven Momente. Manchmal spielte sie tagelang immer nur Klavier. Dann vergaß sie sogar, daß sie Kinder hatte, und wenn wir in den ersten Stock zu ihr ins Musikzimmer kamen, fragte sie: »Was wollt ihr von mir?«
Daniel, der Dirigent, hat Mama das immer sehr übelgenommen. Ich nicht. Mama war eine Frau, die manchmal vergaß, daß sie Kinder hatte, doch wenn man das einmal als gegeben hinnahm, war sie eine sehr gute Mutter.
Böse Zungen haben mehr als einmal üble Gerüchte über Mama verbreitet, doch die muß ich alle dementieren. Manchmal sah sie eben Dinge, die anderen Menschen verborgen blieben, das ist alles. So sah sie in Helmuth ein großes Talent; sie nannte ihn »eine alte Seele«. Die meisten anderen hielten ihn für einen alten Schwätzer, der die Neigung hatte, ohne jeden erkennbaren Grund zu sabbern. Doch Mama sah in ihm nun mal ein großes Talent und eine alte Seele, und sie zweifelte nie an der Richtigkeit ihrer Eindrücke.
Ich blätterte weiter in meinem Seminarreader, der von vorn bis hinten von Kant handelte. Die meisten Philosophen habe ich vor allem in Zusammenfassungen gelesen.
Ich schlüpfte in meinen Wintermantel und legte ein großzügiges Trinkgeld auf den Tisch. Papa und Eleonore wußten es sehr zu schätzen, wenn ich pünktlich zum Abendessen kam, und obwohl Daniel mir oft genug geraten hatte, irgendwo ein Dachzimmer zu mieten, war es mir immer noch nicht gelungen, Papa und Eleonore zu verlassen. Eleonore sagte immer: »In Italien verlassen die Jungen das Haus erst, wenn sie heiraten.« Und an ihrem Blick konnte ich sehen, daß sie glaubte, noch mindestens fünf Jahre zu brauchen, bis sie mich soweit hatte.
Ein Kellner, der mir schon früher aufgefallen war, weil er ein nervöses Zucken am linken Auge hatte, kam auf mich zu.
»Sind Sie Marek van der Jagt?«
Ich nickte.
»Da ist ein Anruf für Sie.«
»Für mich?«
»Sind Sie nun Marek van der Jagt oder nicht? Wenn Sie es sind, ist ein Anruf für Sie gekommen.«
Der Kellner sprach meinen Nachnamen auf ganz seltsame Weise aus.
Ich folgte ihm.
Im Café erklang jetzt Klaviermusik. Die Lichter wurden heruntergedreht. Man bereitete sich auf den Abend vor.
Der Kellner gab mir den Hörer.
»Und, sind Sie auf der Damentoilette gewesen?« fragte eine Frauenstimme.
»Ich bin dort gewesen«, sagte ich.
Der Kellner mit dem nervösen Zucken blieb neben mir stehen, als hätte er Angst, ich könnte das Telefon zu lange in Beschlag nehmen.
»Sehe ich Sie morgen nachmittag um vier Uhr?«
Ich betrachtete meine Fingernägel. Mama hatte mich jede Woche zur Maniküre geschickt, doch seit ihrem Tod war ich nicht wieder hingegangen.
»Eigentlich habe ich ein Seminar, aber ich komme gern, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tue.«
»Es wird Ihnen nicht leid tun.«
»Das hoffe ich«, sagte ich.
Nach Mama konnte mich nichts mehr überraschen.
Ich war an Menschen gewöhnt, die die Realität anderer Leute durcheinanderbringen wollten, wahrscheinlich, weil die Realität ohne ein wenig Verwirrung unerträglich für sie war, auf jeden Fall kein Ort, an dem sie sich lange aufhalten wollten.
Für Mama war die Realität eine Bahnhofshalle, die sie notgedrungen auf dem schnellsten Wege durchqueren mußte.
»Wie heißen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf?«
»Mica«, sagte die Stimme, »M-I-C-A.«
War das ihr Vorname oder ihr Nachname? Es konnte beides sein.
»Es ist mein Vorname«, antwortete sie auf meine Frage, noch bevor ich sie stellen konnte.
Der Kellner mit dem nervösen Tick schlich langsam näher, bereit, mir den Hörer jeden Moment aus der Hand zu reißen.
»Ich sehe Sie morgen«, sagte ich. Auf eine Leinenserviette notierte ich mir: »Mica, 4 Uhr.«
Wir aßen an dem Abend Fasan. Eleonore erzählte, daß sich ein chinesischer Verleger für ihr Buch interessiere, und fragte mich nach den Fortschritten in meinem Studium; Papa schwieg. Das Dienstmädchen war stark erkältet und fragte, ob wir das Dessert ausnahmsweise einmal selbst aus der Küche holen könnten.
Eleonore sagte: »Natürlich, Bettina, leg dich schön ins Bett und tu dir einen Schal um.«
Daß Mica meinen Namen kannte, hatte mich nicht überrascht. Dank meiner Mama war unser Name bekannt in ganz Wien.
Der Fasan sah ausgesprochen appetitlich aus, doch ich schmeckte nichts und ließ Eleonores Fragen unbeantwortet, denn das tat Papa auch.
Um halb elf gab Eleonore mir einen Kuß, und Papa sagte: »In der Abteilung Kreditversicherung arbeitet ein nettes Mädchen, das ich dir bald mal vorstellen werde.«
Ich legte mich ins Bett und dachte an Blondie, Kant, Mama und Mica, noch ohne zu wissen, daß es Streichholzschachteln gibt, die ein Leben so durcheinanderwirbeln können, daß man sich im eigenen Leben wie ein Fremder fühlt, wie ein Besucher, ein Gast.
Ich glaube, auch Mama fühlte sich als ein Gast in ihrem Leben. Sie tat immer so, als ginge das Leben sie nichts an, als sei es nicht ihr eigenes. Als sei sie eher zufällig dort gelandet, so wie man aus Versehen in ein Haus spaziert, weil man sich in der Adresse geirrt hat, und dann doch dort hängenbleibt. Draußen schüttet es wie verrückt, und man hat keinen Schirm dabei.
Wenn Papa genug von Mamas tagelangem Musizieren hatte – außer am Klavier vergriff sie sich auch regelmäßig am Cello –, zwang er sie, nach unten ins Eßzimmer zu kommen und sich zu uns an den Abendbrottisch zu setzen. Oft fuhr sie dann auf, einfach so, zwischen zwei Bissen. Sie lief zur Anrichte und übergab sich in eine der vielen silbernen Schalen, die dort standen, das Gesicht von uns abgewendet.
Wir mußten tun, als sei nichts geschehen, und einfach weiteressen. Das Dienstmädchen rannte mit der Schale in die Küche, Papa löffelte seine Suppe und sagte: »Es war ein schöner Tag im Büro, das Geschäft mit Lebensversicherungen blüht, das ist ein echter Wachstumsmarkt.«
Papa war ein großer Mann im Versicherungswesen. Er sah Mama nicht an, er blickte starr geradeaus.
Mama wischte sich entschlossen den Mund ab, setzte sich wieder an den Tisch und sagte: »Wo ist mein Klavier?«
»Auch in Asien«, sagte Papa, »sehen sie langsam ein, wie wichtig eine gute Lebensversicherung für eine Familie ist.«
Papa kam schließlich zu der Erkenntnis, daß Mama vom vielen Musizieren krank wurde, darum schloß er das Musikzimmer ab und bewachte den Schlüssel wie einen Schatz.
»Zuviel Musik«, sagte er, »ist nicht gut für eure liebe Mutter, sie ist eine sensible Frau, und für sensible Menschen kann manche Musik verheerende Folgen haben.«
Wenn ich aus der Schule kam, stand Mama oft am Wohnzimmerfenster, und wenn sie mich sah, nahm sie meine Hand und sagte: »Marek, wo ist mein Klavier, was haben sie mit meinem Klavier gemacht? Und mein Cello, wo ist das hin?«
Ich biß mir auf die Lippen, denn ich durfte nicht sagen, daß Papa das Cello versteckt und das Klavier hatte einschließen lassen. Zuviel Musik war schädlich für sensible Menschen, wenn Mama zuviel Musik hörte, würde sie Visionen bekommen.
Auch Zeitungen mußten vor ihr verborgen gehalten werden, denn das Leid der Welt konnte sie sich auf die wahnwitzigste Weise zu Herzen nehmen. An den seltenen Tagen, an denen sie das Klavier und das Cello vergaß – so wie sie vergessen konnte, daß sie Kinder hatte –, ging sie vollkommen in ihren Wohltätigkeitsaktivitäten auf.
»Joachim Tschudel«, sagte sie dann zum Beispiel, »verplempert seine Zeit in der Redaktion dieser blöden Zeitung, dabei muß er sein Meisterwerk über die Mongolei zu Ende schreiben, er hat mir ein paar Kapitel davon gezeigt. Es ist brillant, fast schon beängstigend brillant. Aber er hat kein Geld, darum vertut er seine Zeit bei diesem Käseblatt.«
Tagelang redete sie über nichts anderes als über Joachim Tschudel. Manchmal konnten auch wir einen flüchtigen Blick auf Joachim Tschudel werfen, doch es blieb bei einem flüchtigen Blick. Papa tolerierte Mamas Künstler, doch sie durften das Wohnzimmer nicht betreten, sie mußten in der Küche bleiben oder in den Dienstbotenzimmern.
Papa sagte dann: »Mama ißt heute in der Küche mit dem bärtigen Herrn.«
Mehr Worte verlor er darüber nie.
Wer jetzt glaubt, Papa hätte sich nicht amüsieren können, der irrt sich. Wenn er einen guten Tag hatte, sagte er manchmal gleich nach dem Abendessen: »So, Kinder, jetzt wird getanzt.« Denn er liebte es, durchs Haus zu tanzen. Wir hatten ein sehr großes Haus mit vier Etagen.
Er zog seinen Hausmantel an, und meine Brüder und ich mußten vorausrennen, während er tanzend hinter uns herlief, und dann jauchzte er vor Vergnügen wie ein Kind, denn auch Papa kannte seine glücklichen Augenblicke.
Ungefähr einmal pro Monat schlug er uns. Nicht, weil wir frech gewesen wären oder er getrunken hatte, nein, einfach, wie er sagte, um uns auf die Prügel vorzubereiten, die auch das Leben uns verabreichen würde.
Ich habe das Schlagen nie als etwas Negatives erfahren; neben dem gemeinsamen Tanzen waren es eigentlich die einzigen wenigen Momente der Intimität zwischen Papa und seinen Söhnen.
Während des Osterfrühstücks fragte Mama einmal: »Wie viele Kinder habe ich eigentlich?«
»Drei«, antwortete ich.
Papa starrte auf das Osterbrot und sagte: »Das Osterbrot wird jedes Jahr leckerer.«
»Nein«, sagte Mama, »ich habe vier! Wo ist das vierte?«
Papa sagte: »Ihr dürft Mama nicht zuviel Beachtung schenken, das schadet ihrer Gesundheit. Tut einfach so, als wäre sie nicht da.«
Daniel sagte: »Ich mach dieses Affentheater nicht mehr mit.« Er warf seine Serviette auf den Boden und verschwand. Zwei Tage lang kam er nicht nach Hause, doch Pavel und ich blieben sitzen.
So saßen wir beim Osterfrühstück und taten, als sei Mama nicht anwesend.
Papa sagte: »Das Osterbrot wird jedes Jahr leckerer, Jungs, ist euch das auch aufgefallen? Wir wollen ein paar Scheiben für Herrn Edwin aufheben.«
An Feiertagen bekam Papas Chauffeur Edwin Essen und Spielzeug von uns geschenkt, manchmal auch an anderen Tagen.
Sollte Papa je von etwas anderem geträumt haben als von Lebensversicherungen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und doch weiß ich, daß es so ist: Er hat von anderen Dingen geträumt, lange vor meiner Geburt.
Um halb zwölf hörte ich Eleonore durch den Flur schlurfen. Von Fasan bekam sie immer Magendrücken, doch auch ohne Fasan fand sie leicht einen Grund, mitten in der Nacht ein paar Gläser warme Milch mit Baldriantropfen zu trinken.
Ich stand auf, zog die Pantoffeln an, die ich zu meinem achtzehnten Geburtstag von Papa bekommen hatte, und ging in den ersten Stock, wo immer noch Mamas Klavier stand.
Ich setzte mich davor und dachte über mein Leben nach.
Ich wollte mich im Leben nicht bloß als Gast fühlen, nicht so wie Mama jedenfalls, für die das Leben am ehesten ein Stehempfang gewesen war, auf dem es gerade mal eine Handvoll attraktiver Männer gab, die sie alle schon einmal gehabt hatte.
Die Vier Rosen
Am nächsten Tag war ich pünktlich auf die Minute im ›Vier Rosen‹.
Die Bar lag im Untergeschoß, ich mußte fünf Stufen hinabsteigen. In einer dunklen Ecke spielte eine Frau Akkordeon.
Es war eines jener Lokale, die ich immer zu meiden versucht hatte. Zu dunkel, zu eng, und es roch zu sehr nach nassen Regenmänteln, die langsam vor sich hin trocknen.
Mica konnte ich nirgends entdecken, darum setzte ich mich an die Bar, und weil ich nicht wußte, was ich bestellen sollte, bestellte ich ein Mineralwasser. Die Bar hatte nicht viele Gäste, es waren ungefähr zehn. Es war noch früh, die Kunden, die nach Geschäftsschluß hierher einen trinken gingen, mußten noch kommen.
Ich wartete eine Viertelstunde und begann schon zu vermuten, daß sie überhaupt nicht kommen würde, als die Barfrau ein Glas Irish Coffee vor mich hinstellte und sagte: »Von der Dame dort in der Ecke.«
Sie zeigte auf die Akkordeonspielerin.
Erst jetzt erkannte ich sie: Sie trug keinen Pelzmantel, dafür eine Perücke. Auch war sie anders geschminkt.
Mica spielte Akkordeon. Als das Lied vorbei war, hielt sie ein kleines Glas in die Höhe und sah in meine Richtung. Ich nickte.
»Geh zu ihr«, sagte die Barfrau.
Ich ging an Micas Tisch, das Glas Irish Coffee in der zitternden Hand, und setzte mich neben sie. Ich wartete, daß sie das Wort an mich richten würde, doch sie sagte nichts. Mica spielte Akkordeon und trank Wodka, als ob ihr beides in Kürze für immer verboten würde.
Nachdem Mica noch eine Nummer gespielt hatte und leiser Applaus erklang, legte sie ihr Akkordeon neben sich auf den Stuhl und sagte: »Marek, du verstehst dich auf Pünktlichkeit.«
Ich lächelte, denn wenn ich mich auf irgend etwas verstehe, dann auf Pünktlichkeit.
Sie hatte eine helle Haut und forschende Augen, und sie roch wie ein Schwimmbad, ein Freibad an einem Sommertag.
»Bietest du mir nichts an?«
»Ich dachte, Sie hätten noch«, sagte ich.
»Der Irish Coffee war für dich.«
Ich warf einen Blick auf den Irish Coffee, dann auf das kleine Glas auf dem Stuhl neben ihr. Es war halb voll.
»Man kann einer Dame immer etwas anbieten«, sagte sie, »auch wenn sie noch etwas im Glas hat, außerdem laß uns doch du sagen, das macht alles viel einfacher.«
Was sollte denn hier alles so viel einfacher werden?
Ich gab ihr die Hand.
»Marek«, sagte ich, »sehr erfreut.«
Ich stieß ein kleines Lachen aus. Ein bißchen Peinlichkeit war unvermeidlich, wenn man fühlen wollte, daß man lebt.
»Mica«, sagte sie. »Kannst du den Stuhl etwas näher ranrücken, dann kann ich mein Bein darauf legen. Es tut ein bißchen weh. Scheint an der Feuchtigkeit zu liegen.«
Ich schob den Stuhl näher heran, und Mica legte ihr rechtes Bein darauf.
Ich betrachtete das Bein, es war ein gewöhnliches Bein in einer gewöhnlichen schwarzen Strumpfhose.
»Ja, es ist wieder ein feuchter Tag heute«, sagte ich.
Von Feuchtigkeit hatte ich zwar nichts gemerkt, doch offensichtlich sprach ich mit jemandem, der sich damit besser auskannte.
»Ist das Ihr Beruf?« fragte ich und zeigte auf das Akkordeon.
Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte los.
»Mein Beruf?! Ja, nennen wir es mal so. Aber wir wollten doch du zueinander sagen, Marek?«
Am Tag zuvor war mir nicht aufgefallen, wie dick sie war. Erst jetzt wurde mir das so richtig bewußt. »Stark in den Hüften« klingt netter.
In meiner Familie sind alle spindeldürr.
Mama hatte einen schwellenden Busen, doch selbst der Busen konnte ihre Magerkeit nicht verbergen. Papa sagte einmal: »Sie hat keine Hüften, wie sie ihre Kinder zur Welt gebracht hat, ist mir ein Rätsel.«
Ich finde dick lebenslustig und gemütlich, vor allem bei Frauen.
»Hol mal was zu trinken«, sagte Mica.
Sie betrachtete mich vom Scheitel bis zur Sohle und schien sich schon wieder zu amüsieren.
Ich trug an dem Tag halbhohe Stiefel.
»Was möchtest du trinken?«
»Sie weiß das«, sagte Mica und zeigte auf die Barfrau.
Einen Moment lang fragte ich mich, wie es kam, daß ich mich von einer ältlichen Akkordeonspielerin mit wetterfühligen Beinen herumkommandieren ließ, doch plötzlich wurde mir klar, daß ich nicht soviel fragen und nicht soviel denken durfte, daß ich es nehmen mußte, wie es kam.