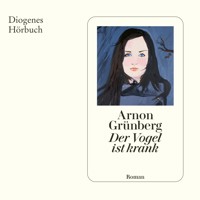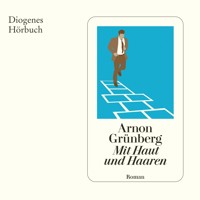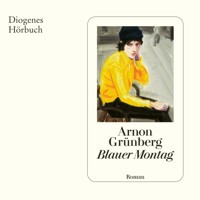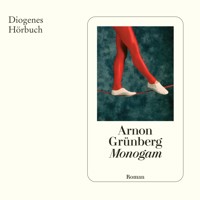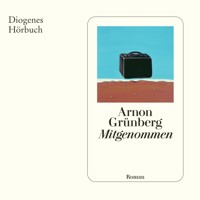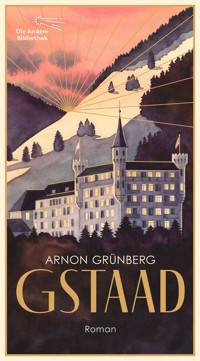
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das frühe Meisterwerk des niederländischen-Bestseller-Autors – erstmals auf Deutsch
Menschen, die nichts werden können, müssen das werden, was sie spielen. Für den jungen François Lepeltier, der hier scheinbar unbedarft seine Lebensgeschichte ausbreitet, ist das die Essenz des Überlebens. Von der Mutter, einem Zimmermädchen mit kleptomanischen Anwandlungen, wird François in der Pension Sonnenhügel in Baden-Baden aufgezogen. In Stuttgart gibt er sich als Zahnarzt aus, bevor er als Portier und Skilehrer reüssiert – Etappen auf dem Weg zum Gipfel seiner Karriere: François wird Sommelier im noblen Palace Hotel, hoch oben in den Bergen von Gstaad in der Schweiz. Doch wer so hoch aufgestiegen ist, der kann nur fallen. Im Gewand eines Schelmenromans wirft Arnon Grünberg einen tiefen Blick in menschliche Abgründe. Entstanden ist ein rabenschwarzer, sarkastischer Roman, der seine Leser abwechselnd lachen und schaudern lässt.
»Ein Buch wie ein Beil. Nach der Lektüre spürt der Leser in sich einen unermesslichen, gähnenden Abgrund.« NRC Handelsblad
»Voll grimmiger Komik und Unerbittlichkeit« The New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Ähnliche
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Arnon Grünberg
Gstaad
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
I : HEIDELBERG
II : DAS KIND VOM SONNENHÜGEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III : RODOLPHO CECCHERELLI
1
2
IV : DER SCHNELLE BOHRER
1
2
3
4
5
V : PALACE HOTEL
1
2
3
4
5
Impressum
I
HEIDELBERG
Es gibt notwendige und weniger notwendige Sünden.
Mein Leben bestand hauptsächlich aus Ersteren, obwohl ich bei deren Auflistung auch die weniger notwendigen nicht vergessen möchte. Die aus Spaß an der Freud oder in der Tradition stehend: Noch eine zum Abgewöhnen. Eine Sünde wie ein Samstagabendspaziergang am Neckar, ein Spaziergang mit Hund. Als ich den noch hatte. Und dann einen Schnaps, eine Zigarette, ein paar Scheiben Parmaschinken, ein kleines Glücksspiel, einen Riegel Toblerone. Und danach? Die Sünde, die alle anderen überflüssig macht. Weiße Schuhe, grobe Wolldecken, Badeschaum, die Berge, die Wispilenstraße, immer wieder die Wispilenstraße, die Augen meines Kindes, eine letzte Liebkosung. Was schmeckt herrlicher als die letzte Sünde?
Ich habe gelebt, um es mir abzugewöhnen.
Was ich jetzt noch zu verlieren habe, will ich verlieren. Die letzten Reste eines Besitzes erinnern einen nur an all das, was man verloren hat.
Ich bin in Heidelberg geboren, und mein Name ist François Lepeltier. Eine schöne Stadt, Heidelberg. Sagt man. Was für Frauen gilt, gilt genauso für Städte. Die anderen, die, in denen man nicht geboren ist, wo man nie gewohnt, in denen man nur ein paar Tage auf der Durchreise verlebt hat, sind immer viel schöner.
Mein Herr Papa stammte aus der Bretagne. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er starb drei Wochen vor meiner Geburt. Kein tragischer Unfall, keine Verzweiflungstat, nein: eine schleichende Krankheit. Er war auch nicht mehr der Jüngste. Sagten die Leute. Damit wollten sie andeuten, dass auch der Tod eine notwendige Sünde ist. Bloß, für manche ist der Tod etwas notwendiger als für andere.
Die Liebe hatte meinen Papa nach Heidelberg getrieben, und dort hat sie ihn auch begraben. Bei passendem Wetter: Nieselregen, der in nassen Schnee überging. Genau einundzwanzig Tage später kam ich zur Welt.
Meine Geburt betrachte ich als die Sünde, die alle anderen erst möglich machte. Oder lassen Sie es mich anders ausdrücken: Noch vor meiner Geburt hatte ich meine erste Sünde begangen, natürlich eine notwendige …
Zuerst kommt stets die Verirrung, dann das Nachdenken über diese Verirrung. Das Nachdenken hat meine Verirrung jedoch nicht korrigiert, wie es das doch eigentlich sollte, vielmehr hat es den Reflex nur verstärkt.
Jeder Fehltritt ist für mich ein Reflex. So wie man mit der Hand zurückzuckt, wenn man eine heiße Pfanne berührt, so überkommen mich meine Fehltritte.
Was man im Volksmund »die schiefe Bahn« nennt, war für mich der einzig mögliche Weg.
Während der Entbindung kam es zu Komplikationen. Ich war kerngesund, wenn auch etwas zu mager, und hatte viel zu große Hände. Ansonsten war alles an mir, wie es sein sollte. Der Arzt konnte nichts anderes feststellen: »Ein gesunder Junge, gnädige Frau.«
Meine liebe Mutter war bei der Entbindung nicht unversehrt geblieben. Ihr musste etwas entfernt werden. Eine Woche später sagte der Doktor: »Das war Ihr erstes und letztes Kind, gnädige Frau.«
Mit meinen großen Händen hatte ich etwas in ihrem Bauch zerrissen.
Man hat mich vom Gegenteil zu überzeugen versucht. Dass es die Natur war, Veranlagung, Zufall, Schicksal. Alles Worte für ein und dasselbe: das Unvermeidliche, mit dem man sich nun mal abfinden muss, weil jeder Widerstand lächerlich ist. Heroisch vielleicht in den Augen von Romantikern und heißblütigen Adoleszenten, doch jene, die wissen, dass Sterben eine genauso praktische Angelegenheit ist wie das Leben, können diesen Widerstand höchstens mitleidig belächeln.
Dabei weiß ich genau, dass ich aus Wut, aus reiner Eifersucht den Uterus meiner Mutter zerrissen habe. Ich wollte nicht, dass außer mir noch andere jemals dort wohnten. Ich wollte die Gebärmutter für mich allein, ganz allein nur für mich.
Hier geht es nicht um Schuld oder Unschuld. Vielmehr geht es um Zufall versus Berechnung.
Zufall mag eine Entschuldigung sein, doch als Entschuldigung ist er mir zu dürftig. Außerdem, womit sollte ich mich entschuldigen können? Was für eine Beleidigung wäre das, was für eine Lüge um der bloßen Konvention willen.
Wenn ich krank war, bin ich das noch immer, und zwar schlimmer denn je. Ich glühe vor Fieber. Doch bin ich vollkommen zurechnungsfähig, ich brauche kein Mitleid.
Wo Mitleid beginnt, endet die Liebe, oder das, was wir so nennen, mangels besserer, originellerer Bezeichnungen. Mitleid ist der Totengräber des Begehrens, und was für ein tattriger, erbärmlicher Totengräber ist das! Ein trauriges, selbstgefälliges Männchen. Ein unwürdiger, armseliger Feind aller Lust.
Man verstehe mich nicht falsch, ich ziehe hier nicht gegen jegliches Mitleid zu Felde. Wenn ich von vier Pferden auseinandergerissen werde, ist Mitleid vielleicht angebracht. Dann vielleicht. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Nein, danke!
Ich will nicht auf das Bild eines zum Tode Verurteilten reduziert werden, in dem Befürworter dieser Strafe bloß die Züge eines Menschen erkennen, der sich als zum Unvorstellbaren imstande erwies, Nase, Lippen und Mund eines Perversen. Das Böse, das Fleisch wurde und darum vor aller Welt bekämpft und vertilgt werden muss.
Das Unvorstellbare wird nur darum unvorstellbar genannt, um es auf Distanz zu halten, um nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Auf keinen Fall befindet es sich im eigenen Hinterhof, schließlich kann man sich den gut vorstellen.
Doch auch das Unvorstellbare muss endlich vorstellbar werden.
Dabei will ich hier keine Propaganda für dieses oder jenes Anliegen betreiben, auch nicht für mich selbst. Wennschon Propaganda, und manchmal fürchte ich, dass dem nicht zu entgehen sein wird, dann für meine Krankheit, mein Fieber – etwas, das größer ist als mein Leben, als meine Geschichte, die von eifrigen Sachverständigen rekonstruiert wird, reduziert auf Fakten, denen wieder andere Fakten widersprechen. Meine Geschichte ist hoffnungslos, sagen die Gutachter.
Ja, für dieses mein Fieber, das vielleicht das Fieber anderer ist, auf jeden Fall das Fieber der Zukunft, von Kindern und Kindeskindern, von all unseren Nachkommen, für dieses Fieber soll dieser Katalog notwendiger Sünden Propaganda sein. Würde einer der Sachverständigen die Hand auf meine glühende und schweißnasse Stirn legen, so würde er diese Zukunft erspüren.
Für mich hält die Zukunft zwei Möglichkeiten parat: Paradies oder Hölle. Mir ist es gleich. Was immer Sie wollen. Ich bin kein Wortkünstler. Wenn nur ein Sachverständiger die Hand auf meine Stirn zu legen wagt.
Nichts ist schrecklicher als die Nähe des anderen. Nach nichts sehnt man sich zugleich mehr. Ich betrachte den Tod nicht als Auflösung der individuellen Existenz, das Ende des Ichs oder, etwas bescheidener gesagt, die Auflösung des physischen und unbedeutenden Körpers. Alles Unsinn. Der Tod ist die Unmöglichkeit, noch eine Nähe zum anderen herzustellen. Die schreckliche, verbrecherische Nähe, mit der alle Lust anfängt und endet.
Wenn ich gesündigt habe, dann nur, weil ich die Nähe des anderen gesucht habe. Gesucht und gefunden.
Alles Leben verlangt nach Schmerz. Sonst wäre ich allein geblieben, hätte man mich gemieden oder mich sofort aus aller Gemeinschaft verstoßen.
Man mag es vielleicht nicht zugeben, schließlich gibt es anerkannte Grundsätze und Weisheiten, Kollegen und Familienangehörige, auf die man Rücksicht nehmen muss, Dogmen, die niemand zu hinterfragen wagt, Tabus, die sich ganz zufällig, so scheint es, in das x-te Goldene Kalb verwandelt haben – aber der größte und tiefste Schmerz ist die Abwesenheit jeglichen Schmerzes, die völlige Schmerzlosigkeit, die Abwesenheit jeglichen Dramas und damit jeglicher Art von Geschichte.
Was mir am Sichabfinden mit dem Zufall immer am meisten widerstrebte, ist der erbärmliche Charakter dieses Zufalls. Sich von vornherein zu ergeben, noch bevor ein einziger Schuss gefallen ist.
Bis auf meine Zeugung hat der Zufall in meinem Leben keine bedeutende Rolle gespielt. Ich habe mir den Zufall gefügig gemacht, ich habe mit ihm gespielt. Und das tue ich noch immer.
Von meinem Vater erbte ich meinen Namen: François Lepeltier, sprich: Löpöltieh, doch in Heidelberg sagten alle konsequent »Lepel-Tier« (wie »Faultier«), darum tat ich das nach und nach auch. Selbst die Sachverständigen sprechen meinen Namen nunmehr so aus. Ab und zu fragt mal einer: »Woher stammt dieser merkwürdige Name?« Dann antworte ich: »Eigentlich ist es ›Löpöltieh‹, ein Name aus der Bretagne, aber sagen Sie’s ruhig auf Deutsch.«
Darmkrebs hatte von meinem Vater nicht mehr übrig gelassen als mich, das Baby: ein kleiner Haufen Haut und Knochen, ein Name, verpackt als Mensch. Schlampig verpackt, aber gesund.
Für manche ist der Name eine Strafe, für andere eine Gnade. Meinen habe ich nie anders sehen können denn als ein beliebiges Würfelergebnis. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, sagt man. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus.
Glück muss man erzwingen. Auch in dieser Tradition stehe ich: der des manipulierten Würfels, der gezinkten Karten. Der Tradition des erzwungenen Glücks.
Meine Mutter war Zimmermädchen in einem, wie man so sagt, einfachen, aber guten Hotel in Heidelberg. Dort hat sie meinen Vater kennengelernt. Auf Zimmer 17. Und auf diesem Zimmer wurde ich auch gezeugt. Nicht auf dem Bett, dazu war keine Zeit, sondern im Bad, stehend vor dem Waschbecken.
Der Mann, dessen Namen ich trage, musste eigentlich zu einer wichtigen Verabredung, als er den Reizen meiner Mutter erlag, ihrem Haar, ihrer Nase, ihren Brüsten. Sie kam ins Zimmer, ohne anzuklopfen, in der Annahme, der Gast sei schon zum Frühstück gegangen, aber er rasierte sich noch. Ein kurzes Gespräch folgte. Übers Wetter. Und so kam eines zum anderen.
Der erste, echte François Lepeltier handelte mit Federn. Hauptsächlich Gänsefedern. Er füllte Bettdecken mit Daunen.
Er und meine Mutter waren achtunddreißig Jahre auseinander, aber für die Liebe ist das nichts.
Neunzehn Jahre alt war meine Mutter, als sie mich zur Welt brachte. Selbst mehr Kind als Mama, mehr Schwester als Mutter. In diesen Bekenntnissen werde ich ihr den Namen geben, den sie verdient, ihren eigenen: Mathilde.
Mathilde hieß sie, und für mich ist sie immer Mathilde geblieben. Drei Silben, an denen meine Geschichte klebt, manchmal sind drei Silben genug, ein Fieber auszulösen, das nie mehr verschwindet.
Meine Vergangenheit ist ein unerschöpfliches Gebiet, und doch scheint es, als habe es sie nie wirklich gegeben. Als bestünde sie nur aus den Berichten, die mittlerweile allerorts über sie erschienen sind, den hastig zusammengestoppelten Reportagen von Journalisten, die auch nichts dafür können, dass sie keine Hemingways sind.
Jeden Tag erreichen mich mindestens vier Interviewanfragen. Mein Name ist um die Welt gegangen. Ich bin ein »Fall« geworden.
Wenn der häufig geäußerte Allgemeinplatz stimmt, dass die Vergangenheit über die Zukunft entscheidet, was ist dann die Gegenwart, und vor allem: Wer bin dann ich?
Um die Zukunft beeinflussen zu können, habe ich die Vergangenheit gefälscht. Jetzt werde ich die Fälschungen rückgängig machen. Der Glaube der anderen an meine Geschichten, der mich berauscht und in ungeahnte Höhen getrieben hat, ist unerträglich geworden.
Ich muss wieder werden, der ich einmal war: Das Überbleibsel eines Mannes, den ich nie gekannt habe, das Ergebnis einer Affäre, die auf Zimmer 17 begann und dort auch endete. Der Überrest einer Liebe.
Das bleibt zurück, wenn das Schicksal zuschlägt.
Kein Baby hat vermutlich so viele Hotelzimmer von innen gesehen wie ich. Kaum konnte ich krabbeln, nahm Mathilde mich in einer Art Rucksack zur Arbeit mit. Sie war nicht aus ideologischen Gründen arbeitende Mutter, sondern aus Not. Ihre Ideologie lautete »Überleben« – die einzige Ideologie, die ich respektiere, die einzige, die einem zumindest nicht weismacht, wer gehorche, bleibe am Ende nicht mit leeren Händen zurück.
Schauen Sie, meine Hände sind leer.
Warum dann noch dieser Katalog meiner Sünden? Gerade darum, weil meine Hände leer sind. Ich öffne mein Leben den Katastrophentouristen, um es danach für immer zu schließen.
Sie arbeite als Zimmermädchen, sagte Mathilde, weil ihr das helfe, ihre Gedanken zu ordnen. Und weil sie nicht wisse, was sie sonst tun solle. Es gab nichts, was sie nicht nach ein paar Stunden oder noch schneller schon langweilte. Den größten Teil ihres Lebens hat sie Hotelzimmer geputzt.
Vielleicht war sie insgeheim eine Weise, meine Mathilde, eine der schweigenden Sorte; meine ältere Schwester, die mich ungeplant zeugte, weil, wie sie mir später erzählte, »animalische Anziehungskraft« im Spiel war. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Sagte sie.
Eine solche Anziehungskraft muss stärker sein als die Vernunft, der Verstand, die Angst vor der Zukunft. Animalische Anziehungskraft sieht keine Zukunft, sie schnüffelt und riecht nur das Heute.
Ein paarmal wurde ich zur Adoption angeboten. Ein Ehepaar, das im fruchtlosen Versuch, Kinder zu zeugen, fünf Jahre lang eine berühmte Klinik nach der anderen aufgesucht hatte, zeigte schon bald ernsthaftes Interesse.
Mein Großvater und meine Großmutter, Mathildes Eltern, waren voller Liebe und Verständnis, aber dieses Verständnis konnte die Missbilligung von Mathildes Lebenswandel nicht verhindern, und behutsam hatten sie – nicht lange nach der Beerdigung meines Vaters – bei Mathilde darauf gedrungen, das Kind Leuten zu überlassen, die es »nötiger« hätten als sie.
Sie würden ein Ehepaar kennen, bei dem das Kind in guten Händen sei. Alles könne diskret geregelt werden.
Opa und Oma waren, wenn ich es richtig verstanden habe, freundliche Leute. Sie konnten sich noch an Kaiser Wilhelm erinnern und hielten ihn für einen großen Mann. Mein Großvater war Direktor der städtischen Bibliothek in Heidelberg gewesen, und noch immer erfüllte er eine wichtige Rolle im Kulturleben der Stadt. Einmal pro Jahr speisten meine Großeltern beim Bürgermeister.
Jetzt kann ich das Ganze verstehen, ich war ihren sozialen Kontakten im Weg, meine Existenz war ein Schmutzfleck auf ihrer blütenweißen Weste. Ich erinnerte zu sehr an die Triebe, die der Mensch lieber vergessen möchte, an ihr eigenes Kind, Mathilde, das beschlossen hatte, nicht auf-, sondern abzusteigen. Nicht, weil die Gosse es so sehr anzog, sondern weil seine Weltsicht zu borniert war, die Verworfenen der Erde zu erkennen, und darum brauchte es vor diesen Verworfenen auch nicht zu fliehen, Verworfene, die, das muss man zugeben, trotz ihrer Verworfenheit manchmal noch ziemlich schnell laufen konnten. Mathilde hatte keine Angst davor, da zu enden, wo außer ihr niemand enden wollte.
Aus der Adoption wurde jedoch nichts. Das Ehepaar, das mich nötiger hatte als Mathilde, entschied sich zuletzt für ein älteres Baby, ein Mädchen aus Trier, bildschön, liebreizend. Unbesudelt. Meine großen Hände hatten das Ehepaar abgeschreckt. Und noch ein paar andere Unvollkommenheiten, die ich hier nicht näher erläutern möchte. Ach, diese Autoren, die sich 240 Seiten mit der Schilderung eines körperlichen Gebrechens beschäftigen, sie haben bestimmt ihre Verdienste, und es muss sie auf jeden Fall geben, aber ich habe für so etwas keine Zeit.
Die schiefe Bahn ist ein zeitfressendes Pflaster.
Was meine Großeltern angeht, so war es nicht der Altersunterschied zwischen ihrer Tochter und meinem Erzeuger, nicht dessen dubiose französische Herkunft (Opa und Oma vermuteten Zigeunerblut) und auch nicht der Darmkrebs, wenn der auch kein gutes Omen darstellte, nein, was sie am meisten störte, war, dass mein Vater mit Federn gehandelt hatte. Ein Mann mit einem aussterbenden Beruf, der beschlossen hatte, dem Tod seines Berufs zuvorzukommen. Wer wollte noch echte Gänsefedern in seinem Deckbett? Man ging zu synthetischem Füllmaterial über, das war billiger und hygienischer.
Von so jemandem wollten meine Großeltern keine Nachkommen.
Aber auch das darf in diesen Bekenntnissen nicht unerwähnt bleiben: Obwohl mein Vater Daunenhändler war, las er jeden Abend in einer Enzyklopädie, wie Mathilde mir später erzählte, in einem ihrer seltenen mitteilsamen Momente.
Scheitern bedeutet: das Glück nicht zu erzwingen. Warten, bis es zu einem kommt, und dann hoffen, dass der Tod nicht schneller ist. Der eine lässt die Milch überkochen, der andere vergisst, dass das Glück auf dem Herd anbrennt.
Meine Existenz erinnerte an einen gescheiterten Mann, meinen Vater. Und das konnten meine Großeltern nicht ertragen.
Menschen wie mein Vater lassen den Zufall entscheiden. Warten ab, was das Leben für sie bereithält: fünf Minuten Liebe, vier Monate Darmkrebs, ansonsten viele, unanständig viele Gänsefedern. Und offenbar auch animalische Anziehungskraft, die sich nicht adäquat in Worte fassen lässt. Weil dann nichts als Unbesonnenheit übrig bliebe.
Ich war – und bin – ein Propagandist der animalischen Anziehungskraft, ein Apostel, ich werde diese Anziehungskraft verkünden wie andere den Namen Christi. Mein Tempel ist der Tempel des Tiers.
Wenn ich alle Fakten noch einmal mische, wie einen Satz Karten, habe ich eine andere Vergangenheit, eine ganz neue, und was für eine. Und eine Zukunft: geradezu strahlend, eine, nach der man sich die Finger leckt.
Zu jeder Zukunft jedoch gehört auch ein Name – ich bleibe bei François Lepeltier. Mein erster und letzter, alle dazwischenliegenden hatten, von heute aus gesehen, nicht viel zu bedeuten.
Nennen wir mein Leben Anfängerglück. Jetzt noch eine Frau, mit der zusammen ich sterben kann. Ich habe schon eine im Auge. Sie schickt mir Briefe und ab und zu, wenn sie nicht zu viele Hausaufgaben machen muss, eine Fotocollage. Das mag ich sehr, Fotocollagen.
Es gab noch ein anderes Ehepaar, das sich erkundigte, ob ich noch zur Adoption stünde, aber da sagte Mathilde: »Nein, jetzt behalte ich ihn, mir machen seine Hände nichts aus.«
Von da an begleitete ich sie jeden Tag in einer Art Rucksack in ihr Hotel.
Und dort sollte ich mich meiner nächsten Sünde schuldig machen. Ein wenig unbescheiden vielleicht, aber auch diese Sünde schreibe ich auf mein Konto. Ich reihe sie ein in die Liste meiner Heldentaten. Ich fordere Anerkennung für sie, oder Strafe, was letztlich auch eine Form von Anerkennung ist.
Der Rucksack, in dem ich Mathilde früh am Morgen begleitete, war mittags mit kleinen Besitztümern der Hotelgäste gefüllt, die diese Dinge doch nicht mehr brauchten. Und auf denen saß ich dann, wie ein Kaiser auf seinem Thron.
Meine Mathilde war nicht nur die Herzensbrecherin eines bretonischen Daunenhändlers, sie war auch eine raffinierte Diebin. Lange vor den Freuden der Liebe hatte sie die des Diebstahls kennengelernt. Zuerst hatte sie nach und nach den Dachboden ihrer Eltern ausgeräumt, und man erzählt sich, dass meine Großmutter irgendwann dazu überging, abends ein Vorhängeschloss am Kühlschrank anzubringen, um zu verhindern, dass Mathilde am folgenden Morgen die besseren Käse und Würste auf dem Schulhof verhökerte. Jetzt räumte sie Hotelzimmer aus.
Ich wurde Mathildes Alibi. Kein besseres Alibi als ein Baby mit riesigen Händen.
Mit zehn Monaten bekam ich ein Ekzem. Das schützte sie noch besser gegen jede Entdeckung. Wer will schon kontrollieren, was sich unter einem mit Ekzemen bedeckten Baby verbirgt?
Oft habe ich Mathilde gebeten: »Erzähl noch mal, wie du Papa kennengelernt hast.«
Da gab es nicht viel zu erzählen.
Sie sagte: »Ich wollte eigentlich schon wieder gehen, weil er sich rasierte.«
»Und dann?«
»Dann schaute er mich an und fragte: ›Kann ich den Kaffee auch aufs Zimmer bekommen, oder muss ich dafür extra nach unten?‹«
Mehr als einmal habe ich darüber spekuliert, was wohl geschehen wäre, wenn mein zukünftiger Vater diese Frage nicht gestellt hätte. Wenn er sich einfach weiter vor dem Spiegel rasiert hätte. Vielleicht ist es mit der Wirklichkeit wie mit den Spermatozoen eines Mannes. Von allen Möglichkeiten setzt sich immer die durch, die am stärksten, am gerissensten, am lebenshungrigsten ist.
Die Möglichkeiten zu sehen ist jedoch nicht genug, man muss sich auch entschlossen darauf stürzen.
Mathilde sagte: »Eigentlich müssen Sie dafür in den Frühstücksraum runter, aber ich will Ihnen gern schnell einen holen.«
Als sie zurückkam, hatte mein Papa sich zu Ende rasiert.
Seinen Kaffee hat er nie getrunken.
Zucker und Milch hatte sie auch mitgebracht. Völlig umsonst.
Von allen möglichen Wirklichkeiten erwies sich eine als ein klein wenig stärker, und das war nicht die, in der Kaffee getrunken wurde.
»Und wie ist es passiert?«, fragte ich. »Wie hat es sich abgespielt?«
»Ich stellte den Kaffee auf das Nachtschränkchen«, erzählte Mathilde, »dann ging ich ins Bad und sagte: ›Ihr Kaffee steht auf dem Nachttisch.‹ Ich wollte wieder gehen, da packte er mich am Handgelenk. Er sagte: ›Anfang April und immer noch Schnee. Das ist doch nicht mehr human.‹«
Anfang April und immer noch Schnee. Das ist doch nicht mehr human.
Mehr Worte hatte der echte François Lepeltier nicht nötig, um der Wirklichkeit eine entscheidende Wendung zu geben.
»Er hat mich an den Haaren gezogen«, sagte Mathilde.
»Und was hast du dir da gedacht?«, fragte ich.
»Zuerst, dass jemand hereinkommen könnte, dann: ›Okay, dann kommt eben wer.‹ Danach bin ich schnell auf Zimmer 18 gegangen, und dann in die 19. Ich hab geschrubbt und gewienert, ich hab die Zimmer noch nie so gut geputzt wie an dem Vormittag.«
Einen Monat darauf zog François Lepeltier nach Heidelberg. Die animalische Anziehung war ihm einen Umzug wert. Im vierten Schwangerschaftsmonat zeigten sich bei ihm die ersten Symptome von Darmkrebs. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Krebs auch schon andere Stellen des Körpers befallen hatte. Die Wirklichkeit nahm erneut eine entscheidende Wendung.
»Wie sah er aus an dem Tag, als du ihn kennengelernt hast?«, fragte ich.
»Er hatte einen runden Kopf«, sagte Mathilde, »und eine Bürstenfrisur.«
Eine Bürstenfrisur.
Das nenne ich einen Anhaltspunkt.
»Hast du nie daran gedacht, mich wegmachen zu lassen?«, fragte ich.
»Doch, schon«, antwortete Mathilde, »mehr als einmal. Ich hab sogar schon im Wartezimmer gesessen. Alles war fix und fertig geregelt.«
Sie lächelte.
»Mir gegenüber saß ein Mädchen, die war zum dritten Mal da, und die erzählte mir, dass man nach dem Eingriff ein paar Monate lang keinen Sex haben darf. Da dachte ich auf einmal, was für ein Blödsinn, schließlich war ich in deinen Vater verliebt. So ein albernes Theater, reine Zeitverschwendung! Und da bin ich aus dem Wartezimmer gerannt. Eine Helferin kam mir noch hinterher. ›Was soll das denn jetzt‹, rief sie, ›was machen Sie da?‹ Aber da bin ich nur noch schneller gelaufen.«
So bin ich, François Lepeltier, der Stellvertreter des echten, der Adoption und der Abtreibung entronnen. Im ersten Fall waren es meine Hände und die kratzigen Spuren der Entbindung auf meiner Haut, im zweiten war es Mathildes Gier nach Lust, die mir das Leben rettete. Sie nannte es Verliebtheit, aber es war Lust. Wenn sie mich abgetrieben hätte, hätte sie ein paar Wochen keinen Sex mit meinem Vater haben dürfen, und das schien ihr unerträglich. Die stärkste und lebenshungrigste Wirklichkeit von allen hatte sich in mich verbissen.
Wenn Mathilde sich an dem Tag im Wartezimmer anders entschieden hätte, hätte ich ihr das nicht übelgenommen.
Mit Fragen wie: »War – oder bin – ich erwünscht?«, halte ich mich nicht auf. Wer sollte sich mich wünschen? Und warum? Halten wir es lieber einfach und übersichtlich: Solange man nicht ermordet wird, ist man erwünscht.
Selbst als ungeborene Frucht war ich schon eine Schande, eine Krankheit, etwas, das man loswerden wollte. Die erbärmliche Nebenwirkung eines erbärmlichen Trosts.
Nur die Nebenwirkungen des Gegenmittels waren noch erbärmlicher.
Eine Schande war ich, und eine Schande bin ich geblieben. Vielleicht muss ich das den Damen und Herren Journalisten erzählen, wenn sie mich befragen.
In meinem sechsten Lebensjahr (oder war es das siebte oder das achte?) mussten wir Heidelberg aufgrund einer weiteren notwendigen Sünde verlassen.
Wochen konnten vergehen, ohne dass meine Mathilde sich beim Putzen der Zimmer und Wechseln der Handtücher an den Habseligkeiten eines Hotelgasts verging.
Doch dann kam wieder eine einmalige Gelegenheit, die sie sich nicht entgehen lassen durfte.
Weder Krabbelgruppe noch Kindergarten habe ich je von innen gesehen. Meine Krabbelgruppe war das Bad, mein Kindergarten war das Hotelzimmer, und meine Aufgabe bestand darin, die nassen Handtücher einzusammeln.
Ich fand sie überall. Auf dem Bett, auf dem Nachtschränkchen, auf dem Fußboden, in der Badewanne, halb im Toilettenbecken, manchmal auch über der Tür, dann kam ich nicht an sie heran.
Ab und zu waren die Handtücher nicht feucht. Dann hatte der betreffende Gast sich nicht gewaschen.
Was auch vorkam: überhaupt keine Handtücher. Kein Handtuch, nirgends. Der Gast hatte die Handtücher mit nach Hause genommen. Das musste Mathilde dann melden. Gäste stahlen wie die Raben, manchmal sogar Bettlaken. Alles, was sich festnageln ließ, wurde darum auch mit Nägeln und Nieten befestigt, selbst die Fernbedienung hing mit einer dicken Kette am Fernseher. Man durfte den Gast nicht unnötig in Versuchung führen.
Der Hotelier hegte einen tief sitzenden Hass gegen stehlende Gäste. Selbst ein gestohlener Waschlappen war ihm schon zu viel.
Und dann gab es auch die Dreckschweine. Weiße Handtücher voll brauner Streifen. Als gäbe es kein Toilettenpapier. Manche Leute glauben, sich in Hotels alles erlauben zu dürfen.
Ein solches Verhalten durfte natürlich nicht ungestraft bleiben. In so einem Fall schaute Mathilde noch einmal besonders gründlich im Kleiderschrank nach, in der Reisetasche oder im Nachtschränkchen.
Mathilde war nicht nur ein Ass im Aufspüren von Hoteldieben, sie war auch selbst eine hervorragende Diebin. Hoteldetektive sind die gewieftesten Diebe.
Doch Mathilde war noch mehr: der Racheengel des Hotelleriewesens, und ich war ihr Assistent.
Meine Mathilde hatte den sicheren Blick eines Zollbeamten. Schon am Äußeren eines Koffers konnte sie erkennen, ob etwas darin war, das der Besitzer entbehren könnte. So versiert war sie, dass sie es sogar roch. Kam sie in ein Zimmer, schaute sie sich kurz um, nahm Witterung auf und sagte: »Hier ist nichts.«
Oder: »Hier – bingo!«
Fast immer hatte sie recht.
Sie war ein Genie. Und gerecht. Entwendete sie einem Gast etwas, machte sie das Zimmer immer besonders sauber, aber konnte sie für ihren Geschmack nichts finden, reinigte sie das Zimmer nach der Eilige-Putzfrau-Methode. Auch wenn man es ihr nicht direkt ansah, Gerechtigkeit war ihr Prinzip.
Ein Radio ist ihr zum Verhängnis geworden. Ein Weltempfänger der Marke Grundig.
Meine dritte notwendige Sünde hat sie zu dieser unbesonnenen Tat getrieben. Ich träumte von einem Gokart. Kurz zuvor hatte ich mit meinen großen Händen ein anderes Kind schon einmal mehr oder weniger gewürgt, weil es ein Gokart besaß.
Was mich an dieser Art Fahrzeug so anzog? Es wird immer ein Rätsel bleiben. Das Lenkrad, die Bremse, die Form, vielleicht auch einfach nur die Tatsache, dass ich keines hatte und andere Kinder schon.
Das Gokart war ein unerfüllter Traum, und wie das mit unerfüllten Träumen so ist: Es begann zu kribbeln. Wie mein Ekzem.
Wie oft zerrte ich meine Mathilde ins Spielzeuggeschäft, nur, um das Gokart dort anzustaunen.
Zu meinem Geburtstag wollte Mathilde diesem Kribbeln ein Ende bereiten. Doch dafür brauchte sie Geld.
Der Weltempfänger kreuzte unseren Weg auf Zimmer 8.
Mathilde zögerte, musterte das Gerät von allen Seiten. So ein Ding war eigentlich zu groß für sie, aber sie griff zu.
Sie griff zu, weil sie mich glücklich machen wollte. Das erste Mal, an das ich mich erinnere, dass sie das wollte. Normalerweise wollte sie niemanden glücklich machen, nicht einmal sich selbst. War sie es ab und zu trotzdem, dann geschah das aus Versehen, ohne es zu wollen, beinahe widerwillig.
An jenem Nachmittag wurde ich als Alibi mit Ekzem entlarvt. Der Hotelbesitzer fragte Mathilde: »Darf ich mal in den Kinderwagen sehen?«
Damals saß ich nicht mehr bei ihr auf dem Rücken, sondern in einem Wagen.
»Warum?«, fragte Mathilde zurück, »was wollen Sie von dem Jungen?«
Ich fing an zu kreischen, aufmerksames Kind, das ich war. Ich witterte Gefahr und lief rot an. Das war das Mindeste, was ich tun konnte.
Der Hotelier begann, in meinem Wagen herumzuwühlen, ich wurde blau und fuchtelte mit meinen großen Händen herum wie ein Epileptiker. Kurz darauf holte er mit triumphierender Gebärde den Weltempfänger unter meinen schmutzigen Windeln hervor.
Dies ist kein Bildungsroman, die schmutzigen Windeln gehen niemanden etwas an, ich möchte hier nur erklären, dass ich relativ spät stubenrein geworden bin. Wie spät? Sehr spät, beschämend spät. Dies ist, wie ich schon sagte, ein Katalog notwendiger und weniger notwendiger Sünden, und dieser Katalog strebt keinen Ewigkeitswert an. Ich habe das Heute gesehen, das genügt mir vollkommen. Dies ist höchstens eine Art Grabstein, ein Gruß aus dem Jenseits an meine Kinder, an meine Schüler und Anhänger, die ich leider nicht alle gleich gut kennengelernt habe.
Der Hoteldirektor drohte mit der Polizei. »Jetzt kannst du was erleben«, rief er. Und auch er lief rot an.
Schnell stellte sich heraus, was Mathilde erleben sollte. Er nahm sie mit in sein Büro. Die Tür blieb angelehnt, so dass ich meine Mathilde sehen konnte. Meine Éducation sentimentale begann früh.
Das angedrohte Erlebnis erfolgte im Blitztempo.
Sie trug einen schwarzen Rock, der in alle Richtungen um ihre Oberschenkel flatterte. Bei der Arbeit trug sie den immer.
Der Hotelier drückte sie mit dem Kopf auf den Schreibtisch, stellte sich hinter sie und zog ihr den Rock hoch. In seinem Augsburger Dialekt beschimpfte er sie als »Diebin, dreggade« und noch vieles mehr, das ich hier nicht wiederholen möchte.
Auf seinen Schreibtisch hatte er den Weltempfänger gestellt, damit Mathilde niemals vergäße, was für einen Preis sie für solch ein Radio zu zahlen hatte.
Für einen Moment vergaß ich das Gokart, den Weltempfänger und meine schmutzigen Windeln. Ich konzentrierte mich auf das Wichtigste, während ich immer noch kreischend in meinem Kinderwagen lag.
Aus der Hose des Hoteliers kam ein weißer Penis. Das Ding sah aus wie eine Bratwurst, die nicht lange genug im Fett gelegen hat. Haare wuchsen darauf. Eine blasse Bratwurst mit Haaren, so erschien der erste Penis in meinem Leben.
Man hat mich ein neurotisches Kleinkind genannt, ein Kleinkind mit Schlafschwierigkeiten, Konzentrations- und Hautproblemen. Im Grunde jedoch waren all diese Neurosen nichts anderes als Neugier, Neugier auf die Wirklichkeit, die eine animalische Anziehungskraft auf mich ausübte.
Ich konzentrierte mich auf die Bratwurst des Hoteliers, der Mathilde für eine Sünde bestrafte, die sie um meinetwillen begangen hatte, eine Sünde zudem, an der ich ebenso große Schuld trug wie sie.
Während der Hotelier seine Bratwurst in ihr hin und her schob, bearbeitete er mit der Rechten Mathildes Hintern. Er machte auf ihrem Hintern Musik, und für Musik war ich immer empfänglich. In einem anderen Leben wäre ich vielleicht Musiker geworden.
Für den Hotelier war Mathildes Hintern ein Musikinstrument, dem er göttliche Klänge zu entlocken versuchte, und während dieses Entlockens wurde mir bewusst, dass er sie auch viel schlimmer hätte bestrafen können. Mit einem Küchenmesser zum Beispiel oder mit dem Beil, mit dem er im Winter Holz hackte.
Wie der Dirigent eines Spielmannszugs, der durch sein Hotel zog, so musizierte der Direktor, voll und ganz der Partitur hingegeben. Die Partitur war voll blinder Wut, die er auf den Pobacken meiner Mathilde austoben musste.
Zum ersten Mal in meinem jungen Leben wurde ich mir der Freundlichkeit dieser Welt bewusst. Ich nahm mir vor, niemals an ihr und der Güte der Menschen zu zweifeln, denn Mathilde und ich waren noch gnädig davongekommen. So wahr mir Gott helfe.
Dann verlangsamte der Hotelier seinen Rhythmus und beendete die Musik mit einem letzten Paukenschlag. Auf Mathildes Rücken versuchte er einen Moment keuchend, zu Atem zu kommen, zog seine blasse Bratwurst aus ihr und knöpfte sich die Hose zu. Vor allem Mathildes rechte Pobacke war blutrot, wie ein rohes Beefsteak.
Mathilde zog sich den Slip wieder hoch und richtete ihren Rock. Der Hotelier fummelte an seiner Krawatte, packte Mathildes Gesicht mit der Linken, kniff ihr in die Wange und sagte: »Und jetzt raus, und wag es nicht, wiederzukommen. Sei froh, dass ich es hierbei belasse.«
So verließen wir unser Hotel in Heidelberg.
Nicht nur ich, auch meine Mathilde hatte jetzt ihre Freiheit, und damit ihr Leben, der Lust anderer Menschen zu verdanken. Die Lust anderer kann eine Waffe sein, um die Ideologie des Überlebens in die Tat umzusetzen.
Die Welt ist gut, aber man muss ihre Güte zu sehen wissen.
Wenn die Sachverständigen behaupten, mein Leben sei von frühester Jugend an ein einziger Kampf ums Überleben gewesen, und das behaupten sie unaufhörlich, dann möchte ich hinzufügen: Ich habe gekämpft wie eine Frau. Meine Mathilde war mein Rollenmodell, meine Lehrmeisterin, mein Idol, mein Leben.
Niemals habe ich darum auf anderer Leute Lust hinabgeschaut oder diese Lust verurteilt. Dingen, denen man sein Leben verdankt, muss man mit Respekt begegnen.
Sie hätte auch besser die Finger von diesem Weltempfänger gelassen, sich auf die vertrauten Gegenstände beschränken sollen: ein paar herumliegende Münzen, einen Füllfederhalter, den man überall verloren haben kann, Strumpfhosen in ihrer Größe, einen vergessenen Schal an der Garderobe. Für mich war sie ein unverantwortliches Risiko eingegangen, für mich und dieses idiotische kleine Glück, das aus einem Gokart bestand.
Sie schob meinen Wagen durch den Park zu der Dachkammer, wo wir wohnten, seit Opa und Oma uns aus dem Haus geworfen hatten, und sagte: »Ich kann kaum noch laufen, was für Pranken dieser Typ hatte!«
Ich dachte an die behaarte Bratwurst. Bisweilen manifestiert sich das Gute in höchst unattraktiver Gestalt.
In einem kleinen Heft notierte Mathilde jeden Tag ihre neueste Beute. Über ihre Einnahmen und Ausgaben führte sie äußerst genau Buch. Sie war jung, aber nicht unorganisiert.
An jenem Tag im November hatte sie in ihr Notizbuch schreiben wollen: 1 Grundig Weltempfänger. Doch ihr Notizbuch blieb leer. So lernte ich die Ungerechtigkeit der Welt kennen.
Mathilde hatte für einen Weltempfänger bezahlt, und nicht zu knapp, ja, für mindestens vierzig Weltempfänger, aber sie hat nie einen einzigen bekommen.
Die Bekanntschaft mit der Ungerechtigkeit hat mein Vertrauen in die Güte der Menschen jedoch nie ins Wanken gebracht. Das Gute gibt, und das Gute nimmt, was heute ungerecht ist, kann schon morgen gerecht sein. Wer Hunger hat, muss am Baum des Guten rütteln, dann fallen die Äpfel von alleine herunter.
Und genau das haben Mathilde und ich immer getan, wo wir auch waren, wie prekär unsere Situation auch immer war: Nie haben wir es aufgegeben, am Baum des Guten zu rütteln.
Menschen, die nicht stehlen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Jene, die die Möglichkeiten nicht erkennen, weil sie blind sind oder ein wenig beschränkt, und jene, die diese Möglichkeiten zwar sehen, aber keinen Gebrauch davon machen. Weil sie Angst haben oder Prinzipen, aber ein Prinzip ist nichts anderes als versteinerte Dummheit.
Mathilde erkannte die Möglichkeiten und nutzte sie. Darum bin ich immer stolz auf sie gewesen.
So wie sie wollte auch ich leben, die Möglichkeiten erkennen und Gebrauch davon machen. Mein Leben ist eine Ehrenbezeugung an sie, ein Mahnmal, und mehr als das: Mein Leben ist ihr Leben.
Ich habe mich nie von ihr lösen können. Und sie nicht von mir. Warum hätten wir das auch tun sollen? Wir Menschen müssen danach streben, einander in Besitz zu nehmen, um unserer Einsamkeit zu entgehen.
Wir schliefen immer im selben Bett, einer Matratze auf dem Boden. Weil wir nur eine hatten. Eine Matratze ist nicht so einfach zu stehlen. Selbst der erfahrenste Hoteldieb wagt sich nicht an Matratzen.
Ich konnte immer erst schlafen, wenn meine Mathilde neben mir lag, ich ihren warmen Körper und ihre Hände auf meinem kleinen, ekzemübersäten Bauch spürte. Nur so war ich mir sicher, dass sie nicht weglaufen würde.
Als Abtreibung und Adoption misslungen waren, hatten meine Großeltern uns liebevoll die Tür gewiesen. Oma sagte: »Wenn du dir das Kind rechtzeitig hättest wegmachen lassen, hättest du hier wohnen bleiben können, kein Problem. Aber mit dem Kind – nein!«
Zuerst unterstützten sie uns noch, doch als sie von Mathildes unverminderter Leidenschaft für das Stehlen erfuhren und man selbst in den besseren Kreisen Heidelbergs über Mathildes Unmengen an Diebesgut munkelte, war es mit der Unterstützung vorbei. In einer kleinen Stadt verbreitet sich Tratsch schneller als Tbc.
Jemand musste auf Mathilde aufpassen, sie beschützen. Und das tat ich.
Sie litt an der Krankheit, an der auch ich mein Leben lang gelitten habe und von der ich vielleicht erst jetzt genesen werde: Naivität.
Anders ist es nicht zu erklären, dass sie für ein Gokart so viel aufs Spiel setzte. Naivität ist eine Krankheit, bei der man glaubt, dass von allen möglichen Wirklichkeiten ausgerechnet die schwächste, die schönste, die erwünschteste sich durchsetzen wird.
Nach dem Vorfall mit dem Weltempfänger beschloss Mathilde, mit mir nach Baden-Baden zu ziehen. In Heidelberg war kein Platz mehr für uns. Sie ging davon aus, in Baden-Baden schnell Arbeit zu finden. Baden-Baden liegt nicht weit von Heidelberg. Baden-Baden, das in meinem Leben die Hauptstadt der notwendigen Sünde werden sollte, ist niemals weit weg.
Ihr Hintern war noch immer blutrot. »Was für ein Metzger«, sagte sie. Ich rieb ihren Po mit derselben Salbe ein, die sie täglich für meinen Hintern benutzte, denn ich litt unter Windelausschlag. Was gegen Windelausschlag gut ist, ist auch gut gegen die Pranken eines Metzgers.
Wir fuhren mit dem Zug. Mathilde sah prachtvoll aus. Kurz vor der Abreise hatte sie im Zentrum von Heidelberg in einem kleinen Modegeschäft, betrieben von zwei älteren Damen, noch eine schöne Bluse gefunden.
Die beiden Damen hatten sich um mich gekümmert. Mathilde probierte die Bluse in der Umkleide an. Sogar ein Stück Wurst hatten die beiden Damen für mich. Wahrscheinlich eins, das sie selbst nicht mehr mochten.
Ich hatte rote Flecken im Gesicht, am Bauch, an den Armen und Händen. Das Ekzem war wieder schlimmer geworden. Schlimm, aber nicht so schlimm, dass man dachte: Igitt!, man dachte vielmehr: Herrje!
Ich war ja noch so jung. Ich brauchte nichts zu tun, um zu bezaubern und zärtlich zu stimmen, nur da sein, atmen und gucken.
»Was hat denn der Doktor gesagt?«, fragte eine der Damen.
»Es ist eine Pilzinfektion«, rief meine Mutter aus der Kabine.
Da kamen sie mit der Wurst. Sie waren komplett auf mich konzentriert.
Ich hatte große, unschuldige blaue Augen, in meinem Fall hundert Prozent ein Spiegel meiner Seele. Augen, die sagten: Und doch ist der Mensch gut.
Ich aß die Wurst, ich kannte meine Aufgabe. Ich ließ es mir schmecken.
Mathilde kam aus der Anprobe und fragte: »Und – war’s lecker?«
Wir waren ein gutes Team, Mathilde und ich, wir waren perfekt aufeinander eingespielt. Unterwegs nach Hause zeigte sie mir ihre Beute: eine Seidenbluse, irgendwo zwischen Rot und Rosa. Bei Blusen hatte Mathilde einen konservativen Geschmack.
Ich interessiere mich nicht für Kleidung. Es geht um das Spiel. Und damals ging es mir um Mathilde. Die Welt sollte sie genauso bewundern wie ich. Nicht nur für animalische Anziehungskraft, auch für meine Mathilde möchte ich Propagandaminister sein, um wie ein Verkehrspolizist die Verehrung des Volkes in ihre Richtung zu lenken.
II
DAS KIND VOM SONNENHÜGEL
1
Haus Sonnenhügel war die erste Pension in Baden-Baden, bei der Mathilde sich bewarb.
Die Pension lag in der Nähe eines Waldes, im Werbeprospekt stand, dass ein Park dazugehöre, doch das war übertrieben. Hinter dem Haus lag ein kleiner Garten, in dem vier Liegestühle standen, die nicht den Eindruck erweckten, als ob in den vergangenen fünf Jahren irgendjemand darauf gelegen hätte, höchstens ein kranker Hund.
Der Garten wurde von einem morschen Holzzaun umgeben, und ganz hinten, unter einem großen Tannenbaum, stieß der Gast auf eine verrostete Schaukel.
Die Besitzerin empfing uns im Frühstücksraum. Die Tischdecken waren vom vielen Waschen leicht ergraut, aber immerhin sauber. Mathilde erzählte von ihren Erfahrungen im Heidelberger Hotelwesen, bis auf die Bratwurst natürlich.
»Wenn ich Kinder hätte«, sagte die Besitzerin von Haus Sonnenhügel, »säße ich jetzt längst am Comer See und würde die Beine hochlegen.« Daraufhin warf sie Mathilde und mir einen kritischen Blick zu und sagte: »Ich will’s mal zwei Wochen mit Ihnen versuchen.«
Nach zwei Wochen sagte sie: »Du darfst bleiben.«
Mathilde musste sofort Vorhänge nähen. Gerade als ihre Probezeit ablief, hatte die Besitzerin nämlich beschlossen, überall neue Vorhänge aufzuhängen. Das war höchste Zeit, denn was da hinge, sagte Mathilde, dafür könne man sich nur noch schämen. Und das wollte was heißen, denn Mathilde schämte sich so schnell für gar nichts.
Die Pension hatte achtzehn Zimmer, davon vier mit eigener Dusche und WC. Die anderen mussten mit Dusche und WC auf dem Flur vorliebnehmen. Nachts hörten wir die Gäste durchs Haus irren. Sie rüttelten an den falschen Türen, stolperten, fluchten. Haus Sonnenhügel brachte nicht das Beste im Menschen zum Vorschein.
Es gab Stammgäste, die einen ganzen Sommer lang blieben. Oder den ganzen Herbst. Für weniger als drei Nächte brauche man es gar nicht erst zu versuchen, sagte die Besitzerin, die Mathilde und ich »Frau Schatz« nannten. Weil sie immer »Schatz« zu mir sagte. Sie weigerte sich, mich »François« zu nennen, der Name war ihr zu fremdländisch. Auch Mathilde nannte mich selten beim Namen, sie nannte mich »Kind« und, wenn sie gute Laune hatte, »mein kleines Lepeltier«.
Doch Frau Schatz nannte mich »Schatz«.
Jeden Abend wurde für die Gäste gekocht. Der Küchenchef, gleichzeitig Gärtner und Chauffeur, war ein Flüchtling aus dem Osten. Die Pension warb damit, dass die Gäste am Bahnhof abgeholt würden. Das war seine Aufgabe. Zu Beginn der Saison stand er fast jeden Tag am Bahnhof von Baden-Baden. Er schleppte sich mit Koffern den Rücken krumm. Einen Fahrstuhl gab es in der Pension nicht. Sonnenhügel war ein altes Haus, in dem, wie Frau Schatz erklärte, früher mal eine Diplomatenfamilie gewohnt hatte.
Regelmäßig musste Mathilde den Flüchtling mit einer speziellen Salbe einreiben, weil die Bandscheiben ihm zu schaffen machten. Auf der Brust hatte er große Narben. Er behauptete, er sei ein politischer Flüchtling, aber was das Politische an seiner Flucht nun genau war, blieb immer im Dunkeln. Er stamme aus dem Osten. Das war seine Standardantwort, wenn man ihm Fragen nach seiner Vergangenheit stellte.
Montags hatte der Flüchtling frei, das war der einzige Tag in der Woche, an dem Frau Schatz selbst kochte. Darum ging er am Tag zuvor immer aus. Jeden Sonntagabend gegen acht Uhr verschwand er in einem fleckigen Anzug, um erst früh am nächsten Morgen wiederzukommen, Bandscheiben hin oder her. Der politische Flüchtling kannte Baden-Baden wie seine Westentasche, er lief quer durch Gärten, Parks und – wenn es sein musste – auch durchs Gebüsch. Ampeln gab es für ihn nicht. Er nahm immer den kürzesten Weg.
Wenn Mathilde mit den Zimmern fertig war, nähte sie an den Vorhängen weiter. Ich saß in einem wassergefüllten Wännchen auf dem Balkon, und Frau Schatz brachte mir Eis am Stiel, das sie umsonst bekommen hatte, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war.
Mathilde und ich haben uns nie um gesunde Ernährung gekümmert. Reformhäuser ignorierten wir. Wegen meines Ekzems waren wir ab und zu beim Diätologen, aber länger als drei Tage hielten wir keine Diät durch. Unser Leben hatte keine Richtung. Das anderer Leute auch nicht, aber die taten immerhin noch so. Oder sie versuchten, ihm mit aller Gewalt eine Richtung zu geben. Wir nicht. Wir ließen das Leben laufen. Wir trieben dahin. Ein bisschen eitel waren wir schon, aber nicht so, dass wir dem Leben unseren Willen aufzwingen wollten. Noch nicht zumindest.
Ungefähr drei Monate lang ging alles gut. Mathilde dachte nicht an das Eigentum anderer Leute, auf jeden Fall nicht genug, um sich an diesem Eigentum zu vergreifen. Doch dann sah sie einen Gürtel. Nicht mal in der Pension, sondern in einem Laden. Sie musste ihn unbedingt haben. Die Versuchung kleidete sich in die Gestalt eines Gürtels, das Glück wurde ein Gürtel aus seltenem Leder. Für dieses Drecksding beging ich meine vierte notwendige Sünde.
Ich war ein mageres Kind mit struppigem Haar und roten Flecken. Obwohl bei der Geburt nicht so groß wie Mathilde als Baby, war ich doch ziemlich groß für mein Alter. Meine Motorik war hölzern und ungeschickt, wie bei jemandem, der nach schwerer Operation zum ersten Mal wieder selbständig geht.
All dies hört sich vielleicht wie ein Klagelied an, doch das ist nicht meine Absicht. Ein Mangel an schulischer Bildung hatte mich außerordentlich begabt für die praktischen Dinge des Lebens gemacht. Wer unterschätzt wird, kommt leichter ans Ziel.
Man hielt mich für zurückgeblieben. Und trotzdem wirkte ich entwaffnend. Oder gerade darum. Wenn man mich zum Betteln auf die Straße geschickt hätte, wäre ich ein erfolgreicher Bettler geworden.
Meine Kleidung: ein Sammelsurium, aber sauber. Mein Deutsch: schlagfertig, aber rudimentär. Schreiben: nicht die Bohne. Lesen: zu schlecht für ein Kind in meinem Alter. Und außerdem waren da noch: die Windeln.
Frau Schatz gab mir ab und zu Bilderbücher, manchmal auch solche, die man mit in die Wanne nehmen konnte, weil sie im Wasser nicht untergingen. Auch verwöhnte sie mich regelmäßig mit Nachspeisen, die die Gäste stehen gelassen hatten. Abends servierte Frau Schatz ein Menü, bestehend aus Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch, in der Regel Eis. »Obst nach dem Essen ist gar nicht gesund«, erklärte Frau Schatz jedem, der es hören wollte. »Obst vor dem Essen, das ist gesund.«
Mein Vertrauen in die Güte der Menschen nahm zu. Wer nichts zu geben hatte, gab immerhin noch Essensreste. Und trotzdem machte fast jeder – das Zimmerpersonal, die Gäste, der Koch, die Lieferanten – Frau Schatz schlecht. Ihrerseits jedoch redete sie genauso schlecht über die Lieferanten, den Koch, die Gäste und den Gärtner. Der Wettstreit des Schlechtmachens zwischen Frau Schatz und der Welt schien mir dazu verurteilt, mit »Unentschieden« zu enden.
»Das Kind braucht Anregung«, sagte Frau Schatz – zweifellos, um ihr Gewissen zu beruhigen, jetzt, da sie Mathilde viel zu viel für zu wenig Geld arbeiten ließ. Und Anregung brachte mir Sonnenhügel, Sonnenhügel war meine Kita, meine Schule, mein Sport- und Spielplatz, mein erstes Lotterbett, meine Universität. Wer Sonnenhügel einmal von innen gesehen hat, weiß, dass Sonnenhügel im Grunde überall ist. Man kann noch so genial sein, das spielt keine Rolle. Alles, was man auf der Welt sieht, ist Sonnenhügel.
Einer unserer Stammgäste – ich sage hier: »unserer«, denn ich gehöre zu einer untergegangenen Welt, und diese untergegangene Welt gehört zu mir – war ein langer, dürrer Mann, der seit fünfzehn Jahren jeden Sommer in die Pension kam. Und seit zwei Jahren auch ein paar Wochen zu Ostern.
Nach dem Abendessen rauchte er unabänderlich eine Zigarre, und den Tag verbrachte er in der Stadt. Ausflüge mochte er nicht, in der Sonne sitzen fand er lebensgefährlich. Man sagte, er sei ein genialer Biochemiker. Hin und wieder warf er Mathilde einen schwülen Blick zu und sie ihm.
»Ich habe Unmengen Zeit«, sagte er. Er war seit Kurzem pensioniert.
Sonnenhügel war das Urlaubsziel für Leute mit zu viel Zeit.
Am Gründonnerstag ging Mathilde mit mir in das Geschäft für Damenhandtaschen, Gürtel und andere Accessoires. Sie hatte mir aufgetragen, im Laden einen Anfall zu bekommen.
Andere Kinder hätten es vielleicht schrecklich gefunden, auf Befehl ihrer Mutter in aller Öffentlichkeit einen Anfall vortäuschen zu müssen, und würden Jahre später deswegen Zehntausende für einen uninteressierten Therapeuten ausgeben. Ich aber fand das Ganze nur herrlich. Von Zeit zu Zeit wusste ich ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit durchaus zu schätzen.
In unserem kleinen Zimmer hatten wir den Anfall zuvor dreimal geprobt. Mathilde war eine hervorragende Regisseurin.