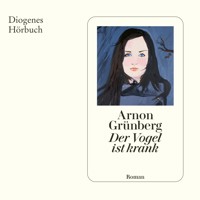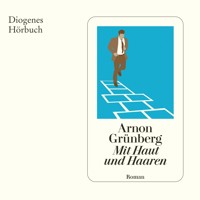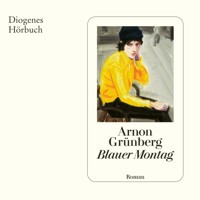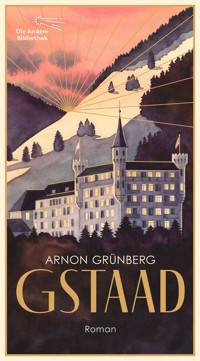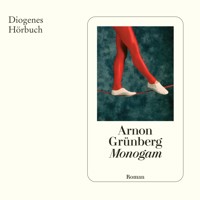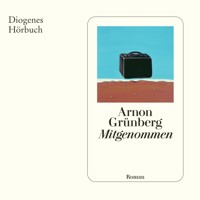10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Robert G. Mehlman, Mitte dreißig, steht zwischen drei Frauen und vor dem Bankrott. Galgenhumor ist seine letzte Überlebenschance. Auch dann, wenn er statt Gefühlen nur noch einen Phantomschmerz empfindet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Arnon Grünberg
Phantomschmerz
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Diogenes
I Harpo
»Ich hab das Zeug zum Monarchen«, sagte Robert G. Mehlman eines Abends. Wir saßen auf der Terrasse des Santa-Caterina-Hotels in Amalfi. Es war kalt für die Jahreszeit. Er trug seinen blauen Mantel. An seinen Lippen klebten Erdnußreste. Er roch anders als früher. Nach Kellern, in denen viel getanzt und nie gelüftet wurde. Auf seiner weißen Sommerhose war ein Soßenfleck, und seine Hände zitterten wie kleine, kranke Vögel, die emporfliegen wollen, aber immer wieder auf den Boden fallen.
Mehlman war mit drei Schrankkoffern und einer großen Tasche voll ungeöffneter Post durch ganz Europa gereist, und jetzt war er im Hotel Santa Caterina abgestiegen, wo er ein Zimmer mit Aussicht aufs Meer zum halben Preis bekommen hatte, weil die Saison in diesem Jahr einfach nicht losgehen wollte.
Früher reiste er mit seinem Sekretär, doch der hatte sich aus dem Staub gemacht.
Als ich kam, um ihn zu sehen, wollte Mehlman mich zuerst nicht empfangen. »Hau ab«, rief er, »du siehst doch, was mit mir los ist!«
Ich wollte sofort wieder abreisen, schließlich hatte ich die ganze Reise nicht gemacht, nur um mich von ihm anschnauzen zu lassen. Aber am Telefon sagte meine Mutter: »Bleib erst mal da, er ändert seine Meinung sicher wieder.«
Beim Frühstück am nächsten Morgen hatte er tatsächlich seine Meinung geändert. »Was du da anhast«, sagte er, »das Zeug, das mußt du wegwerfen.«
Zwei Kellner starrten mürrisch auf den grauen Himmel. Die Saison war schon drei Wochen überfällig. Ein Österreicher fragte in schlechtem Italienisch: »Wann geht hier ein Zug nach Süden?«
»Hier fahren keine Züge«, sagte der Kellner auf englisch. »Wenn Sie nach Süden wollen, müssen Sie ein Taxi nehmen.« Der Kellner stellte sich an unseren Tisch. »Stimmt es, daß Sie heute zahlen möchten, Meneer Mehlman?«
Mehlman nickte, und der Kellner sagte, während er aufs Meer starrte: »Ja, wenn ein Gast erst mal da ist, wird man ihn so schnell nicht wieder los.«
Unter dem Tisch stand die Tasche voll ungeöffneter Post. Mehlman kramte darin herum, holte eine Rechnung hervor, betrachtete sie flüchtig und zerriß sie in tausend kleine Schnipsel. »Sie wissen ja doch nicht, wo ich bin«, sagte er, »und bis sie mich gefunden haben, bin ich längst tot.«
Er wischte sich etwas Marmelade von den Lippen und bestellte ein Glas Whisky. Der Kellner wollte gehen, doch er hielt ihn zurück. »Als ich so alt war wie du«, sagte er, »hatte ich auch noch Haare, und was für welche!«
»Das Leben rast wie ein D-Zug«, sagte der Kellner und starrte weiter aufs Meer.
Die Haare, die Mehlman noch hatte, waren weiß und standen in alle Richtungen.
»Jetzt ist es fast ein Jahr her«, sagte er.
»Was«, fragte ich, »was ist ein Jahr her?«
»Daß mein Sekretär abgehauen ist.«
Der Österreicher stand auf. »Und gibt’s hier Taxis, die in den Süden fahren?« fragte er mit lauter Stimme.
Alle im Frühstücksraum sahen ihn an. Viele waren es nicht, es gab mehr Kellner als Gäste.
Ein älterer Herr am Fenster mit mindestens fünf ausländischen Zeitungen vor sich sagte mit affektierter Stimme: »Ich komme schon seit dreißig Jahren hierher, ich weiß mehr über diesen Ort als das Personal. Wenn Sie ein Taxi in den Süden wollen, kann ich Ihnen ruckzuck eins besorgen.«
Eine Dame, die sich am Buffet gerade Ananasstückchen auf den Teller legte, rief: »Meine Eltern kamen auch schon immer hierher, und ich sage Ihnen: Fahren Sie nicht in den Süden, weiter südlich kommt nichts mehr, nur noch Armut.«
Der Österreicher legte keinen Wert auf ihre ungebetenen Ratschläge. »Wenn ich in den Süden will, ist das meine Sache.«
»Genau«, sagte der Herr mit den Zeitungen, »und wenn Sie ein Taxi möchten, kommen Sie zu mir. Ich kenne jeden hier im Dorf.« Er blickte triumphierend um sich, und weil niemand reagierte, fuhr er fort: »Als ich sechzehn war, sagte mein Lateinlehrer zu mir: ›Henri, die meisten Leute sind tot, weck sie nicht auf.‹ Aber ich hab mich nicht um seinen Ratschlag geschert, ich habe sie wach gerüttelt, wo immer ich konnte.«
»Hättest sie besser schlafen lassen«, murmelte Mehlman.
Die Dame, die noch immer mit ihren Ananasstückchen kämpfte, kam auf ihr Lieblingsthema zurück: »Südlich von hier beginnt die Armut, ich bin da gewesen, zuerst mit meinen Eltern und vor fünf Jahren noch mal allein, und nichts hatte sich geändert.«
Mehlman schmierte sich bedächtig ein Brötchen mit Marmelade. Ich glaube nicht, daß er wirklich vorhatte, das Brötchen zu essen.
»Ich will nicht wach gerüttelt werden«, sagte der Österreicher, »ich will in den Süden, ich brauche Sonne, ich hab’s im Kreuz.«
Einige Kellner begannen schon wieder für den Lunch zu decken. Ich bekam den Eindruck, daß manche Gäste den ganzen Tag hier saßen und auf die nächste Mahlzeit warteten; erst nach dem Abendessen kehrten sie in ihre Zimmer zurück. Höchstens zwischen fünf und sechs gingen sie vielleicht mal kurz runter ins Sportcenter zum Tischtennisspielen.
»Du mußt sterben, bevor dein Geld alle ist«, sagte Mehlman, »und nicht umgekehrt, sonst wirst du den Menschen nur zur Last. Und das haben sie nun auch wieder nicht verdient.«
Robert G. Mehlman ist mein Vater. Auch wenn er das in seinen Anfällen wilder Raserei immer wieder abstritt. »Ich – dein Vater?« rief er dann. »Du weißt doch, was deine Mutter für eine ist!«
Als ich geboren wurde, hatte der Ruhm Robert G. Mehlmans seinen Höhepunkt erreicht. Er war mehr als ein großes Talent. Doch nach fünf Jahren war von diesem Ruhm nicht mehr viel übrig, meine Mutter verglich meinen Vater oft mit einem Strauß Rosen, der zu lange ohne Wasser in der Vase gestanden hat.
Wahrscheinlich wurde ich gezeugt, weil mein Vater ein einziges Mal in seinem Leben ein Versprechen halten wollte. Weil meine Erzeuger sich in einer Krise befanden und nicht wußten, was sie taten. Doch wichtig ist nur, daß ich gezeugt wurde; warum, spielt keine Rolle. Obwohl mein Vater das natürlich auch wieder abstreiten würde. »Jedes Detail ist wichtig«, würde er sagen, »nichts darf unserer Aufmerksamkeit entgehen.«
Aber so ist es natürlich nicht. Viele Details sind unwichtig. Die meisten, um genau zu sein. Was hier eine Rolle spielt, ist nur, daß ich an einem kalten Januartag in einem Hotel in Long Island geboren wurde.
Am Anfang der Schwangerschaft hatten meine Eltern noch über die Vorteile einer Abtreibung gesprochen, doch diese Gespräche dauerten so lange, daß es schließlich zu spät dafür war. Meiner Mutter, die unbedingt ein Kind wollte, waren plötzlich Zweifel gekommen. Eine Geburt schien ihr ein Alptraum, doch eine Abtreibung auch, und zu guter Letzt fand sie, daß eine Geburt dann immer noch der erträglichere Alptraum war.
Meine Eltern waren gerade für ein paar Tage auf Urlaub in Montauk. Mein Vater liebte es, in Hotels zu arbeiten. Die Wehen kamen früher als erwartet. Sie wollten ins Krankenhaus, doch es war schon zu spät. Man holte eine Hebamme. Sehr viel hat die auch nicht mehr tun können.
Während der Geburt betrank sich mein Vater im Hotelrestaurant. Mit Aussicht aufs Meer. Der Rechnung zufolge, die er für mich aufhob und mir an meinem vierzehnten Geburtstag – mit Rahmen und allem Drum und Dran – überreichte, muß er an jenem Abend zwei Flaschen Chianti, vier Gläser Grappa und zwei Flaschen Champagner bestellt haben. Ich vermute, daß der Chianti und der Grappa vor meiner Geburt und der Champagner danach bestellt wurden.
Auch scheint er an jenem Abend – doch hierzu gehen die Meinungen auseinander – eine Kellnerin um ihre Hand gebeten zu haben. Meine Mutter heulte, ich kreischte wie besessen, die Hebamme schlug mir auf den Hintern, und zwei Stockwerke unter uns machte mein Vater einer anderen einen Heiratsantrag.
Bei meiner Beschneidung fiel mein Vater in Ohnmacht. Nicht wegen des Bluts oder weil er es nicht ertragen konnte, daß mir Schmerzen zugefügt wurden, sondern einfach, weil es für ihn der bequemste Ausweg war. Eine Freundin von ihm – meine Mutter konnte sie nicht ausstehen und nannte sie »die hohle Nuß« – war auch zu meiner Beschneidung gekommen. Dem Vernehmen nach hat meine Mutter gerufen: »Wenn die hohle Nuß kommt, findet die Beschneidung nicht statt.« Doch da saß die hohle Nuß schon lange in ihrer Bank.
Kurz darauf fiel mein Vater in Ohnmacht. Sie haben ihn mit süßem Rotwein wieder zu sich gebracht. Und meine Oma, die angesichts des Todes eine Vitalität entwickelte, die ihr heute so schnell keiner nachmacht, rief, sie sollten vorsichtig sein, weil mein Vater ein sehr empfindsamer Mensch sei. Als er wieder zu sich kam, versuchte er, so gut es ging, die hohle Nuß und meine Mutter voneinander entfernt zu halten. Meine Beschneidung war offenbar die erste in einer Kette kleinerer und größerer Katastrophen, obwohl vor allem meine Mutter davon überzeugt gewesen war, daß ein Kind eine heilende und beruhigende Wirkung auf meinen Vater ausüben würde.
Während der Arzt das Messer an meinem Geschlecht ansetzte, flüsterte meine Mutter: »Welcher Teufel hat dich geritten, diese hohle Nuß einzuladen, hast du denn gar keinen Respekt mehr vor mir?« Und mein Vater flüsterte: »Das ist nicht der richtige Moment, laß uns ein andermal darüber sprechen.« Aber das flüsterte er immer.
David, der beste Freund meines Vaters, mit dem er schon zusammen zur Schule gegangen war, versuchte die Wogen zu glätten, doch umsonst. »Ich habe wenig Verständnis für dein Verhalten, und bewundern kann ich’s schon gar nicht«, soll er meinem Vater ins Ohr geflüstert haben. »Worauf hast du dich da eingelassen, warum läßt du dir so auf der Nase herumtanzen?« Und meine Mutter soll gerufen haben: »Hör auf, David, mach ihn nicht noch verrückter, als er schon ist.«
So gingen meine Eltern völlig in einer Diskussion über eine hohle Nuß auf, während ich beschnitten wurde.
In den ersten Jahren meines Lebens wohnten wir in New York. Es war die Idee meines Vaters, mich Harpo zu nennen. Und weil meine Mutter auch noch einen normalen Namen wollte, kam Saul dazu. Harpo Saul Mehlman, so heiße ich.
Auf die Geburtsanzeigen hatte mein Vater folgenden Text drucken lassen: »Harpo Saul Mehlman gibt sich die Ehre, Ihnen sein Entree in die Welt bekanntzugeben, und sendet Ihnen viele Küßchen«, was meine Mutter nachträglich betrachtet doch nicht so eine gelungene Idee fand.
Daß es schlicht tierisch ist, sein Kind Harpo zu nennen, steht außer Frage. Natürlich gibt es noch viel mehr tierische Namen, aber Harpo ist doch so ziemlich der schlimmste.
Mein Vater arbeitete an seinem Opus magnum, meine Mutter in einer Tagesklinik für psychisch Gestörte. Ihr berühmtester Patient war ein Mann, der mit der Wand redete, in der Annahme, dem Geheimdienst auf diesem Wege Nachrichten zu übermitteln. Als der Geheimdienst nicht auf seine Berichte einging, wurde er destruktiv. So landete er bei meiner Mutter. Über diesen Mann hat sie promoviert. Dank meiner Mutter erkannte er, daß er zwanzig Jahre lang umsonst mit einer Wand geredet hatte. Diese Erkenntnis war zuviel für ihn, und er stürzte sich in einen Fahrstuhlschacht. Das war ein Wermutstropfen in der Promotionsfeier meiner Mutter, schließlich war er dort als Ehrengast geladen worden. Nach diesem Vorfall veröffentlichte sie einige Artikel, in denen sie die Frage aufwarf, ob es wirklich vernünftig sei, Menschen völlig von ihren Wahnideen zu heilen.
Die Psychiatrie hat sich mein Vater immer vom Hals gehalten. Obwohl er jahrelang dreimal wöchentlich zu einem Therapeuten ging, und zwar – wie er sagte – zu keinem anderen Zweck als dem, den Therapeuten zum Lachen zu bringen. Hatte der Therapeut mindestens einmal gelacht, war die Sitzung gelungen. Als er kurz nach der Scheidung den Therapeuten einmal nicht zum Lachen bringen konnte, brach mein Vater die Therapie abrupt ab und versank in eine tiefe Depression.
Übrigens wußte meine Mutter, daß mein Vater seinen Therapeuten als Versuchskaninchen für die Geschichten benutzte, die er später aufschrieb und in die Welt schickte. Verständlicherweise hatte sie ihre Zweifel, ob man einen Therapeuten für diesen Zweck benutzen sollte, doch mein Vater fand es eine geniale Idee. Außerdem, sagte er, heiligte der Zweck die Mittel.
Meiner Mutter zufolge war die Psychiatrie Robert G. Mehlman gegenüber machtlos. Jeder andere hätte dies wahrscheinlich als eine Beleidigung aufgefaßt, mein Vater hielt es für ein Kompliment. »Den Therapeuten, der mich heilen kann, nehme ich in mein Testament auf«, hörte ich ihn oft sagen. Dann trommelte er mit den Fingern auf dem Tisch.
Nach seinen Worten würde ein Therapeut, der ihn zwei Jahre lang intensiv behandelte, selbst im Irrenhaus landen. Nach Meinung meiner Mutter, die schließlich doch fast zwanzig Jahre mit ihm die Wohnung geteilt hatte, war er damit ausnahmsweise einmal ganz nahe an der Wahrheit.
Morgens arbeitete mein Vater, nachmittags gingen wir ins Kino. Fast nirgends bin ich in den ersten zehn Jahren meines Lebens so oft gewesen wie im Kino. Oft sahen wir mehrere Filme am selben Tag, manche sogar zwei- oder dreimal.
Dies sind meine ersten Erinnerungen: Mein Vater und ich rennen von Film zu Film, während meine Mutter Patienten heilt, die sich mit der Wand unterhalten.
Mein Vater war Schriftsteller. Meine Achtung vor Literatur und Schriftstellern ist noch kleiner als die vor Männern im allgemeinen. Wer in der Küche eines Restaurants aufwächst, hat von Restaurants vermutlich auch eine andere Meinung. Und der Sohn eines Glasbläsers wird ein Stück Glas nie genauso betrachten können wie irgendein unwissender Laie.
Während jeder glaubte, daß mein Vater an seinem Opus magnum schrieb, und ich vor ihm auf dem Boden mit Bergen von Spielsachen beschäftigt war, schrieb er in Wirklichkeit Briefe. Briefe an mich, Briefe an die Gasversorgungsgesellschaft, Briefe an die Bank, Briefe an die hohle Nuß, Briefe an Leute, von denen er glaubte, daß sie ihn übers Ohr hauen wollten, Briefe an Unbekannte, denen er in Kneipen begegnet war und denen er auf hinterhältige Weise die Adresse abgeluchst hatte.
Später, als der Verleger ungeduldig wurde, weil der Liefertermin für das Opus magnum immer wieder verschoben wurde, entschloß sich mein Vater, seine Briefe an mich zu publizieren, und zwar unter dem Titel Briefe an Harpo. Übrigens ohne mich hierfür um Erlaubnis zu fragen.
Seinen ersten Brief an mich schrieb er, als ich ungefähr fünf Monate alt war.
Lieber Harpo,
wenn Du dies liest, bin ich ein alter Mann, höchstwahrscheinlich kahlköpfig, und das wird noch das geringste von allen Übeln sein, die mich erwarten. Möglicherweise bleiben nicht mal Haare auf dem Rücken mir erspart. Trotzdem möchte ich Dich schon jetzt, wo Du noch keine fünf Monate alt bist, dazu ermahnen, Dir später immer die Zeit für einen guten Lunch zu nehmen. Anderthalb Stunden Lunch sind kein Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit. Welche Arbeitsbedingungen Dich in der Zukunfl auch immer erwarten, bestehe auf mindestens anderthalb Stunden Mittagspause. Ein langer Lunch bricht dem Tag das Genick, und das ist, glaub mir, das mindeste, was man tun kann, denn die Tage sind auch so schon lang genug.
Hier muß ich aufhören, denn gleich kommt Deine Mutter, und wir wollen ja wenigstens, daß die Wohnung auf den ersten Blick ein bißchen aufgeräumt aussieht und ich meine Schuhe wie versprochen beim Reinkommen ausgezogen habe, damit die Putzfrau nicht umsonst gewischt hat. Auch dies laß Dir bereits jetzt von mir gesagt sein: Wischen ist immer umsonst. Wenn Du Dir das schon mal merkst, kommt der Rest von allein.
Dies war der erste von ungefähr fünfhundert Briefen an mich, die mein Vater später, als er in Geldnot war, versteigern ließ, mit dem Versprechen, sie innerhalb weniger Monate wieder für mich zurückzukaufen.
Ab meinem sechsten Lebensjahr nahm mein Vater mich in Kneipen, Bars, Kaffeehäuser und Hotelfoyers mit, wo wir irgendwelche Leute trafen. Fast immer waren es Frauen.
Für eine kauften wir einmal ein Kleid. Sie hatte lange, braune Locken, und alle fünf Minuten fiel sie meinem Vater um den Hals. Ich mußte sie Tante nennen.
Wir gingen in viele Geschäfte. Überall wurden Kleider anprobiert. Irgendwann hatte ich genug davon. Ich wollte nach Hause. Doch mein Vater sagte: »Paß gut auf, das hier ist lehrreich.«
Später, als wir nach Hause gingen, fragte ich: »Warum hast du der Tante ein Kleid gekauft?«
»Ist dir das nicht aufgefallen?« fragte mein Vater. »Sie brauchte unbedingt ein Sommerkleid.«
An dem Tag schrieb mir mein Vater:
Lieber Harpo, heute haben wir ein Sommerkleid für die Frau gekauft, die Deine Mutter »die hohle Nuß« nennt. Irgendwann einmal wirst du begreifen, daß diese Frau keine Nuß und auch längst nicht so hohl ist, wie Deine Mutter behauptet. Natürlich hat Deine Mutter ein paar gute Gründe, diese Frau so zu nennen, doch ich kann ein paar ebenso gute Argumente aufzählen, die das Gegenteil beweisen. Auch das wirst Du wahrscheinlich irgendwann einmal begreifen.
Es gibt Leute, die finden, daß ich Dich nicht mitnehmen sollte, wenn ich der hohlen Nuß Kleider kaufe. Abgesehen von dem praktischen Problem, wo ich Dich dann lassen sollte, kann ich Dir versichern, daß Du Dich, was immer irgendwelche Therapeuten Dir später auch einmal weismachen werden, heute ausgezeichnet amüsiert hast. Du bist auf Regale geklettert, in Umkleidekabinen eingedrungen, wo Frauen teure Kleider anprobierten, und hast alte Damen bezaubert, als wolltest Du einmal Deinen Beruf daraus machen.
Es gibt auch Leute, die finden, daß ich der hohlen Nuß überhaupt keine Kleider kaufen sollte, egal, ob Du nun dabei bist oder nicht. Mein Buchhalter zum Beispiel. Es ist noch keine drei Tage her, da schrieb er mir: »Lieber Freund, wie Du sicher gemerkt haben wirst, sind Deine Einkünfte nicht mehr das, was sie einmal waren. Wäre es nicht vernünftig, Deine Konsumgewohnheiten dieser neuen Situation – die zweifellos nur vorübergehender Natur ist – ein wenig anzupassen?«
Lieber Harpo Saul, falls Du später auch einmal solche Briefe von Deinem Buchhalter bekommen solltest, versprich mir, Sommerkleider zu kaufen, als ob Dein Leben davon abhinge. Ich hoffe natürlich, daß Dir diese Art Briefe erspart bleibt, daß Du gar keinen Buchhalter brauchst oder wenigstens einen hast, der sich nicht in Deine Konsumgewohnheiten einmischt.
Jetzt schläfst Du im Nebenzimmer, endlich, nachdem Du massenweise Vanilleeis in die Gardinen geschmiert hast. Das gibt wieder Ärger, wenn Deine Mutter das sieht! Sie hat wieder den ganzen Tag versucht, Patienten von ihren Wahnvorstellungen zu befreien. Was für ein Leben. Zum Glück habe ich sie rechtzeitig wissen lassen, daß sie von meinen Wahnvorstellungen die Finger lassen soll und von Deinen auch. Wenn Du schon welche haben solltest. Das weiß ich ja nicht. Aber ich glaube schon. Jedenfalls hat sie feierlich versprochen, von unseren Wahnvorstellungen die Finger zu lassen.
Vier kleine, zärtliche Küßchen, zwei auf die Füße, einen auf den Nabel und einen auf die kleine Stirn.
Beim Abendessen erzählte ich meiner Mutter, daß wir ein Kleid gekauft hatten.
»Lieber Gott«, sagte sie, »bestimmt wieder für die hohle Nuß!«
Es war das erste Mal, daß ich mitbekam, wie meine Mutter sie nannte. Daß sie schon bei meiner Beschneidung gegen die hohle Nuß gewütet hatte, weiß ich nur aus den Erzählungen meines Vaters. Ab und zu sprach sie auch von »diesem Troll« oder »dieser Schlampe«, doch sie meinte immer dieselbe Person.
»Warum nimmst du unser Kind mit, wenn diese hohle Nuß dabei ist?« rief meine Mutter und schob den Teller Mozzarella von sich. Ich nehme einfachheitshalber mal an, daß sie gerade Mozzarella aß, denn das war ihre Lieblingsvorspeise, und sie bestellte sie fast jeden Tag.
»Wo soll ich den Jungen denn sonst lassen?« rief mein Vater. »Soll ich ihn vielleicht in eine Irrenanstalt stecken? Irrenanstalt hat er schon zu Hause genug!«
»Ich will nicht, daß unser Kind und die hohle Nuß einander begegnen«, fuhr meine Mutter unerschütterlich fort und packte meinen Vater am Arm.
»Sie sind einander nicht begegnet«, sagte mein Vater triumphierend. »Die hohle Nuß hat das Kind völlig ignoriert.«
»Um so schlimmer«, rief meine Mutter. »Man darf Kinder nicht ignorieren. Es ist eine Schande, daß sie Harpo nicht mal ein bißchen Aufmerksamkeit gewidmet hat.«
Hieran merkt man, daß meine Eltern – obwohl sie es gesellschaftlich ziemlich weit gebracht hatten – beide nicht ganz bei Trost waren.
»Hat die Tante dich ignoriert?« fragte meine Mutter.
Die Tante war vollkommen mit Kleideranprobieren beschäftigt gewesen, doch es schien mir klüger, nichts darüber zu sagen. »Es geht«, murmelte ich.
»Ich will nicht, daß das Kind und die hohle Nuß einander jemals wieder begegnen«, sagte meine Mutter und packte meinen Vater zum zweiten Mal fest am Arm, so fest, daß er einen blauen Fleck bekam.
Darauf sagte mein Vater in einer Lautstärke, daß das ganze Lokal ihn hören konnte: »Es ist mir unbegreiflich, daß nicht noch viel mehr gesunde, intelligente Leute denken, sie wären Jesus persönlich.«
In all den Jahren, die meine Eltern zusammenwohnten, haben wir, glaube ich, nur ein einziges Mal zu Hause gegessen. Wir aßen in Restaurants, in Bars, in U-Bahn-Stationen, in Kaffeehäusern, Bowlingcentern, Kinos, Parks, auf Sportplätzen, in Stadien, in Zügen, Flugzeugen, Hotels, aber nie zu Hause. Mein Vater hatte die Küche mit Büchern vollgestopft, mit Papieren, Zeitungsausschnitten und Zeitschriften, und den Backofen benutzte er zum Aufbewahren von Wörterbüchern.
Als wieder einmal einer von den Patienten meiner Mutter Selbstmord begangen hatte, flehte sie meinen Vater an, nur dieses eine Mal zu Hause kochen zu dürfen, weil sie das beruhigen würde. Mein Vater weigerte sich, und meine Mutter sagte: »Du hast mir nichts zu verbieten.« Darauf begann sie, Butter in einem Kochtopf zu zerlassen, und mein Vater drehte durch. Er nahm mich auf den Arm und rannte auf die Straße. Während wir auf dem Bürgersteig standen, öffnete meine Mutter das Fenster und warf mit einer Hand ein paar Bücher hinunter. In der anderen hielt sie noch immer den Topf mit der Butter.
»Nicht, Mama«, schrie ich, »nicht, bitte, bitte nicht.«
Meine Mutter war mindestens so dickköpfig wie mein Vater. Wenn sie es sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, mit etwas zu werfen, war sie nicht mehr davon abzubringen.
Einmal hat sie meinen Vater ernsthaft verletzt, als sie ihm einen Schlüsselbund an den Kopf schleuderte. Ein andermal sah ich, wie sie mit einem Messer ein großes Loch in ein Wörterbuch bohrte.
Ohne ein Wort zu sagen, sammelte mein Vater seine Bücher wieder ein und legte sie mit einem kleinen Zettel in die Eingangshalle: »Eigentum von Robert G. Mehlman. Bitte Hände weg!«
Im Taxi auf dem Weg zum Kino sagte mein Vater: »Aggression ist ein Phänomen, das nicht nur in der Tierwelt, sondern auch beim Menschen vorkommt. Deine Mutter hat sechs Jahre studiert, um die menschliche Aggressivität beherrschen zu lernen.« Mein Vater schüttelte mich am Arm und sagte: »Sechs Jahre Studium, um die menschliche Aggressivität beherrschen zu lernen, verstehst du, was das heißt?«
Seit ich begriffen hatte, daß meine Eltern nicht ganz bei Trost waren und ich der einzige Normale in der Familie war, fühlte ich mich für sie verantwortlich. Obwohl ich nicht besonders religiös erzogen wurde, schrieb ich an jenem Abend einen Brief an Gott, in dem ich ihm erklärte, daß meine Eltern mich Harpo genannt hatten, daß sie Bücher aus dem Fenster warfen, nicht ganz bei Trost waren und es nicht einmal merkten, kurzum: daß seine Hilfe dringend erwünscht war. Später hat mein Vater den Brief gefunden und benutzt. So wie er alles benutzte.
An jenem Abend schrieb mir mein Vater:
Lieber Harpo Saul, mein kleiner, lieber, verrückter Sohn, offenbar ist es der Wille des Allmächtigen, alle Mehlmänner in einem Irrenhaus aufwachsen zu lassen. Schon ich wuchs in einem Irrenhaus auf, und jetzt also auch Du. Falls Du je Kinder haben solltest, würde es mich nicht wundern, wenn auch sie in einem Irrenhaus aufwachsen.
Nimm es Dir nicht so zu Herzen, wenn Deine Mutter ab und zu Bücher aus dem Fenster wirft, auch nicht, wenn Du dies später einmal liest und Dich noch vage an den bewußten Abend erinnerst, als sie das Fenster öffnete und meine Bücher wie Herbstlaub auf die Straße wirbelten. Bücher aus dem Fenster zu werfen ist eine relativ unschuldige Beschäftigung: Bedenke, daß sie auch mit Möbeln hätte werfen können oder mit kostbaren Vasen. Außerdem überleben Bücher einen Sturz aus zehn Metern Höhe, Menschen meistens nicht. Du mußt wissen, daß viele Patienten Deiner Mutter sich in Fahrstuhlschächte stürzen, eine Überdosis Ichweißnichtwas schluk – ken oder sich vor die U-Bahn werfen, und das geht ja nicht spurlos an einem vorüber. Obwohl ich ihr oft genug erklärt habe, daß man niemanden zurückhalten kann, wenn er sich wirklich in einen Fahrstuhlschacht stürzen will.
Ich habe Deine Mutter in einem Nachtgeschäft kennengelernt, wo ich zu später Stunde Lebensmittel verkaufte. Sie war Werkstudentin und ich Selbstmordkandidat, auch wenn ich das sorgfältig geheimhielt. Damals machte ich kaum etwas anderes, als durch die Straßen zu laufen und Briefe zu schreiben, die ich fast alle als Einschreiben verschickte, weil ich an der Wahnvorstellung litt, die Post würde sie sonst verschlampen. So lernten wir uns kennen. Den Rest erzähle ich Dir ein andermal.
Viele Jahre später, als ich in einer New Yorker Kneipe mit einer Fernsehjournalistin Kaffee trank, die acht Stunden geflogen war, um mir Fragen zu stellen, auf die ich keine Antwort wußte, stellte ich sie Deiner Mutter vor. Kaum war Deine Mutter auf der Toilette, flüsterte die Frau mir ins Ohr: »Sie ist auch nicht Ihre große Lie – be, was?« Einen Moment war ich sprachlos, dann antwortete ich: »Nein, natürlich nicht, meine große Liebe, das sind Sie.«
Morgen gehen wir Sandalen kaufen, damit Du wie ein kleiner Prinz durch die Straßen stolzieren kannst. Denn das ist wichtig.
Einmal pro Jahr kam Oma Mehlman auf Besuch. Sie wohnte immer im Sheraton, zwei Minuten zu Fuß von unserer Wohnung. Wenn sie ein Zimmer zur Straße hatte, klagte sie über den Lärm von draußen, wohnte sie nach hinten, klagte sie über laute Nachbarn. Tagsüber putzte sie unsere Wohnung oder paßte auf mich auf und klagte darüber, daß meine Mutter keine gute Hausfrau sei und daß es typisch für ihren Sohn war, solch eine Dreckwanze auch noch zu heiraten.
Meinen Großvater habe ich nie gekannt. Er scheint ein berühmter Tennisspieler gewesen zu sein. Meine Oma sprach immer von ihrem Mann, »dem berühmten Tennisspieler Aron Mehlman«. In Wirklichkeit jedoch hatte er es nie weiter gebracht als auf Platz 268 der Weltrangliste. Als er wieder einmal kurz davor war, schon in der ersten Runde in Wimbledon auszuscheiden, verlor er die Beherrschung, kletterte übers Netz und rückte seinem Gegner, einem jungen Mann aus Chile, mit dem Tennisschläger zu Leibe. Als sein Gegner sich losriß und wegrennen wollte, warf mein Opa sich auf den Rasen und biß ihn in die Wade. Der Chilene mußte mit einer geplatzten Lippe und einem Wadenbiß ins Krankenhaus, und mein Opa wurde vom Tennisverband auf Lebenszeit gesperrt.
Bei einer Pressekonferenz erklärte er, daß ihm der Tennisverband Betäubungsmittel in den Tee getan hätte und eine Verschwörung gegen ihn im Gange sei. Es war das einzige Mal, daß er auf den Titelseiten einiger Zeitungen erschien, unter Überschriften wie: »Tennisspieler wird zum tollwütigen Hund«.
Wenn ihm später mal etwas danebenging, rief er immer: »Ha, da steckt sicher wieder der Tennisverband dahinter!«
Mein Vater scheint mit dem Mythos aufgewachsen zu sein, daß sein Vater ein wichtiger und berühmter Tennisspieler war. Bis er schließlich dahinterkam, daß jener es nie weiter gebracht hatte als auf Platz 268 der Weltrangliste, den Kassiererinnen im Warenhaus aber trotzdem ständig verkündete: »Ich bin Aron Mehlman, der berühmte Tennisspieler aus den dreißiger Jahren.«
Als mein Vater sein erstes richtiges Buch Platz 268 der Weltrangliste publizierte, das ihn mit einem Schlag berühmt machte, war mein Großvater zum Glück innerlich schon vollkommen von seiner Demenz zerfressen. Er saß in einem Lehnstuhl am Fenster, und die Welt war ein fernes Rauschen. Dank seines Altersschwachsinns hat er nicht mehr zu lesen brauchen, daß sein Sohn ihn in dem Buch als Tyrannen und Mythomanen schilderte, der seiner Familie in Restaurants Befehle erteilte wie: »Sagt ihnen, daß ich Aron Mehlman bin, der berühmte Tennisspieler aus den dreißiger Jahren, und daß ich keine angebrannten Kartoffeln mag.«
Meine Oma meinte oft: »Ach, dieses Buch! Sie sagen ja, es wäre Literatur. Na, ich weiß nicht! Mir ist es zu düster. Die Leute haben doch schon Jammer genug bei sich zu Hause. Auf jeden Fall ist es von vorn bis hinten erlogen. Dein Großvater war der Borg der dreißiger Jahre, der McEnroe der Vorkriegszeit. Ein eleganter Spieler – als schwebte er über den Platz.«
Dann griff sie wieder zu ihrem Schwamm und machte mit dem Putzen weiter. Meine Oma glaubte an das Glück vollkommener Hygiene. So führte sie einen lebenslangen Kreuzzug gegen Staub, Bazillen und andere Krankheitserreger. Meine Oma war besessen vom Staub und vom Tod. In einem fort drohte sie zu sterben, während des einen Monats, den sie jährlich bei uns verbrachte. Mindestens sechsmal während eines Aufenthalts mußten wir den Notarzt rufen, und unzählige Male haben wir sie wegen nichts ins Krankenhaus gebracht.
Auch Tennis genoß verständlicherweise ihr besonderes Interesse. Wenn wir im Fernsehen ein Match sahen, sagte sie oft: »Ach, das hätte dein Großvater viel besser gemacht.« Über jenen Eklat wahrte sie eisernes Stillschweigen. Als ich eines Tages danach fragte, nannte sie es eine Lüge.
Im Haus meiner Oma wimmelte es von Siegestrophäen obskurer und unbedeutender Turniere aus den dreißiger Jahren. Im Wohnzimmer hing ein großes Gemälde von Aron Mehlman in voller Aktion, und an der Wand im Flur hingen fünf Tennisschläger. Die Schnüre waren schon lange gerissen, das Holz zerfiel, doch sie mußten dort hängen bleiben. Das Haus glich einem Tennismuseum.
Außer Staub, Tod und Tennis galt ihre Obsession der Ehre der Familie. Wie oft hörte ich sie zu meinem Vater sagen: »Achte auf deine Schuhe, glaubst du, daß Aron Mehlman je solche Schuhe getragen hätte? Mach deiner Familie bloß keine Schande.« Zu meiner Mutter sagte sie regelmäßig: »Achte auf deine Frisur – du ziehst unsere Familie in den Dreck.« Und zu mir sagte sie: »Streng dich nur ja in der Schule an, sonst ziehst du unsere Familie in den Schmutz!«
Ein paar Wochen Besuch meiner Oma genügten, und man dachte unweigerlich, daß es das beste sei, sich unters Bett zu verkriechen und nie mehr hervorzukommen oder sich in einen Schrank einzuschließen. Sich langsam in Nichts aufzulösen. Denn Selbstmord war natürlich auch eine Schande.
»Na ja«, sagte sie immer wieder, »die Leute denken ja, dein Vater wäre wer, aber dein Opa, das war erst ein großer Mann! Der berühmte Tennisspieler Aron Mehlman, von dem stammst du ab!«
Als der Wahnsinn ein Jahr vor ihrem Tod endgültig von ihr Besitz ergriff, ließ sie eine große Plakette an ihrer Haustür anbringen, auf der stand: HIER LEBTE DER BERÜHMTE TENNISSPIELER ARON MEHLMAN. Darunter hing immer noch das Schild: FÜSSE ABTRETEN!
Als Oma Mehlman uns zum letzten Mal in New York besuchte, hatte sie ihre ganze Garderobe dabei. Sie kam ihren Geburtstag feiern. Im Taxi sagte sie: »Das Geburtsdatum in meinem Paß ist ein Irrtum, eigentlich bin ich fünf Jahre jünger.«
Sie faßte meinen Vater am Arm und sagte: »Weißt du, worüber du einmal schreiben müßtest? Darüber, wie der Tennisverband uns das Leben vergiftet hat, darüber müßtest du schreiben.«
Mein Vater arbeitete an seinem Opus magnum, und ich glaube nicht, daß er dem Tennisverband darin eine größere Rolle zugedacht hatte. »Ich werde darüber nachdenken«, sagte er leise.
Im Hotel hatte sie eine Suite gemietet, denn sie nahm von Jahr zu Jahr mehr Koffer mit. Dort feierten wir ihren Geburtstag. Es gab einen großen Käsekuchen, denn den liebte sie über alles. Ich mußte mich bei ihr auf den Schoß setzen. Sie streichelte mir übers Haar, das damals noch viel röter war als heute.
»Harpo Saul«, sagte sie. So nannte sie mich immer. Als ob Harpo allein nicht schon schlimm genug wäre. »Harpo Saul«, sagte sie, »wenn du wüßtest, wie der Tennisverband uns das Leben vergiftet hat, wenn du nur wüßtest.«
»Hör mit dem Tennisverband auf«, sagte mein Vater, »hör doch in Gottes Namen endlich mal damit auf.«
So porträtierte Robert G. Mehlman meinen Großvater und meine Großmutter in Platz 268 der Weltrangliste:
Ich bin immer neidisch auf Kinder gewesen, deren Eltern richtige Siege errungen hatten, richtige Erfolge oder von mir aus auch richtige Niederlagen einstecken mußten. Die im Schatten von etwas standen, das real und faßbar war.
Das erste, was ich im Leben lernte, war Schauspielern. Denn in der Mehlman-Familie spielte jeder Theater. Was in unseren vier Wänden geschah und besprochen wurde, mußte geheim bleiben. Familien- und Berufsgeheimnis waren für mich von Anfang an ein und dasselbe. Darum wurden auch nie Fragen gestellt, wenn mein Vater abends nach Hause kam und im Treppenhaus stehenblieb, Pelzmütze auf dem Kopf, Zigarre im Mund, den Koffer in der Hand, und darauf wartete, daß meine Mutter ihm aus dem Mantel half. »Andere Leute tragen Jacken«, sagte er, »aber ich, ich trage einen Mantel.« Als ob der Mantel über der Jacke stände. Eine merkwürdige, für Außenstehende unbegreifliche Rangordnung beherrschte sein Leben. Danach ging er an seinen Schreibtisch, öffnete die oberste Schublade, zu der nur er den Schlüssel besaß, holte kleine, cremefarbene Briefumschläge aus seiner Brusttasche und legte sie in das Fach. Viel sagte er nicht. Höchstens: »Da bin ich wieder.« Oder: »Hat jemand angerufen?« Er setzte sich an seinen Schreibtisch, noch immer mit der Pelzmütze auf dem Kopf. Oft setzte er sie erst kurz vor dem Schlafengehen ab. Es gab Tage, an denen er schon zum Frühstück mit Pelzmütze erschien. Ein ewiges Kältegefühl am Kopf vergällte ihm das Leben. Wie oft habe ich ihn rufen hören: »Es zieht! Macht die Tür zu.« Wo der berühmte Tennisspieler Aron Mehlman auch ging und stand, in seinem Kopf zog es.
Wenn Leute fragten: »Was macht dein Vater?«, mußte ich sagen: »Mein Vater ist ein berühmter Tennisspieler aus den dreißiger Jahren.« Ich war ein Schauspieler, der mit seinem Text kämpfte, der Alpträume bekam wegen seines Textes.
Mein Vater war Inhaber eines Kurierdienstes. Er lieferte den Leuten alles mögliche nach Hause: Geld, Schmuck, Pferde, Waffen – und er stellte keine Fragen. Der Mann, der mich von der Schule abholte, charmant mit anderen Eltern plauderte, höflich nach Banalitäten fragte – diesen Mann gab es gar nicht. Mein Vater war eine Fiktion. Nicht der Krieg hatte zwischen ihm und der absoluten Weltspitze gestanden, wie er oft behauptete, sondern die Tatsache, daß er seinem Gegner in die Wade gebissen hatte, vor den Augen des Schiedsrichters, einer Handvoll Fotografen und mindestens vierhundert Zuschauern.
Jeder Mensch hat eine Vergangenheit, und die ist vorüber. Für einige ist das schmerzlicher als für andere. Doch mein Vater hat eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat.
Wenn er abends mit seinem Koffer nach Hause kam, eine erloschene Zigarre im Mund, die Pelzmütze auf dem Kopf den schweren Lodenmantel um die Schultern, wußte ich von überhaupt nichts; nur, daß man ihm keine Fragen stellen durfte. Nicht: »Wie war’s?«, nicht: »Wo bist du gewesen?«, nicht einmal: »Alles in Ordnung?« Fragen haben nur dann einen Sinn, wenn es Antworten gibt oder zumindest die Chance besteht, welche zu erhalten. Antworten jedoch waren für Aron Mehlman lebensgefährlich. Er hatte sich auf die Fälschung dessen verlegt, was man vielleicht am schwersten fälschen kann: die eigene Vergangenheit.
Unzählige Male sagte ich zu ihm: »Niemand weiß, wer Aron Mehlman ist, es interessiert sich auch niemand dafür.« Er machte nur eine verächtliche Handbewegung. Als ob ich zu jung sei zu begreifen, was die Leute interessierte. »Erzähl’s ihnen trotzdem«, antwortete er dann.
Ich glaube, daß ich schon damals unbewußt begriff, was ich erst viel später so formulierte: Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, mit einem Mythos zu konkurrieren, nur eine Möglichkeit, einem Mythos zu entrinnen, zu verhindern, daß man für immer im Mythos eines anderen die Statistenrolle übernimmt: Und das ist, selbst einen Mythos zu kreieren, selbst ein Mythos zu werden.
Das alles hat mein Großvater, wie gesagt, nicht mehr zu lesen brauchen. Doch als wir dort im Sheraton den Geburtstag meiner Oma feierten, fing sie wieder davon an.
»Als ob der Tennisverband uns nicht schon genug angetan hätte«, sagte sie zu meinem Vater, »als ob das nicht genug wäre! Und dann mußtest du mit diesem Buch kommen!«
Mein Vater stand am Fenster und murmelte: »Später, ein andermal. Das ist nicht der richtige Moment.«
Meine Mutter blies die Kerzen aus.
Oma Mehlman trug hohe Absätze, obwohl ihre Füße kaum noch in die Schuhe paßten. Jeden Morgen brauchte sie zwei Stunden, um sich zu schminken. Mit ihrem weiß gepuderten Gesicht sah sie aus wie einem Karnevalsumzug entsprungen, dessen Teilnehmer sich so gut wie möglich als Gevatter Tod verkleidet hatten. Je näher sie sich ihrem Ende fühlte, um so größer wurde ihr Bedürfnis, eine Diva zu sein. Die Gattin des berühmten Aron Mehlman. Noch ein letztes Mal glänzen. Wer ihr damals auf der Straße begegnete, sah einen enormen, alles überwuchernden roten Haarschopf und darunter einen spindeldürren Körper in einem so engen Kleid, daß es den Körper noch dürrer aussehen ließ. Schwarze, glänzende Schnürstiefel, um allem die Krone aufzusetzen. Eine flamboyante Erscheinung, immerhin.
Ich saß immer noch bei ihr auf dem Schoß. Meine Oma nannte die Preise der Kleidungsstücke, die sie anhatte. Alle gaben sich die größte Mühe, interessiert zuzuhören.
»Harpo Saul«, sagte sie plötzlich, »du bist der letzte Mehlman.«
Der Puder auf ihrem Gesicht sah aus wie Farbe, die gleich abblättern wollte.
»Zu mir hat sie das auch immer gesagt«, sagte mein Vater. »Mach dir nichts draus.«
Er stand noch immer am Fenster, mit einem Glas Champagner in der Hand. Sonst trank niemand welchen. Meine Oma hatte süßen Rotwein bestellt, meine Mutter ein Glas Wasser, und ich mochte keinen Champagner. Das ist übrigens immer noch so. Ich finde nichts daran.
»Harpo Saul«, sagte Oma wieder, »du mußt Tennisunterricht nehmen, ich glaube, du kannst einer von den ganz Großen werden.«
Mein Vater schlug das Fenster zu. »Harpo Saul nimmt keinen Tennisunterricht«, sagte er entschieden. »Boxunterricht, Fußball, Karate, Japanisches Ringen – alles von mir aus! –, aber keinen Tennisunterricht.«
Meine Oma setzte mich auf den Boden und fuchtelte wild mit den Armen. Eine Wolke von Puder stob von ihren Wangen. Ein heiseres Kreischen entrang sich ihrer Kehle. »Wenn ich aber nun möchte, daß er Tennisunterricht nimmt!« rief sie. »Ich sag dir: Er hat die Seele von seinem Großvater, deinem lieben Vater, Gott hab ihn selig, der sein Leben lang nichts anderes getan hat, als sich dafür abzurackern, daß es dir mal gutgeht! Und was ist der Dank? Daß du in schmutzigen Büchern gemeine Lügen über ihn verbreitest. Das Kind bekommt Tennisunterricht!«
Ich schaute zu, wie meine Oma und mein Vater darüber stritten, ob ich Tennisunterricht bekommen sollte. Meine Oma war besonders gut darin, außer sich zu geraten.
Zu guter Letzt setzte sie ihren Hut auf. Größer als das größte Wagenrad. Der Hut paßte kaum ins Taxi. Wir fuhren ins Theater, um ihren Geburtstag zu feiern. Sie trug Handschuhe, denn auf den Händen hatte sie braune Flekken bekommen, die sie vor der Welt verbergen wollte.
In der Theaterloge schlief sie sofort ein. Ich saß bei meinem Vater auf dem Schoß. Das Musical fesselte ihn nur mäßig. Er flüsterte: »Es ist gleich vorbei.«
In der Pause wurde sie wieder wach. Wieder kamen heisere Laute aus ihrer Kehle. Ich verstand vage das Wort »Tennisunterricht«. Mit dem Wagenrad auf dem Kopf bahnte sie sich einen Weg zum Pausenbuffet und bat um ein Glas Wasser. Als sie es ausgetrunken hatte, erklärte sie mit lauter Stimme: »Ist das eine langweilige Aufführung, Robert! Wieviel hast du dafür bezahlt?«
So feierten wir den letzten Geburtstag meiner Oma.
In jener Nacht schrieb mein Vater:
Mein lieber, ungezogener und von Zeit zu Zeit absolut widerspenstiger kleiner Sohn Harpo,
heute ist Deine Oma zweiundachtzig geworden. Wir sind ins Theater gegangen, und obwohl sie den größten Teil der Vorstellung verschlafen hat, scheint sie sich ganz gut amüsiert zu haben. Wenn ich zweiundachtzig werde – ich glaube nicht, daß ich es schaffe, aber man weiß ja nie, das Leben spielt einem die seltsamsten Streiche (als ich achtzehn war, glaubte ich, daß ich mit dreiundzwanzig Selbstmord begehen würde, denn damals war ich noch Dichter und fand dreiundzwanzig das beste Alter für einen Dichter, um aus dem Leben zu scheiden, doch das nur am Rande) –, wenn ich also zweiundachtzig werde, nimmst Du mich dann auch mit ins Theater, oder gehen wir in einen Nachtklub, wo sie laute Musik für junge Leute spielen, so daß ich genötigt sein werde, meinen Hörapparat abzustellen, den ganzen Abend in ein halbleeres Glas zu starren und von den Siegen zu träumen, die ich um ein Haar verpaßt habe?
Lieber Harpo, denk bitte daran: Bis auf weiteres bestimmt immer noch Dein Vater, wo’s langgeht. Manchmal habe ich den Eindruck, Du meinst, das könntest Du bestimmen, aber das ist ein fetter Irrtum. Wenn Du das glaubst, machen wir in Deiner Erziehung etwas verkehrt, obwohl ich bei Gott nicht wüßte, was. Deine Mutter scheint es auch nicht zu wissen, obwohl sie so was doch studiert hat. Von mir kannst Du in Sachen Erziehung nicht viel verlangen, ich bin selbst kaum erzogen worden, aber nochmals: Deine Mutter hat das studiert, versuch also bitte nicht, uns zu vergackeiern.
Zumindest könntest Du die Höflichkeit besitzen, so zu tun, als ginge es nach mir, wenn andere Leute dabei sind. Es ist schon kein Vergnügen, ein Schriftsteller zu sein, von dem in New York noch nie jemand gehört hat, aber wenn die Leute auch noch sehen, wie ich von meinem Sohn, einem Dreikäsehoch von einem Meter vierzig, herumkommandiert werde, kann ich mich überhaupt nirgends mehr blicken lassen. Laß uns das also verabreden: Ich bestimme, wo’s langgeht, deine Mutter bestimmt, wo’s langgeht – aber du nicht!
Glaub nicht, daß Du Dich über mich lustig machen kannst. Ich bin zu schrecklichen Dingen imstande, mußt Du wissen. Manchmal schließe ich meine Augen und denke: O Gott, lieber hätte ich eine Rattenplage als diesen Sohn. Aber dann öffne ich sie wieder und denke: Was ist es doch herrlich, daß Du da bist, mein lieber, unerträglicher, niederträchtiger, sensibler und schöner kleiner Harpo.
PS: Du wirst bestimmt schöner als Dein Vater. Das finde ich auch so was Unerträgliches.
Vor mir liegt ein Stück Pappe. Mit schwarzem Filzstift hat jemand eine Nachricht darauf geschrieben:
Für Herrn R. Mehlman.
Rufen Sie bitte 212–5739653 an.
Ich habe ein Päckchen aus den Niederlanden,
das ich Ihnen übergeben soll.
Die Handschrift ist zierlich. Die Telefonnummer existiert nicht mehr. Man hat das Stück Pappkarton im Hotelzimmer meines Vaters in Sabaudia gefunden. Er warf fast nie etwas weg. Daß er es nicht eingerahmt hat, ist ein Wunder. In seinen letzten Jahren ließ er alles einrahmen. Bierdeckel mit Notizen, Buchseiten mit Widmungen, Stoffservietten, auf denen ein paar Worte gekritzelt standen, selbst ein Paar Socken bekam ich einmal zugeschickt, mit Rahmen und allem Drum und Dran.
Jetzt muß ich etwas über Die hohle Nuß sagen, das Manuskript wohlgemerkt. Also nicht über die hohle Nuß, die bei uns zu Hause bisweilen auch »diese Schlampe« genannt wurde. Nicht die hohle Nuß, von der man sagt, sie habe meinen Vater finanziell und – wenn ich meiner Mutter glauben darf – auch körperlich und geistig ruiniert.
Als ich meine Mutter vor kurzem endlich einmal geradeheraus fragte – mittlerweile geht es ihr nicht mehr so zu Herzen, sie wohnt jetzt mit einem Russen zusammen, der an einer alternativen Heilmethode für Schizophrene arbeitet –, sagte sie: »Nein, natürlich war es nicht diese hohle Nuß und auch nicht all die anderen … Was ihn ruiniert hat, waren auch nicht die Umstände. Obwohl Umstände natürlich immer eine Rolle spielen. In der Psychiatrie kann man nur selten etwas unvermeidlich nennen.« Einen Moment lang starrte sie nachdenklich vor sich hin, dann sagte sie: »Aber wahrscheinlich gilt das nicht nur für die Psychiatrie.«
Darauf nahm sie mein Gesicht in beide Hände, als wollte sie mich hypnotisieren, als könnte sie das Rätsel entschlüsseln, warum Menschen tun, was sie tun, indem sie mich festhielt, als würde ihr bestimmt alles klarwerden, wenn sie mich nur lange genug festhielt. Zu guter Letzt sagte sie: »Du siehst deinem Vater so schrecklich ähnlich.«
Noch immer weiß ich nicht, ob das ein Kompliment war oder eher ein Fluch. Nicht einmal jetzt, wo ich das Manuskript gelesen habe.
II Robert G. Mehlman
Die hohle Nuß und andere Juwelen
Prinzessin Märchen
Den ganzen Morgen hatten zwei Schornsteinfeger in meiner Wohnung zu tun gehabt. Der eine trug ein Kopftuch, der andere war fast kahlköpfig. Offensichtlich war mein Schornstein ein schwieriger Fall. Nach drei Stunden sagte der mit dem Kopftuch: »Der Wind drückt auf den Schornstein, da können wir auch nichts machen.«
Ich verstehe nichts von Schornsteinen. Es war die Idee meiner Frau, den Schornstein kehren zu lassen. Sie war in Wien zu einem Kongreß über Träume, darum hatte ich ihre Schornsteinfeger am Hals. Meine Liebe zum Kamin ist eher begrenzt, doch in meiner Frau leben viele unerklärliche Verlangen.
»Ja«, sagte der mit dem Kopftuch, »wir können natürlich ’nen Exhauster auf dem Dach montieren, das ist so ’n Ventilator, dann bist du alle Probleme los. Dann drückst du nur auf ’nen Knopf, und der Schornstein zieht wie ’ne Eins. Aber das kostet ’ne Kleinigkeit.«
Ein Ventilator auf dem Dach, das kostete ein Vermögen, und das gab es nicht mehr, wenn auch mal große Vermögen existiert hatten. Doch selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, hieß das auf jeden Fall, daß ich mich dann noch ein paar Vormittage mit den Schornsteinfegern herumschlagen dürfte. Meine Frau wäre sicher froh, wenn der Schornstein wieder ordentlich zöge und der Wind nicht mehr hineinwehte, aber die Aussicht, die Schornsteinfeger noch ein paar Tage am Hals zu haben, schien mir unerträglich.
Einen Moment lang erwog ich, meine Frau anzurufen und um Rat zu fragen, doch ein Schornstein war eine zu triviale Angelegenheit, um deswegen jemanden zu stören, der an einem Kongreß über Träume teilnahm.
»Nun«, sagte ich, »ich werd’s mir überlegen.«
Die Schornsteinfeger begannen, die Plastikplanen von den Möbeln zu nehmen, und mich überfiel plötzlich der Trübsinn. Das ganze Zimmer hatten sie mit Plastik abgedeckt, drei Stunden hatten sie im Schornstein herumgefuhrwerkt, doch es war alles umsonst gewesen, der Schornstein zog immer noch nicht.
»Wir sehen uns wieder«, sagte ich zu den Schornsteinfegern. Als hätte ich etwas gutzumachen.
»Denk in aller Ruhe drüber nach«, sagte der eine. »So ’n Exhauster ist echt ’ne feine Sache, weil – so wie jetzt weht nur der Wind rein.«
Als sie weg waren, rief ich doch noch im Hotel meiner Frau an. »Der Wind weht in den Schornstein, wir brauchen einen Ventilator auf dem Dach, aber das kostet ein Vermögen«, ließ ich ihr ausrichten. Dreimal mußte ich meine Nachricht wiederholen, trotzdem brachte die Rezeptionistin es noch fertig zu fragen: »Wo weht der Wind jetzt noch mal rein?« Nach einem Tag voller Diskussionen über Träume schien es mir eine nette Vorstellung, abends beim Nachhausekommen eine solche Nachricht zu finden.
Danach las ich den Brief eines Professors an einer Pariser Universität.
Sehr geehrter Herr Mehlman,
vielleicht erinnern Sie sich noch, daß während Ihres Pariser Aufenthalts als Gastschriftsteller einige Studenten und Dozenten an einer Übersetzung Ihrer Geschichte »Schuhwichse« arbeiteten. An einigen Sitzungen dieses Übersetzungsseminars haben Sie sogar selbst teilgenommen. Erlauben Sie uns, die mittlerweile fertig übersetzte Geschichte in unserer Universitätszeitschrift abzudrukken? Leider stehen uns hierfür keine Honorarmittel zur Verfügung.
Der Brief war schon ein paar Wochen alt. Ich fand, es wurde Zeit, ihn endlich zu beantworten, und schrieb:
Sehr geehrter Herr Professor,
wie geht es Ihnen? Mein Gedächtnis ist ausgezeichnet, vielen Dank. Natürlich habe ich die Sitzungen des Übersetzungsseminars in Paris nicht vergessen. Diese sind mir möglicherweise sogar unvergeßlich. Auch Sie habe ich nicht vergessen. Nach meiner Abreise aus Paris habe ich nie wieder an einem Übersetzungsseminar teilgenommen. Die Teilnahme an der unter Ihrer Leitung durchgeführten Veranstaltung erschien mir als äußerst inspirierend. Selbstverständlich dürfen Sie meine Geschichte »Schuhwichse« in Ihrer Universitätszeitschrift abdrucken. Schade, daß keine Honorarmittel zur Verfügung stehen, Medikamente sind teuer. Von ordentlich ziehenden Schornsteinen ganz zu schweigen.
Meine Frau lernte ich an einem Donnerstag im Frühling kennen; damals hatte ich noch keine Ahnung von Übersetzungsseminaren, ich wußte nicht mal, daß es so was gab. Es war spät am Abend. Zuvor hatte ich bei einer flüchtigen Bekannten warm gegessen. Sie hatte Makkaroni mit Gorgonzolasoße für mich gemacht, die ihr nicht ganz gelungen waren. Das Mißlingen lag vor allem am Gorgonzola. Die flüchtige Bekannte war deswegen ziemlich aufgelöst gewesen. Ich selbst war damals auch nicht gerade die Ausgeglichenheit in Person, trotzdem sagte ich mehrmals: »Essen mißlingt nun mal ab und zu, das macht doch nichts. Das kann auch den Besten mal passieren.« Trost liegt nicht in originellen Formulierungen, Trost liegt vor allem in Klischees, obwohl es natürlich enorm hilft, wenn man sie mit einem gefühlvollen Blick in die Augen verkündet.
Später am Abend – früh am Morgen, müßte ich eigentlich sagen – lernte ich meine Frau kennen. Ich arbeitete in einem Nachtkauf in Amsterdam. Sie kam rein und sagte: »Darf ich mich hier mal kurz unterstellen, draußen verfolgt mich jemand.«
An dem Abend war ich allein im Laden, ich bin kein besonderer Held.
»Natürlich«, sagte ich, »stell dich ruhig kurz mal unter. Ist es kalt draußen?« Sie schüttelte den Kopf. Sie starrte auf ein Stück Gemüsequiche, während ich die Tür im Auge behielt und mich fragte, was ich tun sollte, wenn der Zorn des zwielichtigen Typen sich zufällig gegen mich richten würde. Damals hatte ich die fixe Idee, daß alle Aggressionen sich immer und ausschließlich gegen mich richteten. Etwas, das man anzieht, ohne es selbst zu wollen.
»Soll ich die Polizei rufen?« fragte ich.
Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Macht ihr die selbst?« fragte sie und zeigte auf die Gemüsequiche.
»Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß, »aber ich kann sie dir warm machen.« Ein großer Teil meiner Arbeit bestand im Aufwärmen von Mahlzeiten. Darin war ich sehr gut. »Einen Moment Geduld«, sagte ich zu meiner zukünftigen Frau.