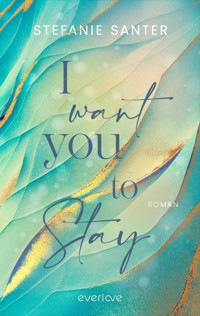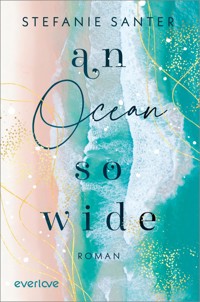
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine Liebe, so tief wie der Ozean Als Amy erfährt, dass sie mit dem berühmten Street-Art-Künstler Ezra an einem Artikel für den Valentinstag arbeiten soll, würde sie am liebsten ablehnen. Sie glaubt nicht an die Liebe, und Ezra scheint sie vom ersten Moment an zu hassen. Aber nur wenn sie die Story abgibt, darf die engagierte Meeresbiologiestudentin in der nächsten Ausgabe über ihr Herzensthema, den Schutz der Meere, schreiben. Amy ist verzweifelt, zudem fehlt ihr die Inspiration! Doch dann bietet ausgerechnet Ezra seine Unterstützung an und hilft ihr dabei, die Liebe aus völlig neuen Blickwinkeln zu betrachten. Deutsche New-Adult-Romance mit Fokus auf das Meer, Nachhaltigkeit und Umweltschutz für LeserInnen von Kathinka Engel und Nikola Hotel. »Grumpy und Sunshine, forced proximity, strangers to lovers - drei meiner liebsten Tropes vereint in einer Liebesgeschichte, die mich so sehr gefesselt hat.« Bestsellerautorin Anya Omah »Eine mitreißende und berührende Liebesgeschichte mit mehr als einer wichtigen Botschaft – tiefgehend wie das Meer!« Bestsellerautorin Nikola Hotel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »An Ocean so Wide« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2023
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Liebesbrief
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die seit gestern an morgen denken und deshalb heute belächelt werden.
I’ll tell you a tale of the bottomless blue …
You’re not getting cold fins now, are you?
– The Little Mermaid
Kapitel 1
Ezra
Mein Manager klatscht eine Zeitung nach der anderen auf den Tisch zwischen uns. Alle Titelseiten sehen gleich aus. Weil jede Schlagzeile darüber berichtet, was ich getan habe.
»War ’ne nette Idee, was?« Ich ziehe die Augenbrauen hoch und grinse. Lewis grinst nicht. Stattdessen dreht er seinen Laptop so, dass ich den hochgeklappten Bildschirm ebenfalls sehen kann.
»Das ist ein verfickter Albtraum, Ezra!«, flucht er und fordert mich mit einem Nicken auf, das Kleingedruckte zu lesen.
Ich seufze. »Kannst du’s mir nicht vorlesen?«
Wenn es im Bereich des Möglichen wäre, würde Lewis’ Blick mich jetzt … nicht umbringen; dafür mag er mich zu sehr. Aber ich gebe trotzdem nach, richte mich aus den Tiefen des gepolsterten Bürosessels auf und lese mit gerunzelter Stirn das PDF-Dokument, in dem so ziemlich jeder Satz mit einem Paragrafen beginnt. »Was ist das?«
»Dein Untergang, Junge. Dein absoluter Untergang.«
»Gibt’s auch ’ne Erklärung, oder soll ich lieber gleich in der Hölle anrufen und denen sagen, dass du mich mal wieder schickst?« Ich lege den Kopf schief, merke, dass ich plötzlich eigenartig verspannt bin, und lehne mich noch ein Stück weiter, bis mein Nacken laut knackt.
Fassungslos verdreht Lewis die Augen. Ich sehe ihm an, dass er sich zurückhalten will, aber schon in der nächsten Sekunde reißt sein Geduldsfaden endgültig. »Du wirst verklagt, weil du eines der berühmtesten Graffitis der Welt zerstört hast, du Idiot!« Hektische rote Flecken kriechen aus seinem Hemdkragen den Hals hinauf.
»Äh, also genau genommen ist es noch da. Ich hab bloß weiße Farbe drübergeschüttet.«
»Wenn dir langweilig ist, hast du die beschissensten Ideen! Weißt du das?« Die roten Flecken erreichen jetzt seine Wangen, die vom Aftershave glitzern. Zumindest glaube ich, dass es Aftershave ist, weil ich den scharfen Geruch jedes Mal volle Ladung in die Nase bekomme, wenn er seine Ansprache unterbricht, um entgeistert den Kopf zu schütteln.
Ich zucke mit den Schultern. »Es war mein Mural. Ich hab’s an die Mauer gesprüht, ich wollte es wieder löschen. Was ist so schlimm daran?« Das Motiv war dämlich, eins meiner ersten und auch nicht mehr mein Stil. Eine Sanduhr, in der sich oben ein paar Herzen befanden, während im unteren Glasteil bereits unzählige gebrochene Hälften lagen.
Zuerst wusste keiner, was damit passiert ist. Die Presse hat eine Weile spekuliert: … Verschwindet Ezra Afzal jetzt von den Leinwänden der Welt? … Tick Tack – ist Ezra Afzals Zeit als Phantom der Kunstszene abgelaufen? … Hat der Picasso mit der Spraydose Feinde? … Ich habe ein paar Tage über die absurden Headlines gelacht und dann selbst ein Foto der Wand veröffentlicht, auf dem man im Licht der Straßenlaternen den Schatten eines Farbeimers sieht. Wenn man weiter swipt, kommt ein kurzes Video, das Olive gemacht hat, als ich mir nach dem Streichen zu Hause die Hände gewaschen habe. Ein Close-up meiner Finger voller Seife. Verräterische weiße Schlieren laufen in den Abfluss und #ichwarsnicht steht in der Caption.
Danach herrschte Chaos. Meine Leinwände und Kunstdrucke sind seit der Aktion doppelt so viel wert. Weil Leute etwas immer erst dann unbedingt wollen, wenn sie glauben, dass sie es nicht mehr bekommen können. Diejenigen, die noch Fotos von dem Mural haben, posten es jetzt mit pseudoweisen Zitaten. Eigentlich ziemlich gute Publicity. Keine Ahnung, warum Lewis mir nicht auf die Schulter klopft.
»Blöd nur, dass das Ding an der Hausmauer des Headquarters von Status war. Es ist deren verdammte Wand, die du angeschmiert hast!«
»Äh … also im Grunde habe ich sie vor ein paar Jahren schon angeschmiert. Da hat sich allerdings keiner beschwert.« Ich blinzle übertrieben unschuldig, weil Lewis zu provozieren das Einzige ist, was ich tun kann, um diesen Termin unterhaltsamer zu machen.
»Scheiße, Ezra! Du weißt genauso gut wie ich, dass jeder Tourist, alle, die zufällig in der Gegend sind, dort extra hinfahren, um sich vor dem Mural zu fotografieren. Und direkt darüber hängt das Status-Logo. Auf jedem zweiten Selfie sieht man gleichzeitig deren Namen. Darauf verklagen sie uns. Auf die Werbung, die ihnen jetzt entgeht. Und natürlich auch, weil deine nette Idee …«, Lewis zeichnet Anführungszeichen in die aufgeladene Luft, »… Vandalismus war!«
»Können die das?«
»Juristisch betrachtet, wird in solchen Fällen meist zugunsten der Immobilieneigentümer entschieden. Aber darauf wollen wir es nicht ankommen lassen, nicht wahr?«
»Dann schreib ihnen von mir aus eine Mail. Sag, dass es mir leidtut oder so.« Tut es nicht. Aber ich kann ohnehin nichts mehr daran ändern.
»Ezra, dir ist schon klar, dass wir es mit einem Millionenkonzern zu tun haben, ja?«
»Das heißt, ein Sorry reicht nicht?« Im Grunde finde ich es immer noch lustig, dass so ein Drama um die Sache gemacht wird. Und wenn Status wegen ein paar verschwundenen Herzen gleich seine Anwälte schickt, bin ich, ehrlich gesagt, froh, dass ich indirekt keine Werbung mehr für sie mache.
»Oh doch, ein ›Sorry, dass ich so ein Volltrottel bin, kommt nie wieder vor!‹ ist auf jeden Fall Teil des Plans. Allerdings wirst du dort persönlich aufkreuzen, und wenn es sein muss, gehst du auch auf die Knie. Weil wir beide wissen, dass eine Klage und der Medienaufruhr, den so etwas auslösen würde, das Letzte sind, was du willst. Weil es dann nicht um deine Bilder geht. Sondern um dich.«
Ich schließe die Augen. Fuck!
Ein paar wirklich unangenehme Sekunden herrscht Stille. Lediglich das Ticken der Wanduhr füllt Lewis’ Büro, und ich lache nicht mehr. Weil es tatsächlich bedeuten könnte, dass meine Zeit abläuft.
»Ezra?«
Obwohl ich nicht will, nicke ich. Minimal. Kaum. Aber doch.
»War das ein Ja?«
»Es war ein ›Wenn-es-sein-muss‹.«
»Sehr gut! Und du wirst das neue Status-Special illustrieren. Das ist die Schadensbegrenzung, die ich herausschlagen konnte. Du packst deine Buntstifte aus, sie ziehen die Klage zurück.«
Dieses Mal stimme ich nicht zu. Auf keinen Fall. »Für mich klingt das nach Erpressung!«
»Ach ja?« Lewis klappt den Laptop zu. Die Klage verschwindet aus meinem Blickfeld. Aber sie ist immer noch da. Weil sich Dinge nicht einfach in Luft auflösen; weil man nicht über jedes Problem weiße Farbe kippen kann, um es verschwinden zu lassen …
Lewis schnippt mit den Fingern und reißt mich aus meinen Gedanken. »Für mich klingt das nämlich nach einer verdammt einfachen Nummer, um das Problem zu beseitigen«, erklärt er nüchtern. »Wenn du vor Gericht gezerrt wirst, erfährt jeder, wer du bist. Aber ein paar hübsche Illustrationen, und du kannst dein Geheimnis behalten.«
»Okay«, sage ich leise, obwohl sich alles in mir wehrt, nachzugeben. »Ich mach’s.«
»Richtige Entscheidung!« Lewis fegt die Zeitungen vom Tisch, sodass der Stapel mit einem lauten Knall im Papierkorb landet. »Die Details bekommst du vom Status-Chefredakteur. Du wirst mit einer seiner Journalistinnen zusammenarbeiten. Und ich bitte dich – für dich, für mich, für meinen ohnehin schon hohen Blutdruck –, mach einfach deinen Job. Keine neuen Skandale, keine Mittelfinger, kein …«
»Kein Stress«, komme ich ihm zuvor. »Geht klar.«
Kapitel 2
Amy
»Miss? Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden?!«
Ich schlucke schwer, nehme all meinen Mut zusammen und schüttle den Kopf. »Nein. Zuerst will ich mit ihm sprechen!« Ich hasse es, dass meine Stimme bebt. Und das Brennen meiner ungeweinten Tränen ist schon fast unerträglich, aber ich halte sie zurück. Wer soll mich sonst ernst nehmen?
Der Sekretär von Minister Wallaby starrt mich verständnislos an. Als ich mich erneut weigere, mitzukommen, schüttelt er schnaubend den Kopf und greift zum Telefonhörer. »Sie lassen mir leider keine andere Wahl. Wenn Sie das Rathaus nicht freiwillig verlassen, rufe ich die Polizei.« Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass er blufft, aber ich rühre mich trotzdem nicht von der Stelle. Nicht feige sein, Amy! Wenn du das jetzt nicht machst, tut es keiner! Dieser letzte Gedanke lässt mich die Schultern straffen. Mein Neoprenanzug engt mich bei der Bewegung ein, und erst jetzt wird mir bewusst, dass ich immer noch klatschnass bin. Barfuß. Und voller Sand.
Auf den hellen Perserteppichen im Westflügel des Rathauses prangen unzählige schmutzige Fußabdrücke, die zeigen, dass ich einmal quer durch die ganze Etage gelaufen bin. Bis zum Büro von Minister Wallaby. Aber der ist gar nicht da. Das wollen mir seine Leute zumindest weismachen.
Ich blicke zur Decke, um meine verräterischen Tränen daran zu hindern, in die Realität und über meine tauben Wangen zu rollen. Ich fühle nichts mehr und gleichzeitig alles. Nichts mehr von der Hoffnung, keinen Sinn und null Ideen für einen Notfallplan. Dafür aber das getrocknete Meersalz auf jedem Millimeter meiner juckenden Haut, meine feuchten Locken, und diese eine widerspenstige Strähne, die sich in meinen Wimpern verheddert hat, obwohl ich mir mit zittrigen Fingern zum fünften Mal die Haare hinters Ohr streiche.
Wut und Traurigkeit verknoten sich in meinem Bauch. Weil ich nichts mehr ändern kann. Ich habe meine letzte Chance vertan …
Stunden später starre ich durch die Gitterstäbe einer Zelle auf den blinkenden Getränkeautomaten der Polizeistation.
Hell.
Dunkel.
Hell. Hell. Ein kratzendes Piepsen.
Dunkel.
Ich glaube, dass sich mein Herzschlag mittlerweile dem unregelmäßigen Rhythmus des Wackelkontakts angepasst hat.
»Sie müssen das doch irgendwie nachverfolgen können!«, ruft eine schrille Frauenstimme plötzlich.
Müde hebe ich den Kopf, aber der Eingang liegt um die Ecke, weshalb ich nicht sehe, was gerade passiert.
»Wir können Mobiltelefone nur in Notfällen orten. Diebstahl zählt leider nicht dazu, und …«
Die Antwort des Beamten geht in einem aufgebrachten Schrei unter.
»Bitte beruhigen Sie sich!«
»ABER ES IST EIN NOTFALL! Auf diesem Handy war eines der letzten Fotos der Sanduhr!«
Warum auch immer, verändert diese Info auf einen Schlag die gesamte Situation. »Ezra Afzals Sanduhr?«, fragt jemand neugierig, und einige Bürostühle knarzen, als würden sich nun auch andere Kollegen für das Gespräch interessieren, denn einer nach dem anderen bietet seine Hilfe an:
»Wollen Sie sich setzen?«, »Ich hole Ihnen erst mal was zu trinken.«, »Keine Sorge, wir werden unser Bestes tun, Ihnen zu helfen.«, »Wie lautet denn die Seriennummer des gestohlenen Handys?«
Ich versuche zu verdrängen, wie unfreundlich man im Gegensatz zu mir war, und schalte auf Durchzug.
Weitere endlose Minuten vergehen. Immer noch stecke ich in meinem Anzug fest, der nach modriger Feuchtigkeit müffelt und mich gemeinsam mit der Klimaanlage auf höchster Stufe frieren lässt, aber ich beiße mir auf die Unterlippe, sodass meine Zähne nicht klappern.
»Amanda Lamar?« Ein Mann in Uniform baut sich vor der Zelle auf. »Jemand ist hier, um Sie abzuholen.«
Eigentlich war ich kurz davor, endlich aufzuatmen. Weil ich dringend eine heiße Dusche brauche. Und mein Bett. Ich will nur noch nach Hause, mich verkriechen und schlafen. Aber dann sehe ich, wer hinter dem Polizisten auf mich zukommt, und der erleichterte Atemzug bleibt mir in der Kehle stecken. Am liebsten würde ich mich an Ort und Stelle in Luft auflösen. Da-das kann doch nicht wahr sein!
»Alles in Ordnung?«, fragt Darell bestürzt, als er mich erblickt, und ich weiß genau, was er sieht. Weil in der Ecke neben dem Getränkeautomaten ein paar ausrangierte Verkehrsspiegel lehnen. Diese großen, gewölbten Dinger, die normalerweise in schlecht überschaubaren Kreuzungen hängen. Da ich schon eine Weile hier bin, hatte ich genug Zeit, um meine verzerrte Reflexion darin zu betrachten. Gerötete Augen. Wirre, blonde Haarsträhnen, die so strohig getrocknet sind, dass ich sie gar nicht anfassen will. Und ein aschfahles Gesicht, von dem sich meine Sommersprossen fast schon grotesk abheben. Ich glaube, dass ich in den letzten sechzig Sekunden sogar noch blasser geworden bin, weil ich meine Panik nur noch mit Mühe zurückhalten kann und wahrscheinlich jeden Augenblick platze. Aber ich weiß nicht, was dann passiert. Ob ich schreie oder weine. Vielleicht würde ich vor lauter Überforderung auch zu lachen beginnen, und man würde mich endgültig für unzurechnungsfähig halten. Ich will es definitiv nicht herausfinden, weshalb ich hastig an der Kragenlasche meines Neoprenanzugs ziehe, um mich zumindest weniger eingeengt zu fühlen.
»So in Ordnung, wie man eben sein kann, wenn man von seinem Uni-Professor aus dem Gefängnis geholt wird«, antworte ich und lächle schwach. Im Gegensatz zu mir trägt er einen richtigen Anzug und strahlt genug Autorität aus, um den Polizisten ein paar Schritte zurückweichen zu lassen, damit wir uns unterhalten können. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um aufzuwachen, falls das ein schlechter Traum ist. Aber die Betonfliesen unter meinen staubigen Fußsohlen fühlen sich bedauerlicherweise viel zu echt an. Rau und hart. Ein perfekter Boden für Tatsachen.
Darell nickt wortlos. Wahrscheinlich braucht er ebenfalls einen Moment, um seine Gedanken zu sortieren.
»Ich musste etwas tun«, erkläre ich eilig.
Wieder nickt er. »Aber manchmal muss man auch akzeptieren, dass man nichts ausrichten kann.« Mitleidig legt er seine Hand auf meine Schulter und rüttelt mich sanft. »Geh nach Hause, Amy.«
»Aber …«
»Ich regle das hier.«
Diesmal bin ich diejenige, die nickt. Resigniert. Weil ich einsehen muss, dass dieser Tag vorbei ist. Meine Chance ebenfalls. Und als wäre das für heute noch nicht genug, wird mir auf dem fast leeren Parkplatz vor der Polizeistation klar, dass mein Rucksack mit dem Handy, meinem Geld und den Wechselklamotten noch in einer der Umkleiden am Strand ist. Ich muss also zu Fuß nach Hause laufen. Ohne Schuhe. Durch die halbe Stadt. Und ich tue es. Weil ich hoffe, dass ich danach zumindest so erledigt sein werde, dass ich sofort einschlafe.
Irgendwo auf halber Strecke, nach der November Avenue, höre ich auf, so zu tun, als hätte ich mich unter Kontrolle. Ich balle die Hände zu Fäusten und lasse dafür all meine Selbstbeherrschung los, um lautlos zu weinen. Auf den dunklen Straßen ist ohnehin niemand unterwegs. Die Sonne ist längst untergegangen, der Mond noch nicht auf, und verschluckt von der Dämmerung, denke ich für einen Moment darüber nach, wie aussichtslos meine Wünsche tatsächlich sind. Und wie schmerzhaft Weinen ist, wenn einem dabei kühler Wind ins Gesicht peitscht, sodass sich jede einzelne Träne wie ein eiskalt brennender Tropfen anfühlt.
Bevor ich zu Hause klingle, verwische ich alle Spuren der Verzweiflung, streiche unter den Augen entlang und mit dem Ärmel des Wetsuits den Rotz weg. Ich warte noch ein paar Herzschläge, bis ich wirklich ruhiger bin, atme tief durch und drücke dann erst auf den Messingknopf.
Bei meinem Glück rechne ich damit, dass meine Mitbewohnerin unterwegs ist und ich vielleicht die ganze Nacht draußen warten muss. Mein Blick huscht bereits zur morschen Parkbank, die ein paar Meter weiter steht. Aber dann ertönt der Buzzer doch noch, und ich stolpere mit der Tür, gegen die ich mich gelehnt hatte, ins Treppenhaus.
Freyas Stimme hallt von den Wänden. »Wo warst du?«, ruft sie über das Geländer zu mir nach unten. »Was ist passiert?«
»Lange Geschichte«, antworte ich im dritten Stock angekommen, zwänge mich an ihr vorbei und will direkt weiter ins Bad am Ende des Flurs, bleibe aber wie angewurzelt im Durchgang zum Wohnzimmer stehen, wo unser Fernseher in voller Lautstärke läuft. Die Nachrichten werden eingespielt, und in der Zusammenfassung am Anfang sieht man … mich! Sicherheitshalber blinzle ich, warte das Intro ab und auf den Beitrag. Aber das bin wirklich ich! Auf der Aufnahme einer Verkehrskamera, die zeigt, wie ich mit einem riesigen Sack voller Müll und einem verhedderten Knäuel an Fischernetzen ins Rathaus laufe. Dann bricht die Szene ab, und in der darauffolgenden werde ich in Handschellen wieder aus dem Gebäude gezerrt. Von einem Polizisten, der mich fest am Arm gepackt hält und auch nicht stehen bleibt, als ich stolpere. 20-jährige Studentin stürmt Rathaus von November Bay, steht im eingeblendeten Infobalken, und die Stimme des Moderators aus dem Studio sagt exakt denselben Satz.
Ich hab’s geschafft!, denke ich und lasse mich vor dem Sideboard auf den Parkettboden sinken, um zu sehen, was sie noch berichten. Aber das … war es schon? Der Moderator übergibt mit einem Zwinkern das Wort an die Wetterfee, die in einem knallengen Cocktailkleid vom Sonnenschein der nächsten Woche schwärmt.
Was? Nein, nein, nein!
»Amy?« Freya steht direkt hinter mir, und ich blicke – buchstäblich am Boden – zu ihr hoch.
»Ist das alles? Haben die davor noch etwas berichtet? Warum ich das getan habe? Was zu Wallaby?«
Freya presst die Lippen aufeinander.
»Gar nichts?« Meine Stimme bricht heiser.
»Dasselbe Video lief vorhin schon auf einem anderen Sender. Aber da haben sie sonst auch nichts gesagt, außer …«
»Außer was?«
Meine Mitbewohnerin schüttelt zerknirscht den Kopf. Sie will es mir nicht sagen.
»Außer was?«, frage ich noch mal.
»Da war dieser eine Nachrichtensprecher. Der Alte. Du weißt schon, der seine Geheimratsecken immer mit einem tief gezogenen Seitenscheitel zu verstecken versucht?«
Ungeduldig bedeute ich ihr, dass sie endlich weitererzählen soll.
»Er hat gesagt, dass du das nächste Mal doch bitte im Bikini auftauchen sollst, statt im Neoprenanzug.«
»Wie bitte?!«
»Ich weiß. Deshalb wollte ich es dir ja auch nicht sagen. Aber die Moderatorin daneben hat die Augen verdreht. Mit dem Kommentar hat er sich nur selbst ins Aus geschossen, Ames.« Freya drückt auf die Fernbedienung, sodass die ohrenbetäubende Valentinstagsschokoladenwerbung nicht mehr über uns hinwegdröhnt, und setzt sich neben mich.
Jetzt ist mir auch klar, warum Darell aufgetaucht ist. Im Grunde freue ich mich, dass über die Sache berichtet wurde. Es ist mir sogar egal, dass ich dabei nicht gut wegkomme. Weil man meinen könnte, dass mir jetzt endlich jemand zuhört. Aber das stimmt nicht. Mit keinem einzigen Satz wurden die Hintergründe meiner Aktion erwähnt, obwohl die Mitarbeiter im Rathaus sehr wohl wussten, weshalb ich da war. Immerhin habe ich meinen Standpunkt an die zwanzig Mal wiederholt, bevor die Polizei gerufen wurde.
Und dieser Auftritt war auch nicht meine erste Wahl. Nein, ich versuche seit Monaten auf normalem Weg einen Termin bei Minister Wallaby zu bekommen, der mich jedoch genauso ignoriert, wie meine gesammelten Unterschriftenlisten oder die unzähligen Briefe und Mails mit wissenschaftlichen Papern, die ich ihm geschickt habe. Deshalb bin ich heute nach der Tauchexkursion vom Strand aus über die Promenade und direkt in sein Büro im Rathaus gelaufen. Deshalb habe ich ihm aus Protest einen Haufen Fischernetze auf den Mahagonischreibtisch geknallt. Weil ich nicht wusste, was ich sonst noch tun sollte …
»Ames?« Freya sieht mich besorgt an. Weil ich erbärmlich aussehe, mich erbärmlich fühle und erbärmlich bin.
»Ich muss duschen« ist alles, was ich schließlich hervorbringe, bevor ich ins Bad flüchte, mich panisch aus dem engen Anzug schäle, in die Duschkabine taumle, das Wasser anmache, mich unter den viel zu heißen Strahl stelle und dabei zusehe, wie meine Hoffnung gemeinsam mit weiteren Tränen und dem Staub von meinen Füßen im Abfluss verschwindet.
Kapitel 3
Amy
Lautes Ozeanrauschen – der Klingelton meines Handys – ertönt, und ich schlage mit einem gequälten Seufzen die Decke zur Seite.
Als ich sehe, dass Status anruft, vergrabe ich das Gesicht in den Kissen.
Ich wünschte, ich hätte meine Tasche gestern nicht mehr aus den Umkleiden in der Bucht geholt. Dann wäre mein Handy jetzt gar nicht hier, und ich könnte noch für ein paar Minuten mein Leben ignorieren.
Kurz überlege ich, ob ich es einfach weiter läuten lassen soll, wische dann aber doch nach rechts, um das Gespräch anzunehmen.
»Amy, bei uns ist die Hölle los. Du musst in die Redaktion. Anweisung vom Boss.« Richards Assistentin ist am anderen Ende der Leitung, und sie klingt auch genauso. Am Ende.
Ich presse die Lippen aufeinander. Eine ungute Vorahnung macht sich in mir breit. Weil ich noch nie in die Redaktion musste. Schon gar nicht so kurzfristig. Dass ich von überall aus arbeiten kann, war überhaupt erst der Grund, weshalb ich den Job angenommen habe. Ein Job, den ich dringend brauche!
Sofort denke ich an die Nachrichten von gestern. Richard hat sie bestimmt auch gesehen. Und jetzt will er mir wahrscheinlich kündigen, weil er es sich nicht leisten kann, eine Wahnsinnige im Team zu haben. Wieso sollte er mich sonst persönlich sehen wollen?
»Bist du da?«
»Ja! Ja, ich komme«, antworte ich rasch. Eigentlich will ich Poppy noch fragen, ob sie den Grund für den Termin kennt, aber da hat sie bereits aufgelegt.
Gezwungenermaßen krabble ich aus dem Bett und schleppe mich in die Küche. Freya ist schon unterwegs, aber sie hat mir ein Post-it auf dem Tisch hinterlassen. Alles wird gut!, steht mit einem Smiley darauf. Ich lächle schwach und mache mich dann daran, die Küchenschränke nach einer Packung echtem Kaffee zu durchsuchen, die keine Malzversion für Kinder ist. Heute ist es mir sogar egal, wie hibbelig und nervös mich Koffein für gewöhnlich macht, weil ich zu müde bin, um ohne Hilfe zu funktionieren.
Wie auf Autopilot bereite ich alles vor, mache mich nebenbei fertig, kippe die schwarze Brühe runter, weil wir natürlich auch keine Sojamilch mehr dahaben, und starre dann den Kaffeesatz an, als könnte mir der etwas über meine Zukunft verraten. Es steht sogar wirklich etwas im letzten Schluck meines Americanos, weil ich zufällig nach dem bauchigen Keramikbecher gegriffen habe, den Freyas Bruder ihrem Vater getöpfert hat. Freya hat das Ding irgendwann einfach von zu Hause mitgenommen, weil sie die Größe praktisch fand. Aber der Satz Du wirst Opa! auf dem Tassenboden ist nicht die Art von Botschaft, die mir jetzt weiterhilft.
Warum muss ich ausgerechnet heute ins Büro …? Darf Richard mich einfach so feuern? Will er mich zwingen, dass ich von selbst kündige? Wird mich mit dem Ruf der verrückten Studentin dann überhaupt jemals wieder wer einstellen? Die Fragen in meinem Kopf werden immer mehr, immer nervöser, immer dramatischer, und es dauert nicht lange, bis ich mich dabei ertappe, wie ich geistesabwesend mit den Fingern über meine Stirn taste. Ich mache das unbewusst. Dass ich die Fingernägel über die Haut ziehe, bis sie jede noch so kleine, unebene Stelle finden, um sie wegzukratzen. Weil es mich beruhigt. Allerdings nur so lange, bis ich dann die geröteten Stellen im Spiegel sehe und mir klar wird, dass ich mir das dringend abgewöhnen muss.
Da ich ohnehin die meiste Zeit unter Wasser verbringe, verstecke ich meine paar Pickel auch nur selten hinter einer Schicht Make-up. Aber weil sich in meinem Gesicht die Stunden im Gefängnis und die halbe schlaflose Nacht danach widerspiegeln, beschließe ich auf dem Weg zu Status kurzfristig, mir ein neues Puder zu kaufen. Wenn mir schon gekündigt wird, will ich wenigstens nicht so aussehen, wie ich mich fühle. Aufgekratzt.
Im Headquarter steuere ich deshalb die erstbesten Toiletten an und bin froh, dass niemand hier ist. Weil ich fünf Minuten für mich brauche, um mich darauf vorzubereiten, meinen Job zu verlieren.
Es hätte mir klar sein müssen, dass eine der meistgelesensten Zeitschriften des Landes nicht hinter Journalistinnen steht, die vor laufenden Kameras verhaftet werden. Status steht immerhin in einer Reihe mit Forbes, People oder der Cosmopolitan. Und obwohl in der Redaktion eines Lifestyle-Magazins nicht unbedingt die Themen auf den Tisch kommen, für die ich mich persönlich interessiere, liebe ich meinen Job. Er lenkt mich ab, wenn alles andere mal wieder wie eine Welle über mich hinwegschwappt. Außerdem durfte ich in meinen wöchentlichen Beiträgen über nachhaltige Trends schreiben. Nichts allzu Weltverbesserischeres natürlich. Eher so Dinge wie wiederverwendbare Kaffeebecher oder Yoga-Matten aus Kork. Aber damit war es das jetzt wohl auch. Schließlich kann es sich nur noch um Minuten handeln, bis diese Kolumne mit mir zur Tür rausgeschickt wird.
Am liebsten würde ich mein Gesicht in die Mooswand drücken und meinen Frust hinausschreien. Wie lächerlich ist es, dass sogar über die Inneneinrichtung der Status-Klos schon mal in der Vogue berichtet wurde, die Nachrichten gestern aber mit keinem Wort erwähnen konnten, warum ich gegen Wallaby bin? Zugegeben, es sieht wirklich cool aus, dass die Wände in diesem Bad nicht mit Tapeten, sondern echten Pflanzen verkleidet sind. Aus den Lautsprechern zirpen Grillen, und das Licht ist schummrig gedimmt. Aber es ist immer noch ein Klo. Ein Klo, dem eine ganze Doppelseite gewidmet wurde, während mir absolut niemand zuhört. Nicht Minister Wallaby, nicht sein Sekretär, nicht die Polizei, nicht Darell. Einfach niemand! Und so toll ist dieses Schickimicki-Design auch wieder nicht, weil die Glühbirnen so eigenartig gefärbt sind, dass ich fast schon mit der Nase den Spiegel berühre, damit ich mich im Halbdunkeln überhaupt richtig erkennen kann. Das Gute daran ist, dass ich in diesem Licht gar nicht so schlimm aussehe. Das Schlechte, dass ich auch ohne dunkle Glühbirnen in einem ziemlich ungünstigen Licht dastehe.
Um mich zu beruhigen, trommle ich mir mit den Fingerknöcheln gegen das Brustbein. Das habe ich zufällig in der letzten Status-Ausgabe gelesen. Es soll bei Panikattacken helfen. »Das wird schon«, flüstere ich und beobachte, wie sich dabei die Lippen meines Spiegelbildes bewegen.
Manchmal muss man akzeptieren, dass man nichts ausrichten kann, schießen mir Darells Worte durch den Kopf, und ich will sie wieder loswerden, weshalb ich noch fester auf meine Brust klopfe. »Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon.«
»Ähm, sorry King Kong! Aber das ist das Männerklo.«
Ich fahre herum, reiße die Augen auf, stolpere gegen das Waschbecken und werfe das Puder zu Boden, sodass es scheppernd auf den Fliesen landet und zerbröselt. Alles im Bruchteil eines Augenblicks.
»Oh, shit.« Der Typ vor mir bückt sich, hebt die Dose auf und hält sie mir mit einem schiefen Grinsen hin.
Ich sage nichts. Starre einfach. Weil er einen schwarzen Hoodie trägt, die Kapuze auf dem Kopf und eine Sonnenbrille im Gesicht. Wer nimmt bitte in geschlossenen Räumen seine Sonnenbrille nicht ab? Sieht er hier drin damit überhaupt etwas? Und warum muss er ausgerechnet jetzt auftauchen? Ich war noch nicht fertig; ich habe mich noch nicht gesammelt; ich bin noch nicht bereit, mich normal zu verhalten. Es ist … also kein guter Zeitpunkt.
»Alles klar bei dir?« Er lacht leise. Dunkel und rau.
Ich senke rasch den Blick. Da ist immer noch seine Hand mit meinem Puder. An seinen Fingern haftet etwas, das wie schwarze Spritzer aussieht. Vielleicht Farbe. Das Licht ist zu merkwürdig, um es genauer zu sagen. Aber die Reihe keramikweißer Pissoirs, über denen riesige Bananenblätter hängen, sind im Grunde trotzdem nicht zu übersehen … Ich könnte mich jetzt entschuldigen, »danke fürs Aufheben« sagen und verschwinden. Aber aus irgendeinem Grund bin ich wütend. Wegen gestern, wegen morgen, wegen Status. Weil alles zu viel ist und ich nicht genug bin. Und darum fühlt sich sein Lachen falsch an. Wie ein Auslachen. Überheblich.
»Weißt du was?«, sage ich deshalb, reiße ihm das kaputte Puder aus der Hand und donnere die Dose in einer Kurzschlussreaktion einfach in den Mülleimer, was ich sofort bereue, aber ich kann jetzt schlecht beginnen, zwischen den benutzten Papierhandtüchern zu wühlen. »Wenn du glaubst, dass ich mich hier zum Affen mache, dann liegst du verdammt falsch. Selbst wenn ich auf das Empire State Building klettern müsste, damit mir die Leute zuhören. Ich würde es tun!«
Uns klappt gleichzeitig der Mund auf. Ihm und mir. Wir sind beide überrascht von meinem Ausbruch. Aber ich fange mich als Erste wieder und dränge mich wortlos an ihm vorbei nach draußen ins Foyer.
Ich glaube, dass er mir noch irgendetwas hinterherruft, aber meine Ohren summen vor Aufregung, und ich bleibe nicht stehen, durchquere so schnell ich kann die Eingangshalle und rette mich in den erstbesten Aufzug.
Die Tatsache, dass ich nicht mehr lange hier arbeiten werde, hätte jetzt zum Vorteil, dass ich dem Typen nie wieder begegnen müsste. Wobei ich nicht glaube, dass er ebenfalls ein Status-Mitarbeiter war. Zumindest muss er aus einer anderen Abteilung als der Redaktion sein. Vielleicht von der Technik oder dem Podcast-Team. Das heißt zwar nicht, dass er das eben verdient hat, aber ich rede mir ein, dass er mich in fünf Minuten sicherlich vergessen haben wird. Dass er mein geringstes Problem ist. Verglichen mit allen anderen. Eigentlich ist er sogar ganz und gar nicht mein Problem. Immerhin bin ich hier, um …
Noch bevor die Aufzugtüren sich wieder öffnen, höre ich bereits verzweifeltes Gebrüll aus der Richtung, in der Richards Büro liegt. Womöglich bin ich nicht die Einzige, die heute ihren Job verliert?
Die Klänge werden immer hysterischer, und als ich um die nächste Ecke biege, bleibe ich verdutzt stehen. Ein kleines Mädchen sitzt auf der Couch neben Poppys Schreibtisch. Ich schätze sie auf ungefähr sechs, vielleicht jünger, aber auf jeden Fall ziemlich aufgebracht, weil sie mit den Händen auf das Sitzpolster einschlägt und ihre Stimme schon ganz spröde ist.
Poppy versucht verzweifelt, ihr einen Schokoriegel schmackhaft zu machen, bricht den Versuch jedoch ab und stöckelt zu mir rüber. »Die Nanny ist ausgefallen, deshalb musste er sie kurzfristig mitnehmen. Ausgerechnet heute, wo Moby weg ist«, erklärt sie im Flüsterton.
»Wer ist weg?«
»Lindas Fisch, den sie für das Aquarium vor Richards Büro aussuchen durfte«, fügt sie hinzu und schmunzelt über meinen verwirrten Gesichtsausdruck.
»Wo ist er denn?«, frage ich ebenso leise.
Poppy zieht sich mit dem perfekt manikürten Finger eine Linie über den Hals. »Richard hat ihn gestern Abend entsorgt, nachdem er verkehrt herum an der Oberfläche dümpelte. Und jetzt weiß er nicht, wie er ihr das erklären soll.«
»Verstehe.« Ich blicke zurück zu dem Mädchen. Wie ein Häufchen Elend sitzt sie auf der viel zu großen Couch und starrt ratlos auf das leere Aquarium, in dem sich eine Miniaturschatzkiste alle paar Sekunden öffnet und Blubberblasen ausspuckt.
Ohne darüber nachzudenken, gehe ich zu ihr hinüber.
»Hey«, sage ich vorsichtig, während ich mich vor sie knie. Die vielen Tränen lassen das Blau in ihren Augen schimmern, und plötzlich sprudeln die Worte nur so aus meinem Mund. »Du bist also Linda, ja? Moby hat mir von dir erzählt!«
»Du kennst Moby?«, fragt sie ungläubig.
Kurz verspüre ich den Anflug schlechten Gewissens, weil ich sie nicht anlügen möchte. Aber immerhin hat sie jetzt aufgehört zu weinen. »Natürlich kenne ich Moby«, fahre ich deshalb fort. »Ich bin ihm in der Bucht vor der Stadt über den Weg geschwommen, und er hat mir gesagt, dass ich dir etwas ausrichten muss …« Verschwörerisch blicke ich nach links und rechts, bevor ich ihr mit dem Zeigefinger bedeute, dass sie näher kommen soll. Linda wischt sich mit dem Saum ihres langärmeligen Shirts einmal quer übers Gesicht und beugt sich vor.
»Ich studiere Meeresbiologie. Weißt du, was das ist?«, frage ich nach.
Sie spitzt die Lippen und kräuselt ihr kleines Näschen. »Ich dachte, du arbeitest hier?«
Ich lache. »Ja, das auch.« Noch, ergänze ich in Gedanken. »Aber meistens bin ich so etwas wie eine Meerjungfrau auf Mission. Deshalb schwimme ich ziemlich oft in der Bucht und beobachte die Riffe. Dort habe ich Moby entdeckt. Und ähm … Moby wollte eine größere Wohnung. Deshalb ist er zurück ins Meer. Aber er hofft, dass du ihn dort bald besuchst, damit er …«
»Meinst du das echt?«, drängt Linda, und ich bin erstaunt, dass sie mir das alles glaubt. Wenn ich im Rathaus gestern nur halb so überzeugend hätte sein können, wäre mir der Nachmittag im Gefängnis vielleicht erspart geblieben. Die Stelle, an der mich der Cop am Oberarm gepackt und mitgeschleift hat, spüre ich jedenfalls immer noch, aber ich schüttle rasch die Erinnerung daran ab und improvisiere weiter. »Weil er dir seine neuen Freunde vorstellen möchte. Eigentlich wollte er sich schon längst bei dir melden. Damit du dir keine Sorgen um ihn machst. Aber unter Wasser passiert es schnell, dass man alles andere vergisst, weißt du?«
Lindas Augen leuchten auf, dann lehnt sie sich an mir vorbei. »Stimmt das, Daddy?«, fragt sie hoffnungsvoll, und ich verliere vor Schreck fast das Gleichgewicht, kann mich gerade noch an der Couch festhalten und rapple mich hastig auf.
Richard steht vor seinem Büro und blickt abwechselnd von seiner Tochter zu mir. »Moby hat jetzt richtig viele Fischfreundinnen, Schätzchen. Hatte ich das nicht erwähnt?«, spielt er – etwas eigenartig – mit und bedeckt mit einer Hand den unteren Teil des Telefons, das ihm zwischen Schulter und Ohr klemmt.
Linda schüttelt trotzig den Kopf, aber ihre Welt scheint wieder in Ordnung zu sein, denn als wäre nichts gewesen, hüpft sie mit beiden Füßen gleichzeitig zu Poppys Schreibtisch, sodass ihre Sandalen bei jedem Aufprall bunt leuchten, schnappt sich den Schokoriegel von vorhin, und setzt sich damit in die Malecke für Kinder, wo ein Märchenbilderbuch liegt, das sie mit einem zielsicheren Griff auf der letzten Seite aufschlägt, als wollte sie sichergehen, dass da ein Happy End wartet.
Richard beendet währenddessen das Telefonat, lässt mich dabei aber nicht aus den Augen und mustert mich nachdenklich. Offenbar hat er alles mitgehört und fragt mich sicher gleich, wieso um alles in der Welt ich seine Tochter anlüge. Aber dann kommt alles ganz anders. »Dich schickt der Himmel«, sagt er stattdessen, und sein Lächeln wirkt zuversichtlich.
Ich … bin verwirrt. Auf gute Art. Heißt das, dass er mich jetzt doch nicht rauswirft?
»Bitte, nach dir!«, fordert Richard mich mit einem Wink in sein Büro auf, wo ich vor einem rappelvollen Schreibtisch Platz nehme.
Er lächelt immer noch, weshalb ich es optimistisch erwidere, während ich den wahren Grund für meinen kurzfristigen Termin bei ihm erfahre: »… Carol musste sich jedenfalls dringend Urlaub nehmen.« Richard verdreht die Augen. »Ich war ja der Meinung, dass eine Scheidung kein Grund ist, sich auf die Bahamas abzusetzen, aber sie saß bereits am Flughafen. Deshalb hätte ich gerne, dass du das Special für die nächste Ausgabe schreibst«, beendet er einen Monolog, in dem er mir erklärt hat, weshalb auf die Schnelle niemand anderer in diesem riesigen Konzern dafür infrage kommt.
»Und … was wäre das Thema?« Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich meinen Job anscheinend behalten darf. Irgendwie war ich felsenfest davon ausgegangen, dass ich ihn los bin. Und das Special verfassen normalerweise Senior-Redakteure. Weiß Richard etwa gar nicht, was ich getan habe? Eine Millisekunde denke ich darüber nach, es ihm zu sagen. Weil ein Special bedeuten würde, dass mein Name direkt unter der Überschrift steht. Aber dann rede ich mir ein, dass die Leute, die mich im Fernsehen gesehen haben, sich mit Sicherheit nicht gemerkt haben, wie ich heiße. In ein paar Tagen wird man dann auch mein Gesicht vergessen haben. Und damit ist alles wieder beim Alten. Was schlecht ist. Aber wenn sogar Darell sagt, dass ich nichts mehr tun kann … Obwohl mir absolut nicht mehr danach ist, zwinge ich meine Mundwinkel nach oben.
»Die Ausgabe erscheint am Valentinstag. Wir haben ein paar nette Marken-Kooperationen, deshalb soll sich der Inhalt des Specials um die Liebe drehen.« Richard zeichnet mit den Zeigefingern ein Herz in die Luft und lacht. Wahrscheinlich findet er das Thema selbst dämlich. »Die gesponserten Produkte müssen dazupassen«, fährt er fort. »Pralinen, Parfums, Themendinner, diese Dinge. Aber wie du das umsetzt, bleibt dir überlassen. Ich wäre ja für etwas Innovatives zur Abwechslung.«
Abwehrend hebe ich die Hände. »I-ich weiß nicht«, stammle ich unschlüssig. Richard ignoriert meinen Einwand, schnappt sich eine Kiwi aus der Obstschale und beißt die Hälfte davon einfach ab, ohne sie davor zu schälen.
»Das ist doch ein Klacks für dich. Du bist ein junges, hübsches Mädchen. Schreib darüber, wie deine Generation datet, wie großartig sich Verliebtsein mit diesem und jenem Parfum kombinieren lässt … Du hast alle Freiheiten, und vorhin hast du bereits bewiesen, dass du kreativ bist.«
So kreativ aber auch wieder nicht! Wenn ich geahnt hätte, dass Richard mich hierfür ins Büro zitiert, hätte ich Linda gesagt, dass Moby jetzt ein Fischstäbchen ist. Oder schlicht die Wahrheit. Dass er im Klo runtergespült wurde, es jetzt aber definitiv besser hat als in einem winzigen Aquarium.
»Darf ich auch darüber schreiben, dass wir die Ozeane mehr lieben sollten?«, frage ich und lächle verkrampft.
Richard hält kurz beim Kauen inne. Mit der Zunge pult er sich ein Stück Schale aus den Backenzähnen. »Ah, ah«, nuschelt er kopfschüttelnd.
»Ich fürchte, dass ich nicht die Richtige für dieses Thema bin«, versuche ich mich weiterhin herauszureden, ohne jämmerlich zu klingen. Ich kann Richard ja schlecht erklären, weshalb ich nicht an Liebe glaube. Aber irgendwie muss ich ihm klarmachen, dass es dramatisch enden wird, wenn er mich dazu zwingt, dieses Special zu schreiben. Dramatisch schlecht.
»Oh, Amy, Amy«, murmelt Richard und ich sehe mit Unbehagen zu, wie er sich den Rest der Kiwi in den Mund stopft, bevor er die klebrige Hand einfach seitlich am karierten Sakko abwischt. »Was hältst du von einem Deal?«
Ich hebe eine Augenbraue.
»Dein Auftritt gestern war amüsant.«
Ich lasse die Braue wieder sinken und kann mich gerade noch daran hindern, genervt auszuatmen. Natürlich hat er die Nachrichten gesehen … Ich bin nicht einmal überrascht. Aber anstatt im Erdboden zu versinken, muss ich mich zügeln, nichts Unpassendes zu erwidern. Das, was mir am wichtigsten ist, als lächerlich und amüsant abzutun, ist jedenfalls nicht unbedingt der Weg, mich dazu zu bringen, eine verdammte Story über das unwichtigste und dümmste Thema der Welt zu schreiben. Richard könnte genauso gut ein paar Märchen aus dem Buch seiner Tochter nehmen und abdrucken. Oder vielleicht sollte er es einfach dabei belassen, dass Carol das Special von den Bahamas aus schreibt und Werbung für ihren Scheidungsanwalt macht.
»Wir sind auf derselben Seite«, lenkt Richard meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er legt den Kopf schräg und schmunzelt. »Wir wollen unser Thema in die Welt bringen. Meines ist das Februar-Special. Das Medienhaus hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, damit Ezra Afzal die Story illustriert.« Er sieht mich abwartend an, aber ich sitze weiterhin skeptisch vor ihm. »Es ist eine Seltenheit, dass man den Kerl noch dazu bekommt, solche Auftragsarbeiten zu machen! Ezras Design wird der Aufhänger, und wir rechnen mit dementsprechenden Verkaufszahlen. Text und Bild müssen unbedingt zusammenpassen. Deshalb hätte ich gerne, dass ihr gemeinsam an dem Projekt arbeitet. Meine innere Stimme sagt mir, dass der junge Mann sich ansonsten womöglich etwas einfallen lassen könnte, das nicht zum Status von, äh, nun ja, Status passt, wenn du verstehst, was ich meine.«
Das klingt eigenartig. Ein Grund mehr, den Job nicht anzunehmen. Es kommt ja fast so rüber, als sollte ich für den Typen Babysitterin spielen, damit er sich beim Malen nach Zahlen nicht vertut. »Mir ist klar, dass das Projekt wichtig ist. Aber gerade deshalb muss ich dir dringend davon abraten, es mir anzuvertrauen«, stelle ich mit Nachdruck klar. Ich bin unendlich dankbar, dass ich meinen Job behalten darf. Aber mein Job besteht daraus, die besten Bambuszahnbürsten zu ranken und den Leuten zu sagen, welche Second-Hand-Shops Klamotten haben, die wirklich cool sind. Mein Job besteht nicht daraus, mit einem unberechenbaren Künstler Herzchen zu illustrieren.
»Papperlapapp. Ich bin mir sicher, dass du die passenden Worte finden wirst. Vor allem deshalb, weil ich dir dafür die Seite von Carols Beauty-Kolumne zur freien Verfügung stelle. Die fällt nämlich auch weg.«
In der Sekunde, als mein Verstand begreift, was das bedeutet, schnappe ich lautlos nach Luft. Status wird von achtunddreißig Millionen Menschen gelesen, und meine Beiträge darin belaufen sich auf mickrige sechshundert Zeichen. Eine ganze Seite, wie Carol sie normalerweise hat, ist mehrere Zehntausend Dollar wert, und wenn ich darüber schreibe, wie wichtig die Green-Zone für November Bay ist, kann ich das Aufheben der Schutzzone vielleicht tatsächlich noch verhindern. Zumindest wäre es nach meinem unüberlegten Auftritt von gestern eine zweite Chance. Minister Wallaby will mir nicht zuhören? Dann rede ich eben mit ein paar Millionen Menschen, und wenn die dann wütend in sein Büro marschieren und ihn mit Fischernetzen bombardieren, muss er etwas tun! Ich merke erst, dass ich lächle, als ich das Ziehen in meinen Wangen spüre.
»Deal?« Richard lehnt sich zurück und knabbert an der Verschlusskappe seines Kugelschreibers.
»Wann ist die Deadline?«, frage ich zögerlich.
»Du hast bis zum sechsten Februar Zeit. Dann müssen beide Storys fertig sein.«
»Das sind …« Ich rechne im Kopf nach.
»Mit heute dreizehn Tage, also knapp zwei Wochen«, kommt Richard mir zuvor.
»Zwei Wochen«, wiederhole ich gedankenverloren.
»Ich leite dir Ezras Kontakt weiter. Und die Verschwiegenheitsvereinbarung, die du für die Zusammenarbeit unterzeichnen musst. Der Kerl ist ein bisschen paranoid.«