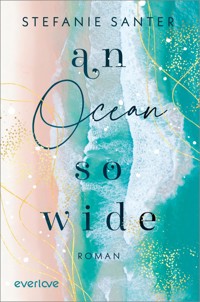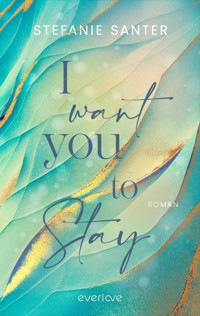
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wenn dein perfektes Leben plötzlich zerbricht Infolge einer scheinbar harmlosen Verletzung verliert Birdie ein Bein. Nicht nur Birdie ist mit der Situation völlig überfordert, auch ihr Vater, ein reicher Politiker, weiß nicht mehr, wie er mit seiner Tochter umgehen soll. Nach einem Galaabend, zu dem sie ihren Vater widerwillig begleitet, flüchtet Birdie in eine schummrige Bar, wo sie auf den geheimnisvollen Musiker Nave trifft, der nichts von ihrer Geschichte ahnt. Beide spüren sofort, dass sie füreinander bestimmt sind. Doch die Geheimnisse, die sie sich verschweigen, drängen mit jedem Tag, jeder Berührung, jedem Kuss nach und nach ans Licht und stellen ihr Glück auf die Probe … Stefanie Santer erzählt eine realistische und tiefgründige Liebesgeschichte, die nicht vor ernsteren Themen zurückschreckt. Birdie und Nave werden dein Herz sofort erobern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »I want you to Stay« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© Stefanie Santer 2024
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Hinweis
Widmung
Zitat
Kapitel 1
Birdie
Kapitel 2
Nave
Kapitel 3
Birdie
Kapitel 4
Nave
Kapitel 5
Birdie
Kapitel 6
Nave
Kapitel 7
Birdie
Kapitel 8
Nave
Kapitel 9
Birdie
Kapitel 10
Nave
Kapitel 11
Birdie
Kapitel 12
Nave
Kapitel 13
Birdie
Kapitel 14
Nave
Kapitel 15
Birdie
Kapitel 16
Nave
Kapitel 17
Birdie
Kapitel 18
Nave
Kapitel 19
Birdie
Kapitel 20
Nave
Kapitel 21
Birdie
Kapitel 22
Nave
Kapitel 23
Birdie
Kapitel 24
Nave
Kapitel 25
Birdie
Kapitel 26
Nave
Kapitel 27
Birdie
Kapitel 28
Nave
Kapitel 29
Birdie
Kapitel 30
Nave
Kapitel 31
Birdie
Kapitel 32
Kapitel 33
Birdie
Kapitel 34
Tom
Kapitel 35
Vic
Kapitel 36
Arthur
Kapitel 37
Birdie
Kapitel 38
Nave
Epilog
Nave
Nachwort
Danksagung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr am Buchende[1] eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis, eure Stefanie und euer everlove-Team
Für A. & M.
Für alle, die Geschichten in den Augen anderer lesen und nicht wegsehen, wenn Tränen sie erzählen.
»I must be gone and live, or stay and die.«
– Romeo (in Shakespeares Romeo & Juliet)
Kapitel 1
Birdie
Früher habe ich an schlechten Tagen einfach an die Zukunft gedacht und davon geträumt, dass dort alles besser sein wird. Ich habe dann meinen Kalender aufgeschlagen und begonnen, darin zu blättern, bis ich leere Seiten fand. Monate, die kommen würden und so vieles versprachen. Es beruhigte mich, auf noch nicht ausgefüllte Linien und Kästchen zu starren.
Aber ich hätte nie, wirklich niemals geahnt, dass ich irgendwann zurückblättern würde.
Weil die Zukunft nicht das ist, was ich mir erhofft habe.
22. März
08:00 Uhr – Nachkontrolle im Krankenhaus
10:30 Uhr – Physiotherapie
13:00 Uhr – Anprobe für die Mitleidsnummer
15:30 Uhr – Besprechung für die Mitleidsnummer
17:00 Uhr – Friseurtermin
19:00 Uhr – Mitleidsnummer
21:00 Uhr – Bathtub Drowning Konzert ☹
Das Konzert hatte ich noch vor dem Unfall eingetragen. Es tat ein kleines bisschen weh, die Karte zu verschenken. Aber das Schmerzpflaster an meinem Oberschenkel betäubt die meisten meiner Gefühle. Abgesehen von der ständigen Übelkeit und dem Schwindel.
Ich werfe einen Blick auf die tickende Uhr in der Wartehalle. Noch fünf Minuten bis zu meinem ersten Termin. Aber weil ich nicht länger an den heutigen Tag und alles, was mir bevorsteht, denken will, blättere ich sechs Monate zurück. Die Zeit und das Schicksal zwischen meinen Fingern.
22. September
Yoga mit Helen (Ausrede einfallen lassen?)
Frühstück mit Marcella @Burggasse24
Uni-Bücher zurückbringen (Gebühr fürs Überziehen in bar mitnehmen!!)
Last-minute-lernen
Privatrecht-Klausur (zweiter Antritt, shit)
Rechtsgeschichte-Seminar
Mittagspause mit Victor ❤
Volleyball-Training
Führerschein-Fahrstunde
Shooting
Helen ist die Freundin meines Vaters. Sie ist in Ordnung, aber ich bin aus mehreren Gründen nicht ihr größter Fan. Marcella hingegen kenne ich seit der ersten Klasse. Obwohl sie sich an der Uni für ein anderes Fach eingeschrieben hat und die einzelnen Fakultäten über die ganze Stadt verstreut sind, haben wir uns fast täglich getroffen. Egal, wie beschäftigt wir beide waren. Und jetzt kann ich mich nicht mal mehr erinnern, wann wir das letzte Mal telefoniert haben. Die Klausur habe ich übrigens auch beim zweiten Versuch nicht bestanden, Victor hat mich abserviert, und ich habe am Tag vor meinem Unfall zum letzten Mal Volleyball gespielt. Nur wusste ich das damals noch nicht. Ich habe wie immer die anderen Mädels abgeklatscht, mit ihnen das Netz abgenommen, mich in der Umkleide über belanglose Dinge unterhalten und lächelnd meine Sachen gepackt, bevor ich mir die Sporttasche geschnappt habe und zu meinem nächsten Kalendereintrag gelaufen bin. Ohne je kurz innezuhalten.
Und jetzt bin ich Stillstand. Ich habe meinen Führerschein zwar noch bekommen, bin aber danach nie wieder gefahren. Und das letzte Foto, das ich auf Instagram hochgeladen habe, war eines von diesem Brand-Shooting. Die blonden Haare in wilden Locken, orange- und pinkfarbener Lidschatten bis zu meinen Augenbrauen. In Kombination mit dem batik-bunten Bralette und den Leggings der Sportmarke sah es richtig gut aus. Aber diese Erinnerung kommt mir wie aus einem anderen Leben vor. War ich wirklich einmal so? So selbstbewusst? Mit einem Blick direkt in die Kamera, als könnte ich alles erreichen.
Natürlich bin ich, seit mein Alltag aus Arztterminen besteht, auch bei keiner Agentur mehr unter Vertrag. Ich bin bloß noch …
»Bernadette Marie Anker?«
Hastig klappe ich den Kalender auf meinem Schoß zu, blicke hoch und geradewegs in das Gesicht eines jungen Arztes. Bitte nicht, denke ich und würde mich am liebsten hinter der marmornen Säule ein paar Meter neben mir verstecken. Aber ich bewege mich keinen Millimeter.
Natürlich ist er jung. Und natürlich sieht er auch noch gut aus. Was mich unweigerlich daran erinnert, was er gleich sehen wird. Und dass mich seit Vic niemand in meinem Alter mehr nackt gesehen hat. Ich habe gedacht, dass das auch eines der Dinge ist, die ich irgendwann – ohne es zu wissen – zum letzten Mal erlebt habe. Jetzt gerade wünschte ich, dass es so wäre, obwohl das genauso traurig ist.
»Hier!« Konrad, der Fahrer meines Vaters, der mich zu den meisten meiner Termine begleitet, hebt kurz die Hand und steht auf.
Mit einem Ruck setzt sich mein Rollstuhl in Bewegung. Ich sehe über die Schulter nach oben. Zu Konrad, der meinen Blick jedoch gar nicht bemerkt und mich unbeirrt vorwärts schiebt.
Die Wartehalle ist voll, und ein paar Köpfe drehen sich in unsere Richtung. Vielleicht, weil sie meinen Namen eben erkannt haben. Vielleicht, weil ein Mann in Anzug mich durch die Gegend fährt. Aber hauptsächlich, weil sie wohl Mitleid mit mir haben. Ich seufze lautlos.
»Ruf mich an, wenn du fertig bist.« Für eine Sekunde berührt Konrads Hand zögerlich meinen Oberarm.
Ich blicke noch mal zu ihm hoch und nicke. Er nickt ebenfalls. Dann ist er weg, und ich manövriere mich die letzten Meter selbst in das Untersuchungszimmer.
Eine automatische Schiebetür gleitet hinter mir zu. Der Geruch von Desinfektionsmittel hängt in der Luft, und ich fühle mich schlagartig verloren. Also, ich weiß buchstäblich nicht, wohin mit mir. Vor dem Schreibtisch stehen bereits zwei Stühle. Ich könnte mich dahinterstellen. Oder daneben? Aber weil ich zu nichts aufgefordert werde, bleibe ich einfach, wo ich bin, direkt neben einem Torso-Modell, in dessen offener Bauchdecke sich bunte Organe ineinander verkeilen. Das Herz fehlt. Und ich fühle mich genauso.
Der Typ bekommt von meinem Dilemma allerdings nichts mit, weil er konzentriert über dem Tisch lehnt und etwas im Computer sucht. Die Maus klickt in regelmäßigen Abständen. Und dann setzt er sich auf einen Stuhl, dessen Sitzfläche aus einem ergonomischen Hüpfball besteht. Mein Physiotherapeut hat auch so einen.
»Der Oberarzt kommt gleich«, informiert mich McDreamy Junior, weiterhin klickend und stirnrunzelnd. Wahrscheinlich überfliegt er meine Akte und kann selbst nicht glauben, was mir passiert ist.
Ich murmle ein leises »Okay«. Keine Ahnung, ob er das gehört hat, weil er nicht aufsieht. Aber um ein weiteres Wort herauszupressen, müsste ich mich räuspern, und um ehrlich zu sein, will ich ja gar nicht, dass er mich ansieht. Oder wahrnimmt. Oder da ist. Ich will, dass er geht. Ich will gehen. Eins von beidem. Hauptsache, ich muss mich nicht vor ihm ausziehen.
Um mich von dieser Vorstellung abzulenken und nicht bloß verloren zu warten, greife ich nach hinten und angle nach meiner Tasche, die von einem der Schiebegriffe baumelt. Als ich meinen Kalender und das Handy darin verstaue, merke ich, wie meine Finger zittern. Ich hänge die Tasche zurück, zupfe meine Pulloverärmel bis über die Hände und balle diese in meinem Schoß zu Fäusten.
An McDreamys weißem Kittel hängt, etwas schief, ein Namensschild. Thomas Roth. Kein Titel. Vermutlich ist er Student. Als er aufsteht, um eine Verbindungstür zu öffnen, bin ich kurz davor, aufzuatmen. Weil ich denke, dass er tatsächlich geht. Aber er streckt bloß den Kopf hindurch.
»Die Patientin ist hier«, höre ich ihn sagen. Im nächsten Moment macht er einen Schritt zur Seite, um Platz für einen dürren alten Mann zu machen, der so groß ist, dass sein Kopf buchstäblich um ein Haar den Türrahmen berührt. Ich kenne ihn. Er ist ein Freund meines Vaters und der Arzt, der mich übernommen hat, als ich immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil nichts mehr geholfen hat.
Dr. Wrenn ist nicht sonderlich einfühlsam oder nett oder gesprächig, aber ich wäre dennoch lieber mit ihm allein. Nur erhört mich mein Schicksal wieder mal nicht, denn McDreamy bleibt und hilft mir beim Ausziehen meiner Jogginghose. Ich wünschte, ich könnte auf der Stelle im Erdboden versinken, aber ich bin immer noch da, als er mich fragt, wie’s mir geht. Ohne es zu wollen, erwidere ich seinen Blick. Nur kurz. Aber in dieser einen Sekunde erwäge ich, ihm die Wahrheit zu sagen. Stattdessen lüge ich und murmle »gut«, so wie ich es immer tue.
Er nickt freundlich und stützt mich, damit ich auf die Liege klettern kann. Als ich seine Hände auf mir spüre, hat er immer noch dasselbe freundliche Lächeln aufgesetzt. Ich versuche, zumindest mit meinen Gedanken woanders zu sein. Weit, weit weg. Aber noch während ich mich zögerlich zurücklehne, denke ich plötzlich wieder an Vic. Ich will nicht an Vic denken. Weil ich dann an tausend letzte Male denke und daran, nicht zu weinen. Viel zu fest beiße ich mir auf die Unterlippe, um ihr Beben zu unterdrücken.
Die ausziehbare Behandlungsleuchte ist grell auf mein Bein gerichtet. Die Blicke der beiden Ärzte auf meine Narbe. Behandschuhte Finger. Berührungen, die wehtun. Fachbegriffe, die sie bloß unter sich austauschen. Als wäre ich nicht da. Aber ich bin da. Und weil ich das nicht mehr aushalte, versuche ich mit aller Macht, gedanklich in die Zukunft zu blättern. Weg von diesem Krankenhaus. Weg von Vic. Weg von meinem Leben.
Mit angespanntem Nacken presse ich meinen Kopf fester gegen das raschelnde Papier der Liege, bis alles vorbei ist und meine Fingernägel sichelförmige Abdrücke auf meinen Handballen hinterlassen haben.
Als ich wieder in meinem Rollstuhl sitze, bin ich völlig fertig mit den Nerven.
»Es ist deutlich besser als die letzten Male. Ich glaube, dass wir dich hier erst wiedersehen müssen, falls erneut Komplikationen auftreten sollten. Was wir nicht hoffen.« Mein Arzt lacht, aber weder ich noch McDreamy stimmen mit ein. »Nun. Alles Gute, Bernadette.«
Ich bedanke mich, und als er auf mich zukommt, denke ich, dass er mir zum Abschied die Hand reichen will. Stattdessen tätschelt er meinen Kopf. Was komisch ist. Und unangenehm. Dann verschwindet er.
Der junge Medizinstudent macht ein Geräusch zwischen Schnauben und es gleichzeitig unterdrücken.
Hastig streiche ich mir die Haare zurecht. Mit den Fingern und auf gut Glück, weil hier zwar ein Spiegel über dem Waschbecken hängt, der aber viel zu hoch ist, als dass ich mich vom Rollstuhl aus darin betrachten könnte.
»Darf ich?« McDreamy streckt zögernd den Arm aus, verharrt jedoch mit der Hand neben meiner Wange, bis ich ihn ansehe. Erst dann zupft er mit einer schlichten Bewegung die abstehende Locke nach unten. »Jetzt passt wieder alles«, sagt er, und obwohl das nett von ihm war, will ich ihn anbrüllen. Weil überhaupt nichts passt.
»Bin ich fertig?«, frage ich und klinge kein bisschen wütend, kein bisschen aufgebracht, sondern einfach nur müde.
»Ja. Wir haben alles. Sie können sich jederzeit melden, falls Ihnen Veränderungen an der Narbe auffallen. Jetzt können Sie sich jedenfalls erst mal ganz darauf konzentrieren, wieder gehen zu lernen.«
Ich nicke bloß. Die Hände an den Reifen, will ich mich umdrehen, um nach draußen in die Wartehalle zu flüchten und Konrad anzurufen.
»Alles Gute«, sagt er schließlich noch, und ich halte inne. »Wenn wir uns das nächste Mal sehen, will ich, dass Sie zur Tür rausgehen.«
O Gott. Er macht es bloß noch schlimmer. Allein die Vorstellung davon überfordert mich. Dass ich jetzt Wochen und Monate damit beschäftigt sein werde, zu lernen, einen Schritt vor den anderen zu machen, obwohl ich weglaufen will. Weit, weit weg. Irgendwohin, wo mich niemand kennt und niemand sieht und ich nicht mehr ich sein muss.
Auf dem Weg zur Physiotherapie erscheint Helens Name auf meinem Handy. Sie schickt mir alle paar Tage ein pseudo-positives Zitat. Ich markiere die Nachrichten, so wie all die anderen davor, mit einem Herzen, obwohl ich am liebsten das augenrollende Emoji nehmen würde. Oder einen Kackhaufen. Weil ich Helens Zitate unnötig finde und, um ehrlich zu sein, … demotivierend. Aber irgendwie scheinen ihr die Ideen nicht auszugehen.
Zum Stirnrunzeln braucht man mehr Muskeln als zum Lächeln.
Ich stöhne leise auf, und als ich hochblicke, sehe ich, dass Konrad mich über den Rückspiegel mustert. »Alles in Ordnung?«
»Alles bestens«, sage ich automatisch.
Wieder vibriert mein Handy. Diesmal ist es eine Nachricht im Gruppenchat, die auf dem Sperrbildschirm aufscheint. Marcella und ein paar Mädels, mit denen wir befreundet sind. Ich lese schon lange nicht mehr mit, weil es meistens um Dinge geht, bei denen ich ohnehin nicht dabei sein kann. Eigentlich will ich nach links wischen, um die Gruppe für einen weiteren Monat auf stumm zu schalten. Aber stattdessen tippe ich unabsichtlich auf eine der Benachrichtigungen, und der Chat öffnet sich. Auf einen Blick erkenne ich, dass es um das Konzert heute Abend geht. Marcella hat ein Foto des Front-Sängers von Bathtub Drowning geschickt und ein sabberndes Emoji dazu gemacht.
Flora
Der ist nichts gegen den hier!
Ein neues Bild lädt und ploppt im Chat auf. Es ist ein abfotografiertes Plakat an einer Litfaßsäule. Darauf steht in Großbuchstaben NɅVE. Aus dem Text daneben lese ich heraus, dass sein Auftritt vor dem Hauptakt heute Abend stattfindet. Das muss kurzfristig geändert worden sein, denn als ich meine Karte damals gekauft habe, ist mir das nicht aufgefallen. Ist er mir nicht aufgefallen. Und … das wäre er. Denn unter dem Namen und Datum prangt ein Gesicht. Die Hälfte davon durch einen Schatten verdunkelt und die andere so markant, dass man regelrecht froh ist, nur mit fünfzig Prozent von ihm konfrontiert zu werden. Weil das Ganze zu intensiv wäre. Weil man ein Verkehrschaos verursachen würde, wenn man mit dem Auto daran vorbeifährt und es zufällig sieht. Weil man sich danach auf nichts anderes mehr konzentrieren könnte.
Okay, das klingt lächerlich. Aber ich bin nicht die Einzige, die gerade ranzoomt. Denn die Mädels im Chat feuern eine Nachricht nach der anderen ab, in der sie sich erst über sein Aussehen unterhalten und dann zu Stalkerinnen werden.
Miriam
Wie heißt er auf Instagram? Wieso finde ich ihn nicht???
Thea
Er hat anscheinend kein Social Media!
Marcella
Hat irgendjemand noch andere Bilder von ihm gefunden?
Flora
Ich werde auf jeden Fall früher da sein, damit wir einen Platz in der ersten Reihe haben!
Wie in Trance starre ich auf die markanten Gesichtszüge. Die verwuschelten schwarzen Haare. Die geraden Augenbrauen. Als würden sie sich nie krümmen, weil ihn nichts überraschen kann. Und dann, tja … dann ist da noch sein Blick, der so nichtssagend und allesrufend zugleich ist. Seine Augen sind ein goldgelbes Grün. Ich zoome noch näher ran. Wie Tequila mit Moos. Das haben die bestimmt bearbeitet. Solche Augen hat kein Mensch!
Mit einem Ruck wird die Luft aus meinen Lungen gepresst. Der Gurt schneidet in meinen Oberkörper, lautes Hupen ertönt, und Konrad, der gerade eine Vollbremsung hingelegt hat, flucht.
»Das kann doch nicht dein Ernst sein, du Wappler!«, ruft er, murmelt jedoch gleich darauf eine Entschuldigung über die Schulter in meine Richtung und starrt dann den beschuldigten Autofahrer noch mal wütend an, bevor er demonstrativ die Spur wechselt und beschleunigt.
Meine Finger sind in der Hektik vom Display gerutscht. Naves Bild wandert immer weiter nach oben, je mehr neue Nachrichten im Chat kommen. Und weg ist der Moment, in dem ich vergessen habe, dass es mir egal sein kann, ob ich jemanden attraktiv finde oder nicht. Weil man mich nie wieder auf diese Weise wahrnehmen wird.
»Wir sind gleich da«, lässt Konrad mich wissen, und ich mache bloß einen zustimmenden Laut, weil ich trotz allem gerade dabei bin, den Typen ebenfalls zu googeln.
Man findet wirklich kaum etwas. Kein weiteres Foto. Aber es gibt ihn auf Spotify. Hastig krame ich in der Tasche nach meinen AirPods. Ich will seine Stimme hören. Will wissen, was ich heute Abend verpasse, damit ich wütend und traurig sein kann. Weil das alles ist, was mir noch das Gefühl gibt, zu sein. Wut und Trauer. Aber als ich den ersten Song antippe, ertönt nur noch der Klang einer Abwärtsspirale, weil der Akku meiner Kopfhörer den Geist aufgibt.
Kapitel 2
Nave
I am everybody’s villain.
They warn you about guys like me.
»Ich kann das nicht machen.« Kopfschüttelnd schabe ich mit den Zähnen über meine Unterlippe, lasse sie wieder los und fasse mir stattdessen in den Nacken. Je mehr ich darüber nachdenke, desto fester knete ich meine Muskeln, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mich selbst enthaupten oder tatsächlich bloß meine Verspannungen lockern will.
»Hätte dich nicht für den Lampenfieber-Typ gehalten.« Tom, mein Mitbewohner, mustert mich von der Couch aus und legt seine Lernunterlagen zur Seite.
»Du weißt genau, warum ich das mit Arthurs Interview nicht machen sollte. Wenn jemand die Sache in den falschen Hals kriegt, sieht das echt scheiße für mich aus.«
»Alter, reg dich ab. Es ist bloß ein Interview. Wir haben hier Meinungsfreiheit.« Er sucht meinen Blick, bevor er die nächsten Worte sagt. »Du glaubst echt immer, dass alles, was du tust, ein Risiko ist.«
Elvis streicht um meine Beine. Ich bücke mich, und weil sie schnurrt, will ich ihr über den gekrümmten Katzenbuckel streicheln. Doch als ich dazu ansetze, kratzt sie ohne Vorwarnung über meinen Handrücken, sodass eine feine Linie zurückbleibt, aus der augenblicklich Blut quillt.
Ich stoße ein frustriertes Schnauben aus. »Hört das irgendwann auf?«
Obwohl ich dem nichts hinzufüge, weiß Tom genau, was ich meine. »Jap, und zwar dann, wenn du endlich einsiehst, dass du nicht jeden davon überzeugen musst, einer von den Guten zu sein. Keiner kann dir was, und wir sind alle auf deiner Seite.«
Ich hebe einen Mundwinkel und nicke. Nicht, weil ich glaube, dass er recht hat. Sondern weil ich ihn nicht mit meiner Stimmung runterziehen will. Tom hat keine Ahnung, dass ich wahrscheinlich nur noch ein paar Monate in Wien bleiben werde. Arthur hingegen weiß Bescheid. Deshalb denkt er, das Interview wäre meine große Chance. Es gab eine Zeit, da wollte ich ihm glauben. Deshalb habe ich es auch aufgenommen. Aber dann sind die Zweifel gekommen, und noch bevor er es in seine Reportage schneiden konnte, habe ich ihn gebeten, das Material zu löschen.
Die schwarze Katze springt auf die Couch und rollt sich neben Toms Laptop ein. »Ach, und Elvis wird dir vergeben, wenn du ihr endlich einen würdigen Namen gibst«, fügt er hinzu.
»Elvis ist ein würdiger Name.«
»Für einen Kater, Nave. Du musst endlich einsehen, dass sie keine Eier hat.«
»Ich wollte ihr damit zeigen, dass sie alles sein kann, was sie will.« Hauptsächlich wollte ich einfach, dass sie Elvis heißt, weil es mich an die Schallplatten meines Vaters erinnert.
»Was ist mit Elvira?«
»Nein.«
»Elvi?«
»Nein.«
Tom will erneut zu einem Gegenvorschlag ansetzen, aber sein Handy gibt diesen für einen bestimmten Kontakt personalisierten Laut von sich, und er greift sofort danach. Ein breites Grinsen stiehlt sich auf seine Lippen, das jedoch von Sekunde zu Sekunde weiter in sich zusammenfällt, bis es zu einem Negativlächeln wird und seine Mundwinkel schließlich nach unten zeigen.
»Was ist los?«
Toms Seufzen lässt mich erahnen, warum er das Handy im nächsten Moment ans andere Ende der Couch schleudert, wo es dumpf zwischen den Kissen landet. Elvis hat diese Reaktion jedoch nicht kommen sehen und springt hoch. Mit angelegten Ohren faucht sie Tom an, der mindestens genauso angepisst aussieht, irgendwas Unverständliches grummelt und den Kopf schüttelt.
»Schon wieder?« Ich tippe darauf, dass Toms Date ihn hinhält oder ihn diesmal endgültig abserviert hat. Um ehrlich zu sein, wäre mir Letzteres lieber. Seit Wochen klammert er sich an leere Versprechen, und täglich sehe ich dabei zu, wie seine Launen und Pläne davon abhängen.
»Schon wieder«, bestätigt Tom emotionslos und verschwindet in seinem Zimmer.
Ich weiß, dass er nicht darüber reden will, weil wir ziemlich ähnlich gestrickt sind. Deshalb lasse ich ihn in Ruhe, fülle Elvis’ Napf und räume die Unterlagen von der Couch, um sie vor den Krallen unserer WG-Katze zu retten. Eine Akte mit dem Logo des Universitätsklinikums rutscht mir dabei aus der Hand, und die herausfallenden Blätter segeln in einem Durcheinander zu Boden. Hastig sammle ich sie wieder ein, ignoriere die Gänsehaut, die sich plötzlich über meine Arme ausbreitet, und blicke durch die gläserne Balkontür nach draußen, weil es zu regnen begonnen hat.
Als ich in Wien angekommen bin, hat es auch geregnet. Daran erinnert mich dieses prasselnde Geräusch jedes Mal. Und an das Versprechen von Zukunft, das zumindest damals noch frisch in der Luft lag.
Kapitel 3
Birdie
»Da bist du ja.« Mein Vater kommt die Stufen nach unten ins Foyer, richtet seine Manschettenknöpfe und beugt sich zu mir, um mich auf die Stirn zu küssen. »Du siehst wunderschön aus.«
Victor steht in einem schwarzen Anzug reglos neben dem hölzernen Antrittspfosten der Treppe. Ich versuche, ihn zu ignorieren.
Das PR-Team meines Vaters hat beschlossen, dass ich heute Abend auf der Spendengala »in Erscheinung treten« soll. Was sie damit meinen, ist, dass ein paar Kollegen meines Vaters in einen kleineren Skandal verwickelt waren und ich davon ablenken soll.
Die arme Tochter, die sich ins Leben zurückkämpft. Das bringt Sympathiepunkte. Und mein schlechtes Gewissen ist so groß, dass ich nicht Nein gesagt habe.
Normalerweise habe ich meinen Vater nie zu solchen Anlässen seiner Partei begleitet. Höchstens mal zu einer Rede auf dem Rathausplatz. Da war ich noch um einiges jünger und wollte wegen des Kinderschminkens und der Luftballons unbedingt dabei sein. Aber je älter ich wurde, desto wichtiger war es meinem Vater, mich grundsätzlich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Zumal wir keine Familie sind, bei der es sich lohnt, sie zu seinen Gunsten auf Wahlplakaten abzubilden. Weil es bloß wir beide wären. Er und ich.
Als irgendeine Mitarbeiterin in Bleistiftrock mir also gesagt hat, dass ich heute dabei sein werde, habe ich zuerst gelacht, auf mein Bein gezeigt und »Wie denn?« gesagt. Ihre Antwort? »Im Rollstuhl.« Sie wollte explizit nicht, dass ich die Krücken nehme, weil ich sitzend mehr Mitleid errege. Mein Vater war bei dem Gespräch nicht dabei, und ich wollte ihn schon fast anrufen. Ihm davon erzählen und hören, dass ich keine Schachfigur bin. Aber dann habe ich daran gedacht, dass er im Grunde Bescheid wissen muss. Dass er das abgesegnet haben muss, bevor sie zu mir gekommen ist. Als mir das klar wurde, habe ich mich dazu durchgerungen, die Veranstaltung einfach wortlos in meinen Kalender einzutragen.
»Sieht sie nicht toll aus?« Mein Vater dreht sich zu Victor, der für den Bruchteil einer Sekunde um Fassung ringt.
»Wunderschön«, sagt er schließlich, und während mein Vater sich zur Garderobe wendet, um nach seinem Mantel zu greifen und hineinzuschlüpfen, lenke ich meinen Rollstuhl demonstrativ zur Haustür. Weg von Vic. Weil meine Würde gerade nur Show ist. Dass ausgerechnet er mich so sieht, ist erniedrigend, und wenn ich könnte, würde ich ihm für immer aus dem Weg gehen.
Aber er arbeitet seit ein paar Monaten für meinen Vater. Dieser Job war angeblich auch der Grund, weshalb wir uns nicht mehr daten können. Weil Leute auf falsche Gedanken kommen könnten. Dass er die Stelle nur meinetwegen bekommen hätte; dass er nicht wirklich arbeitet, sondern stattdessen Zeit mit mir verbringt, wenn er hier ist …
Aber das sind bloß armselige Ausreden. Weil unsere Väter gute Freunde sind, die sich ständig Gefallen tun. Vic hat die Stelle also deshalb bekommen. Dass wir zusammen sind, damit hätten unsere Familien auch kein Problem. Ich weiß sogar, dass mein Vater sich das insgeheim wünscht und darauf hofft. Aber er hat keine Ahnung davon, dass wir uns tatsächlich bereits nähergekommen waren. Dass ich Vic mochte. Wirklich mochte. Und dass er mich nach dem Unfall einfach abserviert hat.
»Bist du bereit?«
Ich nicke meinem Vater zu. Mein Physiotherapeut, dem ich von der Gala erzählt habe, meinte in der heutigen Sitzung, dass ich nichts tun muss, das ich nicht will. Aber nachdem dieser Satz seinen Mund verlassen hat, habe ich die restliche Stunde auf Durchzug geschaltet. Immerhin besteht mein kompletter Alltag nur noch aus Dingen, die ich nicht machen will, aber tun muss. Zwei Schneiderinnen dabei zusehen, wie sie mein Kleid so bemessen und abstecken, dass es mit den heruntergeklappten Fußauflagen meines Rollstuhls abschließt, zum Beispiel. Millimetergenau.
»Wir haben eine Kerze für dich angezündet.« Die ältere Dame, die mir an einem der runden Tische im Kuppelsaal des Hilton-Hotels gegenübersitzt, hält sich die knöchernen Finger an die schmalen Lippen. Der korallenfarbene Lipgloss schwimmt wie Lava in den vielen Falten. Ihr Ehemann einen Stuhl daneben räuspert sich. »Dich noch unter uns zu haben«, fährt sie fort. Und er nickt. Glaube ich zumindest. Er hat nicht wirklich einen Hals, weil sein Kopf direkt an den Knoten der schwarzen Fliege anschließt.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, und unterdrücke mit aller Macht ein Bröckeln meines aufgesetzten Lächelns. Keine Ahnung, wer die beiden überhaupt sind. Vielleicht habe ich sie schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht auch nicht. Aber der Plan des PR-Teams geht auf. Ich bin das perfekte Ablenkungsmanöver, und wenn man Mitleid sehen könnte, müsste ich mich mindestens einen Monat lang duschen, um das Zeug wieder abzubekommen.
»Es war so tragisch.« Sie greift nach der Hand ihres Mannes, die auf der bereits fettigen Stoffserviette auf dem Tisch liegt. »Für uns alle.«
Wow. Tut mir ja echt leid, dass es für euch genauso dramatisch war. Wer seid ihr noch mal?
»Danke«, sage ich zum gefühlt tausendsten Mal heute und lege das Besteck ab. Ich hatte ohnehin keinen Hunger, und die weißliche Schaumsoße auf dem Fischfilet vor mir sieht aus, als hätte jemand mit Tollwut darauf gespuckt.
Ich spüre, wie sich meine Finger an den Reifen des Rollstuhls verkrampfen, die ich viel zu fest packe, während mein Blick über die Menge von mit Klunkern besetzten Menschen wandert. Ein Stück weiter hinten unterhält sich mein Vater mit einer Frau, die ein Headset trägt und ihm etwas auf ihrem Klemmbrett zeigt. Gott sei Dank ist es nicht die Mitarbeiterin im Bleistiftrock.
»Es ist wirklich schön, dass du hier bist, Bernadette. Deinen Vater unterstützt. So eine Tochter wünscht man sich.«
Ich nicke der nervigen Dame noch mal nett zu. Wenn ich jetzt nicht verschwinde, fange ich an, zu heulen. Oder zu schreien. Aber ich weiß, dass ich das nicht bringen kann. »Bitte entschuldigen Sie mich.«
»Aber natürlich«, murmelt jetzt ihr Mann, der mir wegen seiner Stimme plötzlich doch bekannt vorkommt. Aus den Nachrichten? Ist er nicht der Typ, gegen den gerade wegen Postenschacher an der Börse ermittelt wird? Ja, doch. Das ist er. Mein Vater hatte, als das bekannt wurde, einen kleinen Wutanfall, weil die beiden für seinen Wahlkampf gespendet hatten. Und wenn mein Vater eines nicht erträgt, dann ist es ungünstiges Licht, in das er gedrängt werden könnte.
Wobei ich mir sicher bin, dass der Großteil der restlichen Gäste mindestens genauso großzügig mit dem Gesetz umgeht. Keine große Sache, solange man nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Das sagt zumindest unser Anwalt, der sogar einen eigenen Zutrittscode für unser Haus hat, weil er so oft vorbeikommt, um meinen Vater zu beraten … oder zu beruhigen.
Mit gesenktem Kopf manövriere ich mich über das polierte Fischgrätparkett, um jeglichen weiteren Gesprächen zu entgehen.
»Papa?« Ich hebe die Hand. Eine Angewohnheit, seit ich eine Etage tiefer bin als alle anderen. Aber er sieht mich. Er sieht mich immer.
»Bernadette! Alles in Ordnung?«
Ich nicke lächelnd, weil ich nicht will, dass er sich Sorgen macht.
»Ich bin … müde. Wäre es okay, wenn ich mir ein Uber rufe und mich schon mal auf den Weg mache?«
»Aber natürlich. Ruf Konrad an. Und …« Er sieht sich suchend um. »Ich schicke Victor mit, falls du warten musst.«
»Schon gut.« Ich verschlucke mich fast, weil ich so schnell antworte. »Er hat bestimmt zu tun. Falls ich in der Lobby warten muss, antworte ich einfach Marcella auf ihre zwanzig Nachrichten.«
Lüge. Lüge. Lüge. Marcella und ich schreiben kaum noch. Weil ich nicht will, dass sie mich fragt, wie’s mir geht. Und sie nicht damit umgehen könnte, wenn ich es ihr doch sagen würde.
»Ich werde noch eine Weile hier sein. Für den Fall, dass du etwas brauchst, sag Bescheid und ruf mich an. Ja? Ich checke mein Handy zwischendurch.«
Wieder nicke ich. Mein Vater streckt die Hand aus, streicht mir über die Wange, und Schmerz flackert in seinen Augen. Mitgefühl. Aber das ist nach diesem Abend genauso unangenehm wie Mitleid, weshalb ich erleichtert bin, dass er bereits in das nächste Gespräch verwickelt wird.
In der Empfangshalle ist es wider Erwarten ruhig. Wahrscheinlich, weil die meisten Gäste um diese Uhrzeit bereits eingecheckt haben oder noch unterwegs sind. Ich schüttle meine Hände aus, die durch das Benutzen der Krücken und des Rollstuhls nach all den Wochen schon kleine Schwielen an der Innenseite bekommen haben. Halbherzig knete ich meine verkrampften Handballen. Ich bin tatsächlich müde. Aber als ein Concierge an mir vorbeigeht, krame ich hastig in meinem Täschchen, um beschäftigt zu wirken und ja nicht angesprochen zu werden.
Mit dem Daumen verharre ich ein paar Minuten über Konrads Nummer, ohne sie zu wählen. Die Aussicht, gleich in der leeren Villa zu sein, macht mir Angst. Ich würde in meinem düsteren Zimmer liegen, an die Decke starren und mir in Selbstgesprächen mitteilen, dass die Schmerzen, die ich spüre, nicht echt sind. Bis ich die Haustür höre. Dann würde ich meine Zähne zusammenbeißen, irgendwann erschöpft aufgeben und eine Schmerztablette nehmen, die mich ausknockt, bis die Sonne aufgeht.
Ich wohne nicht mal mehr in meinem eigenen Zimmer, weil das im zweiten Stock und deshalb gerade unerreichbar ist. Mein Vater hat sein ehemaliges Büro verlegen lassen. Es ist der einzige Privatraum im Erdgeschoss, der durch die Flügeltür barrierefrei betretbar ist und ein angrenzendes Bad hat. Weshalb ich jetzt in einem Zimmer wohne, dessen Wände mit dunklem Holz vertäfelt sind, das schon seit ich denken kann und mit Sicherheit auch noch die nächsten zig Jahre nach Zigarren stinkt. Nein, ich will nicht nach Hause. Und weil Konrad mich nirgends anders hinbringen würde, nehme ich stattdessen eines der Taxis, die vor dem Hoteleingang parken.
Der vorderste Fahrer steigt Gott sei Dank sofort aus, hilft mir in den Wagen und lässt sich erklären, wie er den Rollstuhl zusammenfalten kann, sodass er im Kofferraum Platz hat.
Ich beobachte durch das Beifahrerfenster noch einen Moment das hell erleuchtete Hotel. Eine Gestalt steht direkt an einem der bodentiefen Fenster relativ weit oben. Ich stelle mir vor, dass es Vic ist, und streiche mir mit dem Mittelfinger eine Haarsträhne hinters Ohr, die sich bereits aus meiner hochgesteckten Flechtfrisur gelöst hat. Mit Sicherheit ist er es nicht. Und selbst wenn, könnte er mich nicht sehen. Aber das ist mir egal. Der Typ kann mich mal. Genauso wie die Frau im Bleistiftrock. Und ganz ehrlich? Heute hasse ich sogar meinen Vater. Dafür, dass ich mich den ganzen Abend lang präsentieren musste, obwohl ich zu Hause schon dreimal überlege, ob ich wirklich Hunger habe, bevor ich mich auf den Weg zur Küche mache, wo Kristin, unsere Haushälterin, mich nicht mehr bloß »Kindchen«, sondern mittlerweile »armes Kindchen« nennt.
Der Fahrer steigt ein und drückt auf den Knopf des Taxameters. »Wohin?«
Weit weg, denke ich. »In den siebten Bezirk«, sage ich stattdessen. Warum, weiß ich auch nicht so genau.
»Adresse?«
»Club Danube.«
Ich habe keine Karte mehr. Das Konzert hat auch schon längst begonnen. Sollte mich dennoch jemand reinlassen, könnte ich außerdem nur dann etwas sehen, wenn ich mich bis zur Bühne vordränge. An allen vorbei. Sodass mich jeder bemerkt. Ich versuche, ein Schaudern zu unterdrücken.
»Sehr gerne.« Der Wagen setzt sich in Bewegung, und ich habe jetzt wohl exakt die Strecke bis zum Club Zeit, um mir zu überlegen, was ich dort tun will. Es ist März. Auf den Gehsteigen liegt überall Streusalz und teilweise sogar noch Schnee, der von den Abgasen jedoch bereits schwarz verfärbt ist. Das wird eine Tortur mit dem Rollstuhl.
»Skiunfall?«
»Hm?« Ich hebe den Kopf, und obwohl der Fahrer sich auf den Verkehr konzentriert, wirft er mir einen kurzen Blick inklusive verständnisvollem Lippengekräusel zu.
»Hatte ich auch. Dezember 2017. Ein Tag vor Weihnachten. Richtige Scheiße, weil ich einen Liegegips bekommen hab. Der juckt nach einer Woche, das können Sie sich ni… können Sie sich wahrscheinlich vorstellen.« Wieder wirft er mir einen kurzen Blick zu, und ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich nicke. »Hab zwei Stricknadeln verloren, weil ich mit denen versucht hab, reinzustochern, um zu kratzen. Der Krankenpfleger hat Augen gemacht, als er mir das Ding aufgeschnitten hat und die Teile klimpernd rausgefallen sind.« Er lacht auf, und ich grinse etwas irritiert.
»Skier oder Snowboard?«
»Snowboard«, sage ich. Einfach so. Weil mir die Vorstellung gefällt, dass ich mein Bein einfach eine Weile stillhalten muss, damit es wieder ganz wird.
»Na Gott sei Dank muss man mittlerweile fast überall mit Helm fahren. Mich würde es sonst nicht mehr geben.«
»Ja«, sage ich nur.
»Da haben wir wohl Glück gehabt.« Er lenkt in eine Parklücke hinter einem Lieferwagen für Tiefkühlgemüse, auf dem eine tanzende Zucchini abgebildet ist.
»Ein Riesenglück«, stimme ich ihm halbherzig zu und greife nach der viel zu kleinen Umhängetasche, in die lediglich mein Handy, Schmerztabletten, ein Lippenstift und eine Kreditkarte passen. Weil ich nicht will, dass man diese Fahrt auf meiner Abrechnung sieht, ziehe ich die Hülle vom Handy und nehme den Notfall-Fünfziger heraus. Nachdem ich bezahlt habe, lasse ich mir wieder zurück in den Rollstuhl und auf den Gehsteig helfen.
»Soll ich Sie noch wohin bringen? In welches Haus müssen Sie?« Der Fahrer geht gar nicht davon aus, dass ich vielleicht in den Club und nicht bloß in diese Straße wollte.
»Alles gut, ich komme zurecht. Danke.«
»Wie Sie wünschen.« Er führt die Finger an die Stirn, als würde er sich an die Krempe einer imaginären Kappe greifen, und neigt den Kopf.
Ich bleibe am Gehsteig zurück, und als das Taxi weg ist, habe ich freie Sicht auf den unscheinbaren Eingang des Clubs direkt gegenüber. Ich weiß, dass sich hinter der schweren Metalltür eine alte Halle befindet. Mit gewölbter Decke, Säulen und einem mobilen Foodtruck. Ich erinnere mich an die bunten Scheinwerfer und die Muster, die sie an die Wände projizieren, an denen bereits der Putz bröckelt, was die Location zu einer Mischung aus Ballsaal und leer stehender Fabrik macht.
Wehmut breitet sich in mir aus, wenn ich an all die vergangenen Wochenenden in meinem Kalender denke und mir vorstelle, wie ich lachend mit meinen Freunden exakt hier entlanggekommen bin. Es ist beängstigend, wie schnell sich Dinge ändern können.
Plötzlich öffnet sich einer der Türflügel. Ein paar Leute stolpern nach draußen, um zu rauchen, und ich kann ganz kurz die Musik hören, die mit ihnen aus dem Inneren des Gebäudes dringt. Es ist zu flüchtig, um zu erkennen, welcher Song gerade spielt. Aber noch länger kann ich nicht hierbleiben, weil ich sonst trotz meiner Stola erfrieren werde. Blöderweise habe ich meinen Mantel im Hotel gelassen, und die Gänsehaut an meinen Armen macht mir das gerade schmerzlich bewusst. Es war eine dumme Idee, nicht nach Hause zu fahren. Es war eine beschissene Idee und … Nein! Ein roter Lockenkopf taucht zwischen den Grüppchen auf, die sich vor dem Club versammelt haben. Marcella!
Ich drehe hastig an den Reifen. Es ist anstrengender, als ich dachte, den Rollstuhl über den Kies zu lenken, um hinter dem Zucchini-Laster zu verschwinden. Aber ich will auf keinen Fall, dass sie mich hier sieht. Das wäre erbärmlich. Ich bin erbärmlich. Scheiße!
Als ich hochblicke, streckt mir eine Aubergine in Lederhose auf dem Lieferwagen die Zunge raus, und ich schließe für einen Moment die Augen. Lasse den Kopf in den Nacken fallen und frage mich, womit ich das alles verdient habe.
Meine Gänsehaut prickelt. Stimmen nähern sich. Und ich rolle weiter. Neben mir ist ein breiter Eingang zu einer Bar, die mir noch nie zuvor aufgefallen ist. Ich überlege nicht lange und fahre hinein.
Sie ist klein und stickig, aber der Barkeeper sieht sofort auf und fängt meinen Blick ein. Er steht hinter dem dunklen Tresen und hebt einen Zeigefinger. In Windeseile zapft er das Bier fertig, stellt es auf das Tablett einer Kellnerin und wischt sich die Hände an der Jeans ab, bevor er durch einen offenen Bereich an der Seite hinter der Bar hervor- und auf mich zukommt.
»Hi, bist du mit jemandem verabredet?«
Ich runzele die Stirn. »Nein?«
»Cool. Wo willst du sitzen? Dann mache ich den Weg frei.«
Es ist rappelvoll. Alle Tische sind besetzt, aber niemand der Gäste ist in meinem Alter. Hauptsächlich Menschen um die dreißig und aufwärts. Keiner, den ich kenne. Und weil es so schummrig und die Musik aus der Jukebox fast schon zu laut ist, fühle ich mich angenehm unsichtbar, was mich sofort etwas beruhigt. Erst jetzt merke ich, wie sehr ich bis gerade eben nach Atem gerungen habe und wie wild mein Herz unter dem viel zu engen Korsett des Kleides immer noch wummert.
»An der Bar?« Um ehrlich zu sein, sind die Hocker dort die einzig freien Plätze, die ich erkennen kann.
»Klar. Gute Wahl. Das ist der Platz, an dem du mit Sicherheit am schnellsten bekommst, was du möchtest«, fügt er dann noch mit einem Augenzwinkern hinzu.
Ich grinse ihn an und danke dem Universum, dass ich ausgerechnet hier gelandet bin. Er ist nett. Und er hat mich in diesem Gespräch noch kein einziges Mal in Verlegenheit gebracht, obwohl ich mir sicher bin, dass er nicht jeden Gast von der Türschwelle abholt.
Ich rolle an einen freien Hocker heran, stelle die Bremsen ein und ziehe mich am Tresen hoch. So elegant ich kann, lasse ich mich auf die Sitzfläche gleiten und richte den mauvefarbenen Rock meines Kleides, der aus mehreren Lagen besteht und wallend über den Rand des Hockers quillt.
»Was dagegen, wenn ich den so lange an die Garderobe stelle, damit die Kellner durchkommen?« Der Barkeeper zeigt auf meinen Rollstuhl.
»Oh, sorry! Nein, gar nicht …« Ich will andeuten, wo der Hebel ist, aber da hat er ihn bereits ohne Erklärung mit einem Griff zusammengeklappt und sieht mich triumphierend an. »Kein Ding. Sobald du was brauchst, gib mir ein Zeichen. Ich bin … wahrscheinlich hinter der Bar.«
Wir lachen beide, und ich lehne mich nach vorne, um mir eine Getränkekarte zu schnappen. Sie steckt so fest in der Halterung, dass ich den kleinen Holzklotz mit anhebe und an der Karte herumruckeln muss, um sie rauszubekommen. Der untere Teil ist total verklebt, sodass ich trotz der lauten Musik das schmatzende Knistern bei jedem Umblättern hören kann.
»Weißt du’s schon?« Mein Retter des Abends taucht wieder hinter dem Tresen auf. Seine braunen Haare in einem Dutt auf dem Hinterkopf sehen meiner Frisur ziemlich ähnlich. Als er nach einem Lappen greift, fängt sich der Schein der Teelichter, die hier überall in kleinen Gläsern stehen, in dem goldenen Septum an seiner Nase. Ich kräusele meine eigene, weil ich mit mir hadere. Eigentlich sollte ich keinen Alkohol trinken. Weil ich selbst ohne Tabletten täglich hohe Dosen Schmerzmittel in mir habe. Durch die Pflaster. Allerdings ist dieser ganze Abend hier ein Geheimnis und existiert gar nicht wirklich. Mein Vater wird noch eine Weile beschäftigt sein. Solange ich mich also nicht betrinke und mir rechtzeitig ein Uber rufe, wird niemand davon erfahren. Außerdem brauche ich das hier. Mich einfach mal für ein paar Minuten nicht wie Bernadette Marie Anker oder das »arme Kindchen« fühlen zu müssen. Sondern wie das Ich von vor einem Jahr, das zu einem leeren Datum im Kalender blättert und davon träumt, dass sich irgendetwas richtig anfühlt.
Aber ich traue mich nicht.
»Eistee«, beschließe ich deshalb, als gleichzeitig jemand seine Unterarme neben mir auf das verkerbte Holz des Tresens schiebt und etwas atemlos sagt: »Für mich auch, bitte.«
»Pfirsich oder Zitrone?«, fragt der Barkeeper, und noch bevor ich zur Seite blinzeln kann, antworten wir gleichzeitig: »Zitrone.«
Kapitel 4
Nave
I am not who you think I am.
Menschen mögen es, wenn man sie anlügt. Weil es ihnen lieber ist, ignorant sein zu dürfen, als sich mit einer unangenehmen Wahrheit auseinandersetzen zu müssen.
Niemand hier in diesem Club würde mich auf der Bühne haben wollen, wenn sie wüssten, wer ich bin. Oder, dass ich bereits dreimal im Knast war. Die Gründe sind egal. Die Tatsache zählt. Und für die Mädelsgruppe an dem Stehtisch ganz vorne bin ich der mysteriöse Typ, dessen Songs perfekt zu vier Gin Tonics passen. Ich lasse ihnen die Illusion.
hundreds of people,
thousands of eyes
they never really see me
I’m the problem in disguise
Meine Lippen berühren ein letztes Mal das Mikro. »Danke für diesen Abend«, sage ich, die Stimme schon leicht rau.
Die Leute jubeln.
Ich hebe zögerlich einen Mundwinkel, blinzle gegen die Scheinwerfer an.
Dann schlüpfe ich aus dem Gurt der Gitarre und verschwinde in den Backstagebereich.
Ich bin nicht berühmt. Bloß jemand, der ab und an die Chance hat, in irgendwelchen gewöhnlichen Bars und auf winzigen Bühnen ein paar Songs zu spielen. Der Backstagebereich ist deshalb derselbe Raum, in dem die Mitarbeiter auch ihre Raucherpausen machen. Nebelschwaden hängen unter den Halogenlampen, und meine Augen brennen, als ich nach dem abgewetzten Gitarrenkoffer greife, um meine akustische Fender darin zu verstauen.
»Nicht schlecht, Mann.«
Ich nicke Jakob zu, dem Sänger von Bathtub Drowning, der am Boden neben einer der Steckdosen hockt und sein Handy lädt. »Nur eine Frage der Zeit, bis man dich überall kennt.«
Automatisch zieht sich dieser nur allzu bekannte Zwiespalt wie ein Blitz durch meinen Kopf, meine Brust, mein Herz und zerreißt mich lautlos. Weil ich das auch will. Mehr als alles andere. Wenn meine Finger Saiten berühren oder sich um den Griff eines Mikrofons schließen, denke ich nicht mehr an Briefe, die nicht ankommen, Sachbearbeiter, die den Teufel an die Wand malen, und Bilder, die mir den Schlaf rauben. Aber ich weiß genauso gut, dass das hier – diese kurzen Auftritte – alles ist, was ich von meinen Träumen erreichen kann. Mehr ist nicht drin.
Vielleicht in einem anderen Leben.
Ich lache leise auf. »Mal sehen«, antworte ich, reibe mir mit den Händen übers Gesicht und spüre dabei meinen Ring über die Haut gleiten. Es ist ein Wunder, dass ich ihn nie verloren habe. Es ist allerdings auch ein Wunder, dass ich ihn nie wütend in irgendeinen Abgrund geworfen habe.
»Nimm dir eins.« Jakob reckt das Kinn in Richtung eines schmalen Kühlschranks. Durch die gläserne Scheibe schimmert das Grün voller Bierflaschen.
Ich schüttle den Kopf. »Nächstes Mal vielleicht.«
»Ich bin mir sicher, dass es ein nächstes Mal geben wird.« Grinsend rappelt er sich auf und klopft sich den Staub von der Hose.
Die anderen Bandmitglieder kommen aufgedreht durcheinander rufend in den Raum und begrüßen mich ebenfalls.
»Echt krass, Nave.« Der Bassist hält mir seine Hand hin, und wir schlagen kurz ein.
»Danke und viel Spaß noch, Leute.«
»Du bleibst nicht?«, fragt der Drummer, aus dessen T-Shirt-Ärmeln sich zahlreiche Tattoos über seine Arme und den Nacken ergießen.