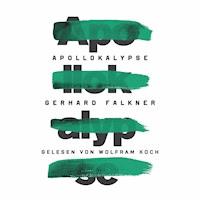10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Georg Autenrieth ist eine zwielichtige Gestalt in zwiegesichtigen Zeiten, immer wieder taucht er auf in Berlin, der Mann aus Westdeutschland, hält Kontakt mit der Szene, durchsucht die Stadt und konfrontiert Laster, Lebensgier und Liebeskunst. Wohin aber verschwindet er dann? Wer ist der »Glasmann«? Und welche Rolle spielen seine Verbindungen zur RAF? Gerhard Falkners »Apollokalypse« ist ein Epochenroman über die 80er und 90er Jahre. Dem Vergeuden von Jugend, der Ausschweifung jeglicher Couleur und der Hypermobilität stellt er einen rauschhaften Rückverzauberungsversuch der Welt entgegen. Bulgakows Meister und Margarita begegnet dem Ferdydurke von Gombrowicz und Oskar Matzerath schrammt an Tyron Slothrop, Bruno Schulz und Wilhelm Meister. Die Hauptrolle spielt die Stadt Berlin selbst, haufenweise gehen Künstlerexistenzen an ihrer magischen Gestalt in die Brüche. Und wenn die RAF sich über den BND mit der Stasi berührt, gerät die Zeitgeschichte unter das Messer der Psychiatrie. Am Schluss nimmt der Teufel leibhaftig das Heft in die Hand. Ein mythologischer Roman von unvergleichlicher Sprachmächtigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
ISBN 978-3-8270-7894-0© 2016 Gerhard FalknerBerlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2016Alle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenDatenkonvertrierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Vorfeld
Nach der Schlacht
Erinnerung eines Mannes ohne Erinnerung
Falscher Bericht
Selbsterhaltung
Das Buch Isabel
Die Passauer Wucht
Die Sprache der Ölsardinen
Die Hühnerficker
Das Fest bei den Pruys
Block Ost
BMD R 60/5
Schwarze Magie
Die kleine Kapitulation
California Sunshine oder der heilige Hain
Die Champagner-Arie
Stadtplan
Die Makarow
Berlin-Mitte
Die Protokolle des Prometheus
COLA
Das Doppelbett / Matrimonio
Betty Lerner
Das Einzimmerapartment in der Unterwelt
Über Wahrheit und Lüge als Restposten zu Trostpreisen
Der Tanz ums Brandenburger Tor
In den Alpen sind letzte Nacht mehrere Fälle von Zugspitzen bekannt geworden
Was geht, Alter?
Tanzen im Dschungel und Singen an der Spree
Der Wiederhergestellte oder Trash für die Crowd
Mit den zerbrechlichen Flügeln der Angst gegen den Hoffnungsschimmer des heranrasenden Engels
Der Glasmann
Corriger la fortune!
Der Steglitzer Kreisel
Vor den Toren von Woolworth
Das Buch Billy
Il dissoluto punito
Der Brief
Too hot to burn
Der Griebenow
Noch mal Griebenow
Akteneinsicht
Die Ermunterung des Blütenhonigs
Immergrüne Sommerfrischen
Der große Regen
Barfuß durch die Unterwäsche
Böhringer
Die Idiototen
Gott natürlich wieder
Ausflüge in den Wind
Der Engländer
Die Klandestinität der Zuckerpuppe
Der Macker
… an maybe I love you
Billys Metamorphosen
New York, New York, die Meile der sieben Todsünden
Die Sanduhr
Zwerge und Riesen
Walter Kirchner Neue Filmkunst zeigt: Metamorphosen
Am Urinal der Toten
Das Mittelschnauzerabkommen
Die Fischnester
Der Alibijude
Die zersungenen Schwänze
Einseitig perforierter Film
Schwimmer und Gebüsch
Auf der Sprache nach der gefangenen Welt
Der Spiegel
Vorgang Andromeda
Testiculos habet et bene pendentes
Der Spickel
Das Attentat
Tout a pris fin à tout jamais! – Alles war aus und für immer!
Es wird behauptet
Die Rekonstruktion der Gegenwart
Ignoramus et ignorabimus. Wir wissen es nicht, und wir werden es niemals wissen.
Nachtleben
Die Bräuninger-Episode
Prolog zum Vorstoß auf Mitte
Vorstoß nach Mitte
Die perfekte Herzenskälte
Die Akte
Mord
Und wo uns Schuld in ihre Qual verstrickt, gab mir ein Hundsfott die Idee: bestreite!
Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen!
Das Ende vom Lied
Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, wir sind traurig, weil wir weinen!
Der 254. Tag des Gregorianischen Kalenders, und trotzdem Pearl Harbor
Nachspann
Dank
Wahnsinn Tod und Zerstörung sind die Kräfte,die uns begleiten, und je geschickter sie sichverhüllen, umso rasender verrichten sie ihr Werk.
Im Seyn erzittert das GötternMartin Heidegger
Vorfeld
Wenn man verliebt ist und gut gefickt hat, verdoppelt die Welt ihre Anstrengung, in Erscheinung zu treten.
Das ist unglaublich aufregend, weil es die Bildung von Seele anregt, ohne dass der Verstand sich daran stößt, ihren Ort nicht bestimmen zu können.
Die Selbstverständlichkeit, hinter deren Schleier das Leben so gerne Schutz sucht, lichtet sich mit einem Male, und wir spüren, wie wir stärker, mutiger und geschickter den Dingen entgegentreten.
Die Körper werden klarer, die Sonnen lodern heller, die Städte gehen tiefer, die Augen strahlen, die Ohren klingen und es gelingt uns, wie Perikles fordert, das Schreckliche wie das Süße in voller Klarheit zu erfassen.
So, das war ein klassischer Anfang.
Für diese Geschichte müssen wir allerdings von der allgemeinen Auffassung abrücken, dass wir, wenn unser Leben in keiner vernünftigen Mitte sich abspielt, entweder glücklich sind oder verloren.
Nein. Wir sind in der Lage, beides so lange gleichzeitig zu sein, wie wir die Kraft haben, diesen gegensätzlichen Szenarios standzuhalten und aus der Spannung zwischen beiden eine aufregende Welt zu entwerfen.
Mit uns beiden war das jedenfalls so.
Wir waren so lange glücklich und verloren, bis irgendein unsympathisches Schicksal in irgendeiner Stunde X uns schließlich den Hahn abdrehte.
Nach der Schlacht
Es könnte Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre einen Mann gegeben haben, der auf der Oranienstraße, zwischen Moritzplatz und Mariannenstraße, einem Frühlingstag ins Auge geblickt hat, an den er sich später nicht mehr erinnert. Es mag ein schwach von der Braunkohle gesüßter Frühlingstag gewesen sein, April oder Anfang Mai, wie er für SO 36, wo es noch unzählige Wohnungen mit Kaminfeuerung gab, typisch war. Vielleicht kam die Süße der Braunkohle auch aus dem Osten, der jenseits der Mauer darauf wartete, vom Westen verheizt zu werden. Nirgends war der Osten so nah wie in Kreuzberg. Das Frühlingslicht schien den lebhaft aufglühenden Fassaden einmassiert wie Sonnenöl den Rücken badender Frauen am Wannsee. Die Naunynstraße stand noch ganz in ihrer unrenovierten Strenge und Riehmers Hofgarten zeigte gelassen die abgetakelten Züge würdiger Verwitterung. Darüber hinaus brachten entweder die Türken Farbe rein mit ihren Obstkisten-Barrikaden vor den Geschäften oder die Autonomen mit auf Bettlaken gesprühten und aus den Fenstern gehängten Kampfparolen oder Hausbesetzersprüchen.
Ich lebe nun schon, solange ich denken kann, und es ist auch eine Menge in meinem Gedächtnis haften geblieben, aber an diesen besagten Tag konnte ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Vielleicht, weil er den vielen anderen so ähnlich war, die sich, wenn man es denn genau nähme, alle nicht wirklich glichen. Aber in dieser Geschichte wird meinem Gedächtnis ja auf die Sprünge geholfen. Der Mann, von dem ich wahrheitsgemäß behauptet habe, nicht zu wissen, dass ich es selbst gewesen sein könnte, wird mit dem Orientexpress, wie die Linie 1 der Türken wegen genannt wurde, vom Nollendorfplatz gekommen und am Kottbusser Tor ausgestiegen sein. Durch das heillose Fiasko von Hunden, Punks, Türken, Trödlern, Freaks, Junkies und Müslis wird er hinübergegangen sein in die Oranienstraße, um dort, vielleicht in der O-Bar, in der ich in jenen Jahren tatsächlich verkehrte, einen Drink zu nehmen. Diese Bar war damals einer der ersten Orte im Land, der wirklich cool war. Und cool hieß: schwarz, stolz, stumm und grundlos selbstverliebt.
Kreuzberg kochte in diesen Tagen ein Süppchen, von dem sich heute weder der Kessel noch auch nur Spuren des Gebräus wiederfinden. Es war ein schwarzes Loch, über dem die bunteste aller möglichen Sonnen explodierte und in dem die Nacht sich durch die Straßen bewegte wie eine Künstlerin oder eine Kakerlake. Kreuzberg war Westberlins kritische Zustandsgröße, der Übergang von der festen in die, wie wir damals sagten, zweitfeste Wirklichkeit. Welche der allgemeinen geistigen Verfassung die zuträglichere war, darüber wurde gestritten. Warum jeder Dritte, den ich kannte – dies nur nebenbei bemerkt –, in der Wrangelstraße wohnte, so wie später, nach der Wende, jeder Dritte in der Dunckerstraße, ist mir schleierhaft.
Hätte er, oder ich in diesem Falle, sich erinnert, so, wie Henriette sich erinnert haben muss, würde er wissen, dass dieser Tag begann wie eine gewisse Erzählung Dostojewskis. Man erwartete zum Mittagessen wichtige Leute, auch wenn die Aufmachung dieser Leute von der gewöhnlichen Aufmachung wichtiger Leute, und erst recht von der Aufmachung wichtiger Leute heute, ziemlich abwich.
Das Treffen fand in der Wrangelstraße statt. Mit dem Rücken gegen das offene Fenster im vierten Stock gelehnt hätte ich, oder er, der nun ich gewesen sein soll, auf der gegenüberliegenden Hauswand die von einer Kalaschnikow durchbohrten Initialen RAF lesen können, während der Trupp wichtiger Leute, einschließlich Henriette, nachdem man schließlich vollzählig war, über einen durch einen Schrank verdeckten Mauerdurchbruch in die angrenzende Wohnung verschwand. Das Mittagessen wurde mit größter Wahrscheinlichkeit aus dem Papier eingenommen.
Trotz aller Stilbrüche hatte die Operation etwas Bestechendes. Vielleicht hatte ich das Ganze absichtlich vergessen, weil es mich gekränkt hatte, von diesen Desperados wie Luft behandelt zu werden. Man muss es mir angesehen haben, dass ich von einem anderen Stern kam.
Nach einer halben Ewigkeit war es dann endlich Nachmittag. Zwecklos, sich heute auf die genaue Uhrzeit besinnen zu wollen. Irgendwann um die Zeit, als er zu träumen begann, und zwar nicht wie die Mädchen, sondern wie die Tiere. Die Männer und Gudrun, neben Henriette die einzige Frau, waren durch das Wandloch zurückgekehrt, schoben den Schrank wieder davor, und weg waren sie. Ihre Stimmen hallten noch eine Weile durchs Treppenhaus. Dann erstarben sie, und nach dem Zufallen der Haustür schien die Straße plötzlich stummgeschaltet. Nach einer weiteren halben Ewigkeit trat Henriette mit einem schweren, blauen Handtuch umwickelt aus ihrem badewannenlosen Bad ohne Dusche.
Augenblicklich stellte ich mir vor, es sei Winter. Die milde Luft, die durch das Fenster hereinströmte, vermochte das nicht zu verhindern. Henriette wirkte auf mich mit dem polaren Weiß ihrer Haut wie die Abgeordnete einer eisigen Region, die mir die in blaue Baumwolle gewickelte Frühlingsbotschaft zu überbringen gedachte. Mein limbisches System nahm eine kleine körpereigene Dusche. Obwohl man damals immer in dem Gefühl lebte, mit allem rechnen zu müssen, erinnerte nichts in diesem Augenblick an die Möglichkeit, der Kommunismus könnte die Segel streichen oder das Leben könnte damit aufhören, einen verrückten Tag nach dem anderen zu spendieren.
Es war noch das Kreuzberg der auf dem Boden liegenden Matratzen, der gardinenlosen Fenster, selbstgebastelten Bücherregale und Chai Tees. Auch Momente des Glücks nahmen hier notfalls behelfsmäßig ihren Lauf. In eine dieser auf dem Boden liegenden Matratzen trieb nun, nachdem das blaue Handtuch kurzerhand zum offenen Fenster hinausgesegelt war, Henriette ihre schrillen, spitzen Seufzer wie Polsternägel, und die Kohlmeisen, die draußen monoton nach ihren Partnern bimmelten, stimmten ein. Wäre Henriette, die sich nie Rieke nennen lassen wollte und die auch nicht vorhatte, früh zu sterben, damals nicht mit jenem Mann zusammen gewesen, der vielleicht für beides verantwortlich war und der mit seinem runden, gedrungenen Kopf und seinem kleinen, wagemutigen Körper Alleinanspruch auf sie erhob, wäre ich, oder der, für den ich mich inzwischen wohl halten muss, wahrscheinlich gleich über Nacht bei ihr geblieben. So aber wurde jener kleine, wagemutige Körper, der nicht nur eine Strickmaske, sondern auch eine Waffe besaß und den besagte Abordnung um 18 Uhr in einer Kaschemme hinter dem Mariannenplatz treffen wollte, in Kürze erwartet, und ich hatte das Feld zu räumen.
Ich sollte ab Mitternacht in der Roten Harfe nach einem Lutzi fragen, der den Schlüssel zu einer Wohnung dabeihaben würde, in der ich übernachten konnte. Jene Nacht, jedenfalls knapp zwei Stunden davon, verbrachte ich, wie ich heute weiß, in der Eisenbahnstraße.
Ein ebenfalls kleiner Mann mit fanatischen Augen und einem Gipsfuß gab mir den Schlüssel, als ich kurz vor zwei in diesem überwiegend aus Zigarettenrauch bestehenden Laden eintraf. Teufel noch eins, dachte ich, hier mischen sich aber die Sphären. Alle Gesichter waren vom Qualm wie in Watte gepackt und viele Stühle und Stimmen waren umgeworfen vor lauter Lärm. Die Wohnung lag wie gewöhnlich im vierten Stock rechts. Egal, wo ich damals hinmusste, immer lagen die Wohnungen im vierten Stock rechts. Im Treppenhaus reichte der trübe Schimmer der Nacht, um das Schlüsselloch zu finden. In der Wohnung selbst aber gab es nicht einmal eine Ahnung von Licht. Sie musste durch Gummivorhänge oder dergleichen verdunkelt sein. Die Augen schienen wie zugenäht von der Schwärze. Egal, wie lange mein Arm mit wehenden Bewegungen die Wand abtastete, kein Schalter gab sein Versteck preis. Kein Laut, kein Licht, kein Drink, kein Blick, keine Unterlage – nichts.
Wie der blinde Seher, die Arme so vorgestreckt, dass die Finger auf Gott deuteten, durchwatete ich die Schwärze, bis mein Fuß gegen den federnden Widerstand einer Kreuzberger Bodenmatratze stieß, auf die ich hinabglitt. Die Art, wie diese Wohnung den Augen einfach keine Hoffnung versprach – und nicht einmal, wie noch die dunkelsten Kinos der Welt, nach einer Weile wenigstens Konturen preisgab –, ließ mich eine Weile steif und mit gerecktem Hals dasitzen, bis mir klar wurde, dass diese Finsternis durch keine lauernde Haltung je zu bezwingen war. Mein ganzer Körper wölbte sich wie ein Parabolspiegel, um entlang eines doch wohl ganz sicher irgendwo angehaltenen Atems endlich den Horizont eines heimlichen Luftschöpfens aufzufangen. Keine Chance. Dennoch schien es mir mit der Zeit, während ich dalag und kaum atmete, immer wahrscheinlicher, dass diese Wohnung in ihrer undurchdringlichen Finsternis mit einer weiblichen Person ausgerüstet war, einer Person, irgendwo zwischen Angst, Schlaf oder Betäubung. Entweder nur durch eine angelehnte Tür getrennt oder sogar direkt in diesem Raum, auf einer am anderen Ende liegenden Matratze. Eine Frau, die vielleicht nicht nackt dalag, nicht lustvoll geblendet von der Dunkelheit und begierig, von mir entdeckt zu werden, wie mir ein aberwitziger Gedanke weismachen wollte, je dichter sich mein Registrationsschirm mit Partikeln ihrer Existenz beschlug, sondern die in dieser Dunkelheit einfach untergebracht war. Versteckt. Vergraben. Eingemauert. Vielleicht auch gekocht oder zerstückelt. Was konnte ich schon wissen.
Das Spüren wurde so stark, dass meine Ohren dünn und hart wurden wie Glas, die das kleinste Hämmerchen eines Lauts hätte zerspringen lassen. Meine Finger spreizten sich im Gegenzug so nervös, als müssten sie totes Fleisch berühren, und sogar die Zähne, vom Schutz der Lippen durch die Anspannung teilweise entblößt und mit einem zweifelnden und zögernden Abstand zwischen ihren Reihen, schienen wie Spezialsonden dieses vermeintliche Gegenüber orten zu wollen. Lag hier vielleicht Henriette, gefesselt und betäubt von dem Kerl mit dem kleinen, wagemutigen Körper? Hatte nicht am Nachmittag eine jener wichtigen Personen bei der Rückkehr aus dem Wandloch gesagt: »Die Dinger liegen in der Eisenbahnstraße«? In dem Drange, irgendetwas zu unternehmen, was mir, wäre ich eingeschlafen, nicht im Traum eingefallen wäre, verließ ich die Wohnung wieder. Ich hatte so lange Schäfchen gezählt, bis ich Herzrasen bekam.
Der Tag war noch nicht angebrochen, als ich die Wrangelstraße erreichte und an der St.-Thomas-Kirche, die mich mit einem einzigen, ungeduldigen und frigiden Glockenschlag erschreckte, Richtung Spree abbog. Viertel nach vier.
Neben mir lief die Mauer. Neben der Mauer lief ich. Wir liefen quasi nebeneinanderher. Einer stummer als der andere. Sie schwieg aus politischem Trotz, ich aus innerer Anspannung. Der Sternenhimmel hatte sich um kaum zwei Stunden gedreht, seit ich das schwarze Loch verlassen hatte. Er hing schlapp über der Weite des Schienengeländes zwischen Warschauer Brücke und dem Hauptbahnhof der ehemaligen Reichsbahn. Über der Mauer stapelte sich wie Industrieschrott ein rostroter Nachthimmel, dahinter der gähnende Osten. Wie Perlenvorhänge wehten die zarten, pendelnden Triebe der Trauerweiden, als ich auf die Oberbaumbrücke zulief, die wie eine zerfallene Ritterburg aus dem Dunkel starrte. Die Turmhauben waren zerbrochen. Sie glichen den Zahnstümpfen zechender Bauern, wenn das Kerzenlicht der flämischen Meister sie beleuchtet. Vor der Brücke stand eine schwarze, hölzerne Tribüne, von der tagsüber ein Blick ins Reich des Bösen geworfen werden konnte. Oder auf seine ostdeutsche Vorhut. Sie stand da wie das hölzerne Gerüst vor Troja, welches die Griechen das Pferd nannten.
Ich widerstand der Anfechtung nicht, die eine leere Leiter in einsamer Nacht auf mich ausübt. Tribüne, Kanzel, Katheder – was für großartige Erfindungen. In der Mitte der Spree kreuzten Spanische Reiter ihre schwarzen Balken, und drüben auf der Eastside dröhnten die düsteren Speicher wie kolossale Bässe. Wo sich die Spree Richtung Osthafen breiter machte, erglänzten auf dem Wasser die ersten Perlmuttschimmer der Dämmerung. Mit einem würdigen »Salve!« grüßte ich die tuckernden Blässhühner und die Möwen, die wohl ebenfalls den Tagesanbruch schon im Visier hatten.
Schließlich kehrte ich um und folgte dem eleganten Schwung der Mauer entlang des Bethaniendamms. Als ich unten am Moritzplatz ankam, spendierte die Sonne bereits ihre ersten Strahlen. Kreuzberg fing an zu krachen. Ladengitter, die Heckverschläge von Lieferwagen, knallende Türen, Paletten, platzende Geräusche, grausam kopfüber gegen das Heck von Müllautos geschmetterte Abfalltonnen, Türkenmusik.
In einem Dönerimbiss trinke ich türkischen Tee. Das Glas ist klein und heiß, mit einer schmalen Hüfte für die Finger. Um zehn Uhr wird der kleine Mann mit dem wagemutigen Körper aus dem Haus sein. Henriette hat mir das versichert. Es gäbe ein Treffen im Uni-Center mit Leuten aus Libyen, sagte sie. Oder Jordanien? Hat sie das gesagt oder hat sie gesagt, dass er das gesagt hätte? Wer immer es gesagt hat, es musste gesagt worden sein. Egal von wem und zu wem.
Eine zur Sicherheit eingehaltene halbe Stunde später würde sie mir ihre aufwühlende Zunge in den Mund stecken, nachdem sie endlich mit einem weiß-der-Teufel-wie-farbenen Handtuch um ihr weißes Winterfleisch aus ihrem badewannenlosen Bad ohne Dusche getreten sein würde. Sie würde ihn, quasi noch bettwarm, mit mir betrügen, ihren kleinen, strammen Stadtguerillero. Beide würden wir versuchen, in diesem süßen struggle for life, jeder aus dem anderen so viel herauszukitzeln, als er unter Schreien und Flüstern bereit war (ohne Gefährdung der Lust, aber nicht ganz ohne Gefahr für die eigene Person), sich entlocken zu lassen. Wer wusste damals schon so genau, für wen er eigentlich arbeitet?
Während ich Tee trinke und an sie denke, schwillt mein Schwanz.
Im Tagebuch des Verführers, in dem ich am Nachmittag des Vortags immer wieder gelesen hatte, um mir die Zeit in der Wrangelstraße zu vertreiben, lässt Kierkegaard seinen Helden sagen: »Meine Cordelia, Du weißt, ich frage gern viel; man macht mir geradezu einen Vorwurf daraus. Das kommt daher, dass man nicht versteht, wonach ich frage; denn Du und Du allein verstehst, wonach ich frage … und Du und Du allein verstehst, eine gute Antwort zu geben.«
Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wäre aber auch egal, wenn du das nicht verstehst, dachte ich etwas zynisch. Dann machte ich mich auf den Weg.
Ich wollte eine gute Antwort. Die eine, die es herauszufinden galt, die andere, die ich wahrscheinlich zu hören kriegen würde, und jene dritte, für die ich sie stöhnen sehen wollte.
»So wie du aussiehst, arbeitest du bestimmt für den BND«, hatte sie das letzte Mal gesagt.
»Wie sehe ich denn aus?«
Ich schaue hin. Ich sehe uns auf der Matratze knien, das Andocken zweier Köpfe, die auf den Schultern sitzen wie Blumentöpfe und blühen, mit großen Schlitzen dazwischen für das Lachen, und schließlich, von unten herauftönend, jenes schmatzende Geräusch, wie es sich mit zwei schnellen Fingern in einem Töpfchen mit von der Hitze geschmolzener Nivea-Creme erzeugen lässt.
Um halb elf ging ich zurück in die Wrangelstraße und klopfte bei Vogl. Es war niemand da. Es war nie wieder jemand da …
Wie sollte ich so viele Jahre später darauf eine gute Antwort geben können?
Erinnerung eines Mannes ohne Erinnerung
Kurz zu mir. Mein Name ist Autenrieth. Georg Autenrieth. Ich wurde fünf Jahre nach Kriegsende, als die Kirschbäume bereits geleert waren, aus vermutlich niederen Beweggründen gezeugt. Noch heute büße ich für diesen Leichtsinn mit dem Leben. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehören ein hölzernes, nach Teerfarbe duftendes Gartentor, durch das ein schwarz-weiß gescheckter Hund die Schnauze steckt. Dahinter eine imposante Reihe roter und strotzender Kaiserkronen (Fritillaria imperialis), die längs des Gartenwegs in die abgründige Welt meiner Großmutter Spalier standen, und die Ruinengrundstücke von Nürnberg, die ich vom schwankenden Ausguck der väterlichen Schultern mit vorsprachlicher Eindringlichkeit anstarrte.
Die Sturzmassen des rötlichen Buntsandsteins mit den zertrümmerten Beschriftungen in schwerer Schwabacher Fraktur wurden für mich zum Inbegriff eines Geländes, in dem ich vor dieser autoritären Geburt meine Vorgeschichte verbüßt haben musste. Der erste Ausdruck, den meine Mundwinkel zu bilden vermochten, war herablassender Trotz. Wenn mein Vater mir unter die Achseln griff, um mich über seinen Kopf zu heben und auf der Straße abzusetzen, rutschten meine kleinen, runden Schultern immer hoch bis über beide Ohren. Anschließend landete ich in der Tiefe. Aus dieser Tiefe sah ich meinen Vater in Lebensgröße. Er schnitt gar nicht schlecht ab im Vergleich zur Höhe der Gebäude.
Er trug einen deutschen Trenchcoat von englischem Schnitt, hatte den Kragen hochgestellt und auf dem Kopf jenen Hut, der in diese Lebensgröße inbegriffen war. Das gute Stück war von Mayser und trug innen ein gesticktes Wappen, das mit einer Folie gegen Schwitzflecken geschützt war. Wenn er bei Laune war, nannte er mich »Sir« und lächelte wie Frank Sinatra. Ich ahnte bereits damals, dass ich diese Lebensgröße nie erreichen würde. Es würde ausgehen wie der Wettlauf des Achilles mit der Schildkröte, er würde immer einen Hut größer bleiben und mir damit um das Stück Männlichkeit voraus sein, das ich ihm damals von da unten aus zubilligte und später auch nie Anlass hatte zu bezweifeln.
Über meine darauffolgende Jugend ist mir wenig bekannt. Sie erschöpfte sich überwiegend in Ereignissen, die später vor unseren hochgestochenen Seelen keinen Bestand hatten: also Leidenschaften Menschen gegenüber, die man heute als Kinder bezeichnen würde, das erste Räuspern gegen den Gang der Dinge, hinter dem irgendwann die lange Hand des Weltgeistes erkennbar wurde, oder die sensationellen Augenblicke grundloser Selbstbewunderung, über die man nie Rechenschaft abzulegen hatte. Lediglich die ersten Reisen auf den Flügeln des jungen Wirtschaftswunders, jener Großangriff auf den Erdball, mit dem jeder sein Scherflein dazu beitrug, das Schöne und Fremde der Welt in die Fototapete zu verwandeln, mit der heute das Gehirn aller Touristen tapeziert ist, sind mir noch in Erinnerung.
In den fünfziger und sechziger Jahren war es in Deutschland noch sehr still. Mucksmäuschenstill. Die Knaben waren kurz, mit runden Knien und Seitenscheitel, die Straßen eng und gewunden, mit leichtem Buckel, damit der Regen nach beiden Seiten in die Straßengräben ablaufen konnte, und fast das ganze Jahr über arbeitete ein nützlicher Wind an den deutschen Wäscheleinen, die mit allem, was zu flattern bereit war, dem Dritten Reich hinterherwinkten. Die Sonntage hatten die umständliche Länge eines Gartenschlauchs und sprudelten fast unhörbar in der Sonne. Saba-, Grundig- und Loewe-Opta-Radios bohrten ihr magisches Auge tief ins Herz des abendlichen Kinderzimmers. Nach dem Ausschalten verglühte es so langsam, dass es den Schlaf hineinsaugte in die Tiefe des Röhrenverstärkers und den Abdruck eines Glühfadens auf den letzten Gedanken hinterließ. Der deutsche Schlager war gedämpft von der Schwelle der Zimmerlautstärke und drang nur so schwach ins Freie, dass die Stille fast noch mächtiger sich dem angestrengten Ohr entgegenwarf. In den Wohnzimmern mit Couchgarnitur und Tischläufer verbreiteten die nüchternen Nachrichtensprecher im Radio eine Ruhe, die wie das Rieseln von Korn auf einer hölzernen Tenne Anteile auf die Ewigkeit auszugeben schien. Die hochdeutschen Männer hatten noch eine leichte Heinz-Rühmann-Färbung im Ton, eine blecherne UFA-Schmissigkeit, die Dialekte dagegen waren wuchtig, fromm und schützend. Jedenfalls galt das für den Süden.
Die Stimme der Frauen ist ohne die eiserne Dauerwelle, mit der sie optisch verstärkt wurde, nur schwer wiederzugeben. Sie bestimmte diese so nachhaltig wie der fünfarmige Blumenständer neben dem Gummibaum den Eindruck der Fernsehecke oder den Eingangsbereich der Stadtsparkasse. Erst ganz langsam entspann sich, ausgehend von den Küchen, der Kampf gegen die Düsternis des deutschen Möbels. Die Buntheit des Internationalen Stils entpuppte sich zuerst in Tassen, die auf den Mädchennamen Melitta hörten, in Tütenlampen, bedruckten Vorhangstoffen aus Diolen oder Dralon und griff schließlich auf Lebensansichten über, die bunter, lustiger und zunehmend unsolider wurden. Die ersten Biedermeiermöbel aus edler Kirsche wichen dem gespreizten Ungeheuer der Musiktruhe und kurz darauf einem Fernsehmöbel, das man aufschlagen konnte wie einen Fensterladen, und Heinz Drache schaute ins Zimmer oder Gert Fröbe oder ein Durbridge verwüstete die Nerven einer noch in echtem Mitfiebern rückständig empfindenden Zuschauerschaft. Das Halstuch und Das Fenster zum Hof hatten auch mich zutiefst verstört. Eine Welt von Sport, Spiel und Spannung entstand so unmerklich, wie morgens ein Gänseblümchen sich öffnet, und die Einrichtung für diese Welt gab’s in Resopal oder Schleiflack, mit Stragula, Linoleum und Eternit.
Draußen aber war noch alles still. Obwohl Adenauer bereits gesagt hatte, lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb, wollte das halbe Deutschland, das Adenauer vorgab, lieber zu haben, ganz offensichtlich doch lieber das ganze Deutschland. Deshalb standen vor vielen Ortschaften große Tafeln mit der Aufschrift: Deutschland ist unteilbar, wiewohl historisch gerade der Beweis des Gegenteils erbracht worden war. Weil aber in Deutschland noch alles still war, denn es gab einen ziemlich schwerwiegenden Grund, den Mund zu halten, blieb es, was die Deutschlandfrage angeht, bei einem leisen Grollen. Noch immer galt die Mahnung des letzten Kaisers: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.
Trotz aller Zerstörung war Deutschland aber noch die stille Schönheit seiner Landschaften erhalten geblieben, die der wirtschaftliche Aufbruch ein paar Jahre später der schwersten Belastungsprobe seit der Erschaffung der Welt aussetzte. Das Wunder der geschlossenen Ortschaft, das die Wende dem vor sich selbst davongedüsten Westdeutschen im zeitlich auf der Strecke gebliebenen Osten 1989 noch einmal kurz vor Augen führte, war allgegenwärtig. Die Dörfer lagen wie Streuobst in der Landschaft oder hingen an den Stielen ihrer Kirchtürme dachziegelrot am Himmel und rochen verstörend nach Milch und Kalk.
Falscher Bericht
Was meine Lage allerdings von Anfang an schwierig machte: Ich war der Sohn zweier sehr ungleicher Väter. Kein Wunder also, dass später, sozusagen unter der Schirmherrschaft nur eines einzigen Gehirns, nämlich des hier Auskunft gebenden, Gesichter verwechselt, Mäuler, die gefüttert werden mussten, vertauscht wurden. Der eine Vater stammt aus der Blechtrommel, der andere aus den Buddenbrooks. Dies natürlich nur im übertragenen Sinne, denn beides waren Männer, die ehrbaren Beschäftigungen nachgingen. Bei aller Grundverschiedenheit verfügten beide Väter über ein stark ausgeprägtes Realitätsprinzip.
Der eine, Johann Autenrieth, Jahrgang 1929, ist jener Herr unter mir, der mich von seinen Schultern aus gerade teilhaben lässt am Nürnberger Ruinenschauspiel. Er ist gerade mal zweiundzwanzig Jahre älter als ich. Vierundzwanzig damals. Pechschwarzes Haar. Liebt amerikanische Big Bands und Hemingway. Er ist mein Vater väterlicherseits. Am unteren Rand meines durch ihn ermöglichten Ausblicks über die alte Reichsstadt wuchern Kamille und Rainfarn am Fuße der Ruinenhalden. Kaskaden aus Buntsandstein, die an zerklüfteten Fassaden sich herabwälzen, versinken in Dornen und Gestrüpp. Der Duft der Pflanzen explodiert glücklich in meinem Gehirn. In der nördlichen Ecke eines Ruinengrundstücks, dem Hauptbahnhof gegenüber, dort, wo eine Brandmauer fast den ganzen Tag die Sonne abhält, wogt eine bläuliche Brennnesselsee.
Die Ruinen hatten nichts Beunruhigendes. Sie wirkten entsagungsvoll in ihrer Zerklüftetheit, ihrer Bruchstückhaftigkeit, den Zuteilungen des Himmels gleichgültig ergeben, egal ob seiner scherzhaften und fränkisch-verschrobenen Sonne oder seinem langsamen, langweiligen Regen. Erst recht bei Mondlicht. Was veranstaltet das Mondlicht nicht alles für einen Zirkus mit diesen Ruinen. Einmal kamen wir etwas später zurück aus einem Wirtshaus, das Wolfsschlucht hieß oder Roter Ochse, wo mein Vater zwei Märzen und zwei Kurze und ich ein Afri-Cola getrunken hatten. Auf dem Rückweg zum Bahnhof waren meine Augen immer wieder hängen geblieben an jenen aufgemalten schwarzen Balken, die jäh im rechten Winkel nach unten abknickten und mit der Pfeilspitze auf irgendein Kellerloch deuteten und neben denen die Buchstaben LSR standen. Die Abkürzung für Luftschutzraum, wie ich erst sehr viel später herausfand. Bis dahin besaßen diese schwarzen Haken, die förmlich nach meinen Augen angelten, die Magie eines Orakels. Ein Grabeshauch wehte aus den offenen Löchern, den Kellerschächten, und strich über meine nackten Beine wie eine kühlende Salbe. Schließlich erreichten wir jene Ruinengegend südlich des Hauptbahnhofs, in Szene gesetzt von einem verrückten Mond, der zwischen den wie Packeis ineinandergeschobenen Gebälken, Fassadenteilen und geborstenen Fensterfriesen eine süße Schauerlichkeit verbreitete. Beides, der Luftschutzraum und die Ruinen, begannen im kühlen Mondlicht so zu verschmelzen, wie ich es später auf Caspar David Friedrichs Eismeer wiederfand.
Mein anderer Vater, Jahrgang 1915, hieß Rolf. Er war der Sohn einer bourgeoisen Lawine, eines echten Gründerzeitlers. Fest verankert in den Grundsätzen deutscher Art führte der Weg der Familie aus den Gründerjahren schnurstracks in und durch das Dritte Reich. Dieser Firmengründer und Gründerzeit-Großvater stellte meinen Vater mütterlicherseits bereits in den Schatten, noch bevor der überhaupt die Gelegenheit hatte, das Licht der Welt zu erblicken. Meine Großmutter, Sophie Autenrieth, geborene Hechtel, nahm daran keinen Anstoß – im Gegenteil, sie setzte dem Ganzen noch eins drauf. Sie rüstete sich zur Geburt wie zu einer Verteidigung gegen die Türken. Sie verbarrikadierte das Büro der Firma, ihren Körper, und vor allem ihren Verstand. Mit einer stillen Entrüstung verfolgte diese hagere Dame das Anschwellen ihres Bauches, aber trotz all ihres Widerstands hatte mein anderer Vater nicht das Glück, noch einmal ungeboren davonzukommen. In ihrer Boshaftigkeit, ihrem Geiz und ihrem Hochmut aber bereitete sie sich da schon darauf vor, ihre ganze Familie zu überleben. Nachdem ihr dies nach dem gewissenhaften Ableben des Großvaters mit einundsiebzig und der tragischen Krankheit des Vaters gelungen war, drückte sie die Genugtuung über ihre sieghaft unter Beweis gestellte Unverwüstlichkeit darin aus, die gesamte Familie, von der nur noch ich, meine Mutter und ein paar Ableger zweiten oder dritten Grades übrig waren, zu enterben.
Meinem (anderen) Vater, ein blasser und nachdenklicher Mann, der in der Firma vom Alten zeitlebens wie ein Buchhalter herumkommandiert wurde, hatten die Ärzte gegen ein Hüftleiden Cortison verabreicht, als handle es sich um Brausepulver, bis er regelrecht in seinen Knochen zusammenbrach und starb. Noch am Tage seiner Beerdigung entledigte sich die alte Sophie Autenrieth ihrer Schwiegertochter. Sie gab ihr, meiner Mutter, zu verstehen, dass sie sie in ihrem Hause, womit sie sowohl ihr Haus als auch die Firma meinte, nicht mehr sehen wolle, weil sie, wie sie sagte, meinen Vater, also ihren Sohn, mit ihrer Renitenz und ihrer Vergnügungssucht ins Grab gebracht habe, womit sie ihr, ohne diese beiden unterstellten Todesursachen mit der medizinischen abzugleichen, fristlos die Prokura kündigte, die mein Großvater ihr bei der Heirat mit meinem Vater erteilt hatte, und stieß damit meine Mutter in den Haushalt und somit in meine unmittelbarste Umgebung zurück, worauf weder ich noch diese Umgebung gefasst waren. Das nicht unbeträchtliche Vermögen, so bestimmte sie, sollte nach ihrem Tode an einen Schwarm ihrer Jugendtage gehen. Er hatte sich in all den Jahren darin nützlich gemacht, sie in jeder Infamie zu bestärken. Der Mensch vereinigte die Qualitäten eines Idioten, eines Verbrechers und eines Steuerberaters zu gleichen Teilen.
Immerhin aber waren meine ersten Lebensjahre, bis ich diesen anderen Vater mit acht verlor, durchflutet von dem Licht der Beletage, der brokatartigen Ruhe bürgerlicher Zimmerfluchten und einem englisch-verwilderten Garten mit offenem hölzernem Pavillon, in dem es eine rundumlaufende, schwach nach Schnecken duftende Bank gab, auf der die Tochter der mit Mutter befreundeten Schälmanns mir mit beiden Händen das erschreckende Fehlen ihres Penis zeigte. Damals war ich fünf. Ich wurde auf Knien ertappt und dafür bestraft, etwas gesehen zu haben, was gar nicht da war. Die Strafe wurde vollzogen mit einer hölzernen Reihenfolge aus Kochlöffel, Kleiderbügel und Teppichklopfer.
In der Firma meines Großvaters, des Honorarkonsuls Ignatz Autenrieth, gegründet im Jahre 1879 als die Autenriethschen Spulenwerke Fürth, abgekürzt ASF, wurden elektromagnetische Motoren für mittelschwere Maschinen hergestellt. Später erweiterte man die Produktion auf elektrische Klein- und Werkzeugmaschinen, die Jahr für Jahr ausgezeichnet wurden für wegweisendes industrielles Design. In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigte die Firma fast zweihundert Arbeiter. Das aus Backstein gemauerte Fabriktor, das an das berühmte, von den Architekten Reimer und Körte entworfene Tor der Berliner Borsigwerke erinnerte, durchschritt ich stets, als würde ich in Bethlehem einziehen. Die Gesichter der Proleten, die an den Maschinen standen, beeindruckten mich tief. Sie jagten meiner schreckhaften Intelligenz die Angst ein, niemals in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Besonders ihre auf die weißen, engen, kurzärmeligen Unterhemden zugeschnittenen Oberkörper mit diesen keulenförmig in die Arme übergehenden Schultern waren Gegenstand meiner unersättlichen Bewunderung. Für die Büroangestellten, mit Ausnahme von Fräulein Weichsel, die mich mundartlich und mit ihrer überwältigenden Fürsorge eroberte, war ich blind. Die Arbeiter aber waren echte Kerle, die ständig vom Krieg redeten, den ich mir ähnlich wie die große Fabrikhalle vorzustellen begann mit ihren pfeifenden Treibriemen, ihren grausamen Metallfräsen, den Trichloridwannen, in die die schweren, ölverschmierten Werkzeuge einschlugen, und den ratternden Förderbändern. Die Fabrik war wie ein schwerer Panzer, dessen Geschütz direkt auf mein Gehirn gerichtet schien. Mein Großvater besaß damals in Fürth die halbe Hornschuchpromenade und dazu noch ein ganzes Straßenkarree in der Südstadt, und er fuhr den gleichen schwarzen Mercedes, den die deutsche Geschichte auch unter Hitlers Hintern gesehen hatte.
Selbsterhaltung
Die moderne Literatur hat uns gelehrt, dass wir keinen Anlass haben, einem günstigen Eindruck von uns Glauben zu schenken. In allen Büchern, die die Auszeichnung erfahren haben, dass die Dichter sie loben, finden sich unentwegt Beschreibungen, die wir aus den schlimmsten Vorwürfen gegen uns kennen. Wir müssen sie also ernst nehmen. Je erdrückender im Laufe der zivilisierten Jahrhunderte die dunkle Vergangenheit wurde, desto enger wurde es für die Menschen in ihrer Gegenwart, da von der anderen Seite mit entsprechender Kraft eine ungewisse Zukunft dagegendrückte. Mit dieser unglückseligen Entwicklung begann, was heute endgültig zu werden droht, die Verbannung ins Jetzt. Alles Titanische, welches die Kosmologien auf die Götter abwälzten, damit der Mensch es endlich von der Jacke hatte, musste, nachdem es im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert noch einmal kurz über den menschlichen Geist hereinbrach und zu den eindrucksvollsten Leistungen deutschen Geistes führte, mehr und mehr zurückweichen, um jenen Mikromenschen der Massenzeitalter Raum zu geben, aus deren innerer Verhältnismäßigkeit endlich der Antiheld hervorgehen konnte.
Heute bietet das Leben, aus der Sicht der Vorwürfe, die die Literatur gegen uns erhebt, höchstens noch eine günstige Gelegenheit, sich für jemand zu halten, der man mit ziemlicher Sicherheit nicht ist. In Wirklichkeit ist man nämlich der Verblendete, der unangenehme Zeitgenosse oder das Nervenbündel, als das man seinen Mitmenschen deutlich vor Augen steht. Dass man sich selbst für sympathisch, intelligent, gutaussehend und grundanständig hält, könnte im Grunde jedes Gruppen-, Vereins- und Familienfoto, jede Selbstbetrachtung oder Gegenüberstellung widerlegen. Dazu müsste man gar nicht auf die Psychoanalyse oder andere Techniken der menschlichen Entlarvung zurückgreifen. Trotzdem hält sich beim Individuum irgendwie die hartnäckige Überzeugung, etwas Besonderes und Gelungenes zu sein.
Nur die Literatur sieht das glücklicherweise anders. Bei dem einen Autor erwacht man als ungeheures Ungeziefer, als das man sich nicht einmal aus seinen schlimmsten Albträumen kennt, beim zweiten verführt man als Mann von Geist die minderjährige Stieftochter, beim dritten wird der alles beherrschende Stuhlgang des Vaters zum lebensbegleitenden Leid-Motiv und beim nächsten endet man, ein delirischer Normalfall, verheddert in einen lausigen Vierundzwanzigstundentag, in einer Prosa des Tourette-Syndroms, gekrönt von einem Schwall von Vaginamonologen. Je verpeilter man ist, desto würdiger wird man, so scheint es, einer Hauptrolle in der großen Literatur. Diejenigen, denen etwas von ihrer tatsächlichen Lage schwant, werden krank, wenn sie es nicht umgehend schaffen, diese Befürchtungen in Literatur umzusetzen oder aber auf der Stelle ihr Leben in Arbeit und Geschäftigkeit zu ertränken.
Dieses Welt- und Menschenbild vor Augen zog ich Ende der siebziger Jahre nach München und stellte mir die Frage, wo die eigene Vergangenheit beginnt: Mit der Geburt? Mit der Erinnerung? Oder mit der Erkenntnis?
Gute Frage. Triple choice. Ich fürchte heute, alle drei Möglichkeiten beantworten die Frage nur unbefriedigend. Aus allen möglichen Metropolen, die in dieser Zeit noch ziemlich krass zwischen wund und wild, hart und herrlich, fremd und frisch auseinanderklafften, war ich immer wieder ins Nürnberger Bermudadreieck zurückgekehrt. Nun hatte ich mich endlich entschlossen, meine kleine Selbstmörderwohnung nach außen hin aufzugeben und nur noch als geheimen, gelegentlichen Arbeits- und Zufluchtsort zu nutzen.
München lag, als ich mit Bücherkisten und ein paar wenigen Möbelstücken, also Schrank, Tisch, Bett und Stuhl, dort eintraf, in der Sonne und döste. Wie alle wussten, hieß es von dieser Stadt, dass man von da aus schnell in Italien sei, die Berge »vor der Haustür« habe und dass ein Schimmer italienischen Lebensgefühls über der bayerischen Hauptstadt schwebe. Wer auf dies alles nicht spekulierte, dem war nicht zu helfen. München galt als überschaubare Stadt, reich und introvertiert, grantig und kultiviert, und im Allgemeinen angenehm entspannt. Dies alles stimmte auch. Zwischen Olympiagelände und Englischem Garten glitzerten die Gitarrensoli von den Dire Straits oder Carlos Santana. Nicht, dass deren Musik mir besonders viel bedeutet hätte, die Doors oder andere Bands waren mir näher, aber es war eben dieser Sound, der in der weiß-blauen Atmosphäre über dem Monopteros-Tempelchen sich kräuselte.
Nach einigen Monaten in einem steifen und etwas unterkühlten Haus in der Herzogstraße, dessen Bohnerwachsgeruch am Freitagvormittag ich über alles liebte, zog ich nach Haidhausen. In die Milchstraße. Das Schild Vorsicht, frisch gebohnert verschwand seitdem aus meinem Leben. Es folgte ein Dasein zwischen Negerhallen und Nachtcafé, Glyptothek und Reitstall, Hofgarten und Alter Pinakothek, Ruffini und Aumeister, Ammersee und Herkulessaal, Staatsbibliothek, Basis-Buchhandlung und Schöttle, Milchstraße und Mondfinsternis, Arm und Reich, schön und tot, Prinzregentenstraße, Schönbrunn und Bahnhofsviertel, Sex und Sorge, Innenstadt und Außenwelt sowie Kirche, Staat und Gott. Dazwischen reiste ich nach New York, wo ich gerade eine Wohnung auf der Bleecker Street mit einem Miniapartment in der East 8th Street vertauscht hatte.
Ab etwa 1985 datiert mein Umgang mit Heinrich Büttner und kurze Zeit später auch mit Dirk Pruy. Büttner war Jahrgang 1961, ein Spitzenjahrgang, wie sich an der feinen Säure seiner Lebensgeister und am erlesenen Körper unschwer ablesen ließ – verwöhnt von den Vorzügen einer ausgesprochen günstigen Lage, nur leicht getrübt von allen Schwächen der im Zeichen der Waage Geborenen. Dirk Pruy zog zwei Jahre darauf auf Erden ein und schaffte es später sogar, den Vorsprung des Freundes durch längere Lebensdauer wettzumachen. Auch bei ihm handelte es sich dem Anschein nach um keine Geburt mit Blut und Wasser, Kreißsaal, Presswehen, Schweißperlen und dem finalen Mutterschrei. Man muss sich seine Ankunft auf Erden eher wie den Kennedy-Besuch in Berlin oder die ekstatisch zuckende Spitze der Loveparade auf dem Weg zur Siegessäule vorstellen. Heute würde man sagen: ein Event. Zurück blieb eine tote Mutter, ob sie das nun wusste oder nicht. Pruy war Skorpion, mit deren berüchtigtem Hang zu Grausamkeit, Eifersucht und Unnachgiebigkeit. Er war hart gegen andere, aber auch hart gegen sich selbst, was ihn glücklicherweise daran hinderte, sich seiner angenehmeren Seite, seiner Gefühlsbetontheit nämlich, zu sehr zu überlassen und an ihr zugrunde zu gehen. »Ihre Intelligenz«, hat Balzac über einen typischen Skorpion gesagt, »kann sich durchaus auf einem Punkt der Kreislinie gut halten, ohne die Fähigkeit zu haben, deren Fläche zu umfassen.« Dies charakterisiert Pruys lebenslangen Momentanismus ziemlich gut. Er war immer dort, wo der Ort sich ihn leisten konnte, und zwar mit Haut und Haar, und ich war dies, wie sich später herausstellen sollte, eben gerade nicht. Dirks elegante und saubere Erscheinung verband sich mit einem wirkungsvollen Gesamteindruck von Sturheit und narzisstischer Energie.
Eine Zeitlang waren die beiden Freunde unzertrennlich, verbunden durch ihren Übermut, ihr hemmungsloses Vergeuden von Jugend, Zeit und Talent und ihre Nutzlosigkeit. Beide waren sie ganz und gar die Vertreter dieses neuen Typs junger Männer »Modell Bundesrepublik«. Mit Vorsprung auf die Welt gekommen. Söhne, Erben, Luxusausführungen mit Sonderausstattung.
Im Kern aber schlaff. Deswegen auch bei ihren Auftritten immer diese etwas aufgerafft wirkende Energie. Sprösslinge der neuen Herrenrasse, kaum dass die arische sich zerschlagen hatte. Wirtschaft und Technik hatten inzwischen, ohne den lästigen Umweg über Kultur oder Politik, die Adelung ihrer Parteigänger in Angriff genommen, und beide waren sie deren Hybride. Im Gegensatz zu ihren nützlichen Generationsgefährten auf den unsittlichen Wohlstand nicht durch eine entsprechende Erziehung vorbereitet und mit ganz verwilderten Vorstellungen eines Künstlerlebens.
In beiden steckte so viel James Dean und Marlon Brando, wie sie per Teleinfusion hatten aufsaugen können und ihre Umgebung in der Lage war, zu verkraften: Motorräder, Lederjacken, Frauen, wilde Partys, harte Drinks und lange Nächte lautete die Mischung. Verzaubert von Koks und Artaud. Darüber hinaus waren sie schön wie die Engel, als diese noch männlichen Geschlechts und flammenden Eifers mit Schwertern auf Erden wandelten, ohne jegliche andere Bestimmung, als die Gnade Gottes zu verkörpern oder dessen Rache.
Der Radius unserer gemeinsamen Unternehmungen war um diese Zeit ziemlich groß. Wenn wir auch zu gar nichts taugten, so waren wir doch Vollstrecker einer erregend neuen, noch nie dagewesenen Mobilität. Zwar führte uns die gemeinsame Herkunft immer wieder nach Franken, aber die Fäden liefen von München nach Köln und Berlin, nach Amsterdam, London und Mailand und mehr und mehr schließlich nach New York. So gesehen war es verwunderlich, obwohl wir drei an den verschiedensten Orten der Welt uns schon x-mal über den Haufen geschossen und jede Bank geknackt hatten, in der es etwas zu lachen und zu rauchen gab, dass ich Isabel erst so spät kennenlernte.
Das Buch Isabel
Die Passauer Wucht
Isabel war Kunststudentin im dritten Semester. Ihre Haut war weiß und durchscheinend wie Teeporzellan und ihr Haar tiefschwarz, beides Natur. Wenn sie ihre aufgeworfenen Lippen mit dem Chanel-Stift ihrer Mutter rot anmalte, wirkte ihr Gesicht von weitem wie das Banner einer kleinen, exotischen Botschaft. Ihre Stimme hatte einen verwöhnten, leicht nörgelnden Tonfall, den man damals gerne als »ätzend« bezeichnete, und was sie sagte, war stets reichlich gesättigt mit dem sogenannten Szenesprachlichen. So nannte sie etwas, das ihr bei Ausstellungseröffnungen besonders gefiel, eine »voll geile Arbeit«, eine Beurteilung, unter der man nach einer Reihe von Anwendungen immerhin bereit war, einen Maßstab zu vermuten. Oder sie schilderte, wie eine Arbeit auf sie wirkte, sehr vereinfachend als: »echt krass«.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!