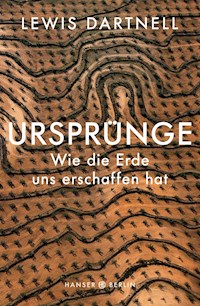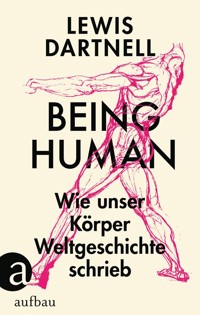
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Eine erhellende Reise durch die Geschichte, mit unserem Körper als Transportmittel. Was für ein Ritt!« Tim Marshall
Wir sind ohne Zweifel ein Wunder der Evolution. Unsere außergewöhnlichen körperlichen Eigenschaften und unsere Innovationen haben unsere Zivilisationen geschaffen. Aber wir sind auch zutiefst fehlerbehaftet. Unsere Körper brechen, ersticken und versagen, ob wir nun Könige oder Bauern sind. Krankheiten durchkreuzen unsere kühnsten Pläne, unsere Psyche ist die Ursache für schreckliche Entscheidungen in Krieg und Frieden. Diese faszinierende Widersprüchlichkeit ist die Essenz des Menschseins: die Summe unserer Schwächen und unserer Stärken, zwischen denen sich die Historie bewegt.
Lewis Dartnell betrachtet zum ersten Mal unsere Geschichte durch die Linse dieser einzigartigen, zerbrechlichen Natur und erforscht wie die Gegebenheiten unseres Körpers unsere Beziehungen, unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaft formten – und wie sie weiterhin unser Sein bestimmen.
»Ein faszinierender Glücksfall von einem Buch.« Mail on Sunday
»Ein sehr unterhaltsames Leseerlebnis.« Sunday Times
»Dartnell findet funkelnde Goldstücke in bekannten Geschichten.« Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Ähnliche
Über das Buch
Ende des 17. Jahrhunderts erkannte Großbritannien, dass die Seefahrerkrankheit Skorbut durch Vitaminmangel ausgelöst wird. Daraufhin begann die Royal Navy, Zitronensaft in den Schiffsproviant aufzunehmen. Das Mittel bewährte sich, die Krankheit unter den Seeleuten ging zurück und die Nachfrage nach Zitronen in der Royal Navy stieg in ungeahnte Höhen. Da das britische Klima sich nicht für deren Anbau eignete, mussten Zitronen importiert werden, und zwar vorwiegend aus dem Mittelmeerraum.
Über Umwege wurde ab 1803 Sizilien zu einer riesigen Zitronensaftfabrik und durch den inzwischen riesigen Marktwert der Zitrone hatten die Eigentümer der Zitrusfruchtplantagen stark unter Diebstählen zu leiden. Mangels einer zentralen Staatsgewalt, mussten die Plantagenbesitzer sich anderswo Hilfe suchen: Sie bezahlten kräftige Männer als private Sicherheitsposten. Diese erkannten darin kurze Zeit später ein neues Geschäftsmodell und begannen, von Bauern Schutzgeld zu erpressen. Bei allen, die sich mit diesen frühen Mafiosi auf einen Handel einigten, wurde eine Zitrone auf das Tor der Plantage gelegt und zeigte an, dass sie unter ihrem Schutz stand. So war in den 1870er Jahren die Organisation entstanden, die wir heute als modern operierende Mafia kennen.
Lewis Dartnells Talent, kuriose Anekdoten aus der Geschichte mit wissenschaftlichen Fakten zu verweben und damit die Weltgeschichte so zu erzählen wie niemand vor ihm, macht sein Buch zu einem kurzweiligen, großartigen Lesevergnügen – er »hält dem Vergleich mit Yuval Harari stand« (Sunday Times).
Über Lewis Dartnell
Lewis Dartnell ist Astrobiologe und Professor für Wissenschaftskommunikation an der University of Westminster. Für seine wissenschaftlichen Beiträge wurde er vielfach ausgezeichnet. Seine Artikel erscheinen u. a. in The Times, The Guardian und New Scientist. 2014 erschien von ihm der Bestseller »Das Handbuch für den Neustart der Welt«, 2019 »Ursprünge. Wie die Erde uns erschaffen hat«. »Being Human« ist der letzte Teil seiner Trilogie über das Menschsein.
Sebastian Vogel, geboren 1955, studierte Biologie in Heidelberg und Köln. 1985 promovierte er zum Dr. rer. nat. Nach einem kurzen Ausflug in die Gebiete von Journalismus und Schriftstellerei arbeitet er seit Ende der 1980er Jahre als wissenschaftlicher und literarischer Übersetzer. Seither hat er mehr als 200 Titel aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Sebastian Vogel lebt in Kerpen im Rheinland.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lewis Dartnell
Being Human
Wie unser Körper Weltgeschichte schrieb
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Einleitung
Kapitel 1: Software für die Zivilisation
Wie wir uns selbst gezähmt haben
Zivilisation und der Wiederaufstieg der Despoten
Kooperation und Altruismus
Gegenseitiger Altruismus
Freundschaft und das Paradox des Bankers
Indirekte Gegenseitigkeit
Wie Betrüger entlarvt werden
Von der Gesellschaft zur Zivilisation
Kapitel 2: Familie
Paarbindung
Die Habsburger
Monogamie und Polygamie
Fortpflanzung in Dynastien
Der Fluch der spanischen Habsburger
Kapitel 3: Endemische Krankheiten
Das Darién-Projekt
Im Fieber der Revolution
Resistenz
Krankheit und Entwicklung
Der Kampf um Afrika
Kapitel 4: Epidemische Krankheiten
Die Cyprianische Pest
Die Justinianische Pest
Der Schwarze Tod
Völkermordkeime
Der transatlantische Sklavenhandel
Die Influenzapandemie von 1918
Das Ende des Ersten Weltkrieges
Indien
Kapitel 5: Demographie
Die Bantu-Expansion
Militärische Macht
Napoleon und seine demographischen Wirkungen
Demographische Folgen des Krieges
Gestohlene Generationen
It’s raining men
Kapitel 6: Wenn unser Geist sich verändert
Alkohol
Wirkungen von Alkohol auf das Gehirn
Destillation
Dopamin und das Lustzentrum des Gehirns
Koffein
Die Wirkung von Kaffee im Gehirn
Nikotin
Erfolg in Virginia
Die unvernünftige Wirksamkeit der Alkaloide
Opium
Kapitel 7: Codierfehler
Der Fluch des Hauses Coburg
Russland
Skorbut
Die Suche nach Heilung
Seeblockade
Zitronen und der Aufstieg der Mafia
Vitamin‑D- und Vitamin‑A-Mangel
Kapitel 8: Kognitive Verzerrungen
Mentale Ausrutscher
Der Fluch des Wissens
Die Entwicklung der Concorde
Verlustaversion
Coda
Danksagung
Abbildungsnachweis
Endnoten
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Coda
Bibliographie
Register
Erläuterungen
Impressum
Für Davina & Sebastian
Einleitung
Geschichte ohne Vorgeschichte ergibt keinen Sinn, und genauso sinnlos bleibt Vorgeschichte ohne Biologie.
– E. O. Wilson, Die soziale Eroberung der Erde1
Wir Menschen sind eine hochintelligente und mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattete Affenspezies. Nicht nur unser komplexes Gehirn ist ein Wunder der Evolution, auch unser Körper ist eine technische Meisterleistung. Unsere fein abgestimmte Physiologie macht uns zu leistungsfähigen Langstreckenläufern, unsere Hände verfügen über eine elegante Geschicklichkeit, Dinge herzustellen und zu bedienen, und unsere Rachen und Münder sind zu erstaunlicher Kontrolle über die Laute, die wir hervorbringen, imstande. Sie machen uns zu Virtuosen der Kommunikation: Mit unzähligen Formen gesprochener Sprache können wir alles Mögliche mitteilen, von körperlichen Anweisungen bis hin zu abstrakten Konzepten und der Koordination in leistungsfähigen Gruppen und Gemeinschaften. Wir lernen von anderen, seien es Eltern oder Gleichaltrige, so dass nicht jede Generation von vorn anfangen muss. Unsere Kultur ist also additiv, im Laufe der Zeit wuchsen unsere Fähigkeiten. Waren wir anfangs meisterhafte Steinwerkzeughersteller, so konstruieren wir heute technische Wunderwerke wie Supercomputer und Raumschiffe.
Auf der anderen Seite sind wir aber sowohl körperlich als auch geistig zutiefst fehlerbehaftet und funktionieren in vielerlei Hinsicht auch nicht besonders gut.
Was haben zum Beispiel die US‑Präsidenten George W. Bush und Ronald Reagan mit den Schauspielerinnen Elizabeth Taylor und Halle Berry gemeinsam? Die Antwort: Sie alle wären beinahe an einem Stück Nahrung erstickt (Bush an einer Brezel, Reagan an einer Erdnuss, Taylor an einem Hühnerknochen und Berry an einer Feige)2. Tatsächlich ist Ersticken heute die dritthäufigste Todesursache bei häuslichen Unfällen.3 Im Vergleich zu allen anderen Tieren eignen sich Menschen offenbar atemberaubend (im wahrsten Sinne des Wortes) schlecht für die überlebenswichtige Tätigkeit: zu essen, ohne sich dabei unabsichtlich umzubringen. Die Gründe haben mit den Gegebenheiten in unserem Rachen zu tun, die uns in die Lage versetzt haben, komplexe Sprachlaute hervorzubringen und mit ihnen ausdrucksstarke Kommunikation zu betreiben. Während der Evolution unserer Spezies rückte der Kehlkopf im Hals immer weiter nach oben, und auch sein Aufbau veränderte sich so, dass er eine immer feinere Steuerung der Geräuschproduktion möglich machte. Die Rohrleitungen zum Atmen und Essen haben bei allen Säugetieren einen kurzen gemeinsamen Abschnitt, und dann verschließt ein kleiner Gewebelappen, Kehldeckel oder Epiglottis genannt, die Luftröhre wie eine Falltür, wenn wir etwas schlucken. Aber die evolutionäre Umgestaltung des menschlichen Rachens führte zu einer beträchtlich größeren Gefahr als bei anderen Säugetieren, dass Nahrung in unserer Luftröhre stecken bleibt, weil der Kehldeckel sich nicht schnell genug schließt.4
Schon Darwin sprach von dem »merkwürdigen Umstand, dass jedes Stückchen Nahrung und jede Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, die Öffnung der Luftröhre passieren muss und dabei trotz der schönen Vorrichtung, mit der die Glottis verschlossen wird, Gefahr läuft, in die Lunge zu gelangen«5.
Und das ist nur einer in einer langen Reihe von Konstruktionsfehlern im Aufbau des menschlichen Körpers: In unserer Evolution hat sich der aufrechte Gang entwickelt, aber diese neue Körperhaltung ist mit gewaltigen Belastungen für die Knie verbunden, und die meisten Menschen leiden irgendwann in ihrem Leben einmal an Rückenschmerzen. Hand- und Fußgelenke enthalten sinnlose, übriggebliebene Knochen, die unsere Bewegungen einschränken und uns anfällig für Verrenkungen und Verstauchungen machen.6 Mehrere Nerven nehmen in unserem Körper einen lächerlich langen, indirekten Verlauf, und manche Muskeln (darunter die, mit denen andere Tiere die Ohren spitzen) dienen überhaupt keinem Zweck mehr. Die lichtempfindliche Schicht an der Rückwand unserer Augen – die Netzhaut – ist von hinten nach vorn angeordnet, so dass unser Gesichtsfeld blinde Flecken hat. Ebenso sind wir mit Defekten in unserer Biochemie und DNA durchsetzt. Gene, die bei anderen Säugetieren einen Zweck erfüllen, sind bei uns beschädigt und funktionieren nicht mehr. Das hat unter anderem zur Folge, dass wir uns vielseitiger ernähren müssen als nahezu alle anderen Tiere, um die Nährstoffe zu uns zu nehmen, die wir zum Überleben brauchen. Und unser Gehirn ist bei Weitem keine vollkommen rationale Denkmaschine, sondern voller kognitiver Fehler und Defekte. Außerdem neigen wir zu Suchtkrankheiten, die zwanghaftes Verhalten verursachen und uns manchmal auf den Weg der Selbstzerstörung führen.
Viele dieser offenkundigen Schwächen sind eine Folge von Evolutionskompromissen: Denn wenn ein bestimmtes Gen oder eine anatomische Struktur mehrere widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig erfüllen soll, kann keine Funktion vollständig optimiert werden. Unser Rachen muss sich nicht nur zum Atmen und Essen eignen, sondern auch für die Artikulation von Sprachlauten. Unser Gehirn muss in der Lage sein, in einer komplexen, unberechenbaren Umwelt die richtigen Entscheidungen zum Überleben zu treffen, und das mit unvollständigen Informationen und – entscheidend – sehr schnell. Eines ist klar: Evolution strebt nicht nach Vollkommenheit, sondern nach dem, was gerade gut genug ist.
Und das ist noch nicht alles: Evolution kann Lösungen für neue Anforderungen und Überlebensprobleme nur dadurch finden, dass sie mit dem herumspielt, was ihr bereits zur Verfügung steht. Sie hat nie die Möglichkeit, ans Zeichenbrett zurückzukehren und etwas von Grund auf neu zu konstruieren. Wir sind die Produkte unserer Evolutionsvergangenheit, vergleichbar mit einem Palimpsest: Konstruktionen überlagern einander, wobei jede neue Anpassung das bereits Vorhandene abwandelt oder darauf aufbaut. Unsere Wirbelsäule ist beispielsweise nur schlecht dafür eingerichtet, eine aufrechte Körperhaltung mit einem großen Kopf am oberen Ende einzunehmen, aber wir mussten aus dem Rückgrat, das uns unsere vierbeinigen Vorfahren übergeben haben, das Beste machen.
Als Menschen sind wir die Summe aller unserer Fähigkeiten und Einschränkungen – sowohl unsere Schwächen als auch unsere Stärken machen uns zu dem, was wir sind. Und die Geschichte der Menschheit hat sich im Spannungsfeld zwischen beiden abgespielt.
Ausgehend von der Wiege unserer Evolution in Afrika, sind wir zur am weitesten verbreiteten Tierart unseres Planeten geworden. Vor rund 10.000 Jahren lernten unsere Vorfahren, wilde Pflanzen- und Tierarten zu domestizieren, und erfanden damit die Landwirtschaft. Aus ihr erwuchs eine immer komplexere Gesellschaftsorganisation mit Städten, Kulturen und großen Reichen. Und während dieses atemberaubend langen Zeitraums voll Wachstum und Stagnation, Fortschritt und Rückschritt, Kooperation und Konflikt, Sklaverei und Befreiung, Handel und Überfällen, Invasionen und Revolutionen, Seuchen und Kriegen – zwischen all diesen Turbulenzen und menschlichen Leidenschaften gab es eine Konstante: uns selbst. In nahezu allen entscheidenden Aspekten von Physiologie und Psychologie gleichen wir im Grunde unseres Wesens unseren Vorfahren, die vor 100.000 Jahren in Afrika lebten. Quer durch die Kulturen der Welt gibt es eine großartige Vielfalt von Glaubensüberzeugungen, Praktiken und Gebräuchen, aber auch wenn in unserem Äußeren oberflächliche Unterschiede und in unserem Inneren teilweise bedeutsamere genetische Abweichungen bestehen, sind wir im Grunde alle gleich gebaut. Die grundlegenden Aspekte des typisch Menschlichen – die Hardware unseres Körpers und die Software unseres Geistes – haben sich nicht verändert.
Mit diesem Buch möchte ich tief in die Menschheitsgeschichte eintauchen und der Frage nachgehen, wie unsere grundlegenden menschlichen Eigenschaften ihren Ausdruck in Kultur, Gesellschaft und Zivilisation gefunden haben. Wie haben unterschiedliche Eigenarten unserer Genetik, Biochemie, Anatomie, Physiologie und Psychologie sich offenbart, und was waren die unmittelbaren Auswirkungen und weiteren Folgen? Damit meine ich nicht nur einzelne, schicksalsschwere Ereignisse, sondern auch ihren Einfluss auf die übergeordneten Konstanten und langfristigen Trends der Weltgeschichte.
Neben unseren besonderen Eigenarten als Menschen werde ich auch untersuchen, was wir in Körperbau und Verhalten mit anderen Tieren gemeinsam haben. Große Teile unserer verfeinerten Kultur und Gesellschaft sind nicht mehr als ein dünner Schleier über dem uns innewohnenden Wesen als Tiere. Vielfach unterscheiden wir uns nicht von anderen Lebewesen, wenn es darum geht, um Nahrung, Sexualität und Fortpflanzung zu konkurrieren, oder wenn wir uns darum bemühen, unseren Kindern im Leben die besten Chancen zu sichern. Solche urtümlichen Triebkräfte manifestieren sich während der gesamten Geschichte in allem Möglichen, von der Struktur unserer Familien bis zu den Bemühungen der Königshäuser, ihre Abstammungslinien unter Kontrolle zu halten. Dazu beziehe ich die neuesten Forschungsergebnisse aus Anthropologie und Soziologie ein, und wir werden auch erfahren, wie tief viele Aspekte unseres Alltagslebens in unserer Biologie verwurzelt sind.
Viele Anforderungen und Einschränkungen unseres Körpers liegen auf der Hand. Wir überleben nur in einem bestimmten Temperaturbereich, und die Effizienz, mit der unsere Lunge der Luft den Sauerstoff entziehen kann, bestimmt darüber, in welcher Höhenlage wir leben können. (Die höchstgelegene dauerhafte Siedlung ist heute die Ortschaft La Rinconada in ungefähr 5100 Metern Höhe in den peruanischen Anden.) Die Notwendigkeit, zum Überleben ständig Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu müssen, bestimmt auch darüber, in welchen Umgebungen rund um die Welt wir uns dauerhaft niederlassen können. Da wir kein Meerwasser trinken können, hingen Seereisen in der Geschichte von den eingeschränkten Süßwasservorräten ab. Unser Lebenszyklus und die lange Entwicklungsphase bis zur Geschlechtsreife bestimmen darüber, wie schnell wir uns fortpflanzen und wie Bevölkerungen wachsen. Unser Körper ist anfällig für eindringende, mikroskopisch kleine Lebewesen und andere Parasiten, die unter Umständen tödliche Wirkungen haben. Unsere Muskelkraft setzt unserer Arbeitsleistung Grenzen und hat uns veranlasst, Arbeitstiere wie Ochsen, Kamele oder Pferde nutzbar zu machen und später ausgeklügelte Technologien zu entwickeln. Und unser Schlafbedürfnis bestimmt über die Aktivitätszyklen einer gesamten Gesellschaft.7
Aber die Eigenschaften unseres Körpers haben die kulturelle Entwicklung der Menschen – die Gebräuche, Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die wir voneinander lernen – auch auf hintergründigere, nicht ganz so offensichtliche Weise beeinflusst.
Alle Sprachen der Menschen werden gesprochen, indem unsere oberen Atemwege komplizierte Geräuschfolgen hervorbringen: Die aus der Lunge ausgeatmete Luft und die Schwingungen der Stimmbänder werden von Rachen, Mund, Zunge und Lippen geformt. Diese hochentwickelte Fähigkeit, verfeinerte Lautäußerungen hervorzubringen, gilt als ein definierendes Merkmal unserer Spezies.
Sprache setzt sich aus mehreren Selbstlauten oder Vokalen wie a, e und o zusammen, zwischen denen vielfältigere Konsonanten stehen; sie alle zusammen werden als Phoneme einer Sprache bezeichnet. Konsonantenphoneme können auf ganz unterschiedliche Weise erzeugt werden, so durch die explosive Freisetzung von Luft bei einem p oder t, die reibende Einschränkung des Luftstroms beim f oder s, an den Zungenseiten entlangströmende Luft beim l oder die nasale Resonanz beim n. Alle Sprachen der Welt setzen sich aus einem Inventar von insgesamt rund 90 verschiedenen Lauten zusammen, aber in keiner einzelnen Sprache kommt mehr als ungefähr die Hälfte davon vor;8 das Englische beispielsweise besteht aus etwa 44 verschiedenen Phonemen.9 Der mit Abstand häufigste Konsonantenlaut ist das m, dessen Bildung anscheinend am einfachsten ist. Er kommt in 95 Prozent der 450 Sprachen vor, die in der Phonological Segment Inventory Database (UPSID) der University of California in Los Angeles im Einzelnen untersucht wurden – das Spektrum reicht von Abipón bis Zuñi und schließt auch das !Xu ein.10 Dieses universelle Phonem wird erzeugt, indem man die Lippen aufeinanderlegt und Luft durch die Nase strömen lässt; es ist eng mit dem Schmatzverhalten der Schimpansen und anderer Primaten verwandt11, ebenso wie das Phonem, mit dem das Wort beginnt, das von über fünf Milliarden Menschen als Erstes gesprochen wird: eine sprachliche Variante von »Mama«. Auf der ganzen Welt werden die Sprachlaute also von den Tönen dominiert, die am einfachsten zu erzeugen sind – und damit von den anatomischen Begrenzungen des Menschseins.
Manche Eigenschaften unseres Körpers haben nicht nur auf unsere Fähigkeiten weitreichende Auswirkungen, sondern auch darauf, wie wir über die Welt denken. Die Tatsache, dass der Mensch üblicherweise an jeder Hand fünf Finger (und an jedem Fuß fünf Zehen) hat – dass wir pentadaktyl sind –, ist ein evolutionärer Zufall. (Die Pentadaktylie setzte sich vor rund 350 Millionen Jahren bei unseren fischähnlichen Vorfahren durch und findet sich auch bei allen anderen Wirbeltieren mit vier Extremitäten, von den Krokodilen bis zu den Vögeln und Delfinen.) Aber dieser Zufall hatte weitreichende Auswirkungen auf unsere Vorstellung von Zahlen und Berechnungen. Wir können zehn Finger abzählen, und deshalb machten sich die meisten antiken Kulturen auf der ganzen Welt ein Zahlensystem auf der Basis der 10 zu eigen.[1] Runde Zahlen sind für uns Vielfache von 10, 100 oder 1000 – und nicht von 6, 36 oder 216, was vielleicht der Fall wäre, wenn jeder Mensch drei Finger hätte. Im 5. Jahrhundert n. Chr. hatte man im indisch-arabischen Zahlensystem die Stellenwertschreibung entwickelt, aus der dann unsere modernen Dezimalzahlen und das metrische Maßsystem hervorgingen. Unsere gesamten Vorstellungen von Mathematik gründen sich also letztlich auf die Zahl der Finger, die aus unseren Vordergliedmaßen sprießen.
Auch andere von uns erschaffene Aspekte der Welt stehen in Zusammenhang mit unseren anatomischen Merkmalen. Der Sekundenrhythmus entspricht ungefähr unserem Ruhepuls; der Zoll oder Inch war traditionell die Breite eines Daumens; und die Meile war mit 1000 Schritten definiert und damit eine Kombination aus unserem Zahlensystem mit der Basis 10 und der Länge eines Beins.
Und wie wir noch genauer erfahren werden, haben nicht nur unsere körperlichen Eigenschaften unauslöschliche Spuren in unserer Welt hinterlassen. Die in der Evolution entstandenen psychologischen Mechanismen und unsere zutiefst menschlichen Neigungen hatten auf vielfältige, häufig eigentümliche Weise Einfluss auf die Kultur der Menschen. Viele davon sind so tief in unserem Alltagsleben verwurzelt, dass wir ihre biologischen Ursprünge leicht übersehen. So neigen wir beispielsweise stark zu Herdenverhalten – wir stellen uns in unserer Gemeinschaft auf andere ein, indem wir ihre Entscheidungen nachahmen. In der Evolution hat uns das gute Dienste geleistet. Es genauso zu machen wie alle anderen, obwohl man es nicht für die beste Handlungsweise hält, ist in einer natürlichen Umwelt voller Gefahren meist besser, als das Risiko eines Alleingangs auf sich zu nehmen. Selbst wenn wir uns im Recht glauben, scheuen wir oft davor zurück, aus dem Rudel auszuscheren. Solches Herdenverhalten ist eine Methode der Informationsbeschaffung – andere wissen vielleicht etwas, was wir nicht wissen – und kann als schnelles Beurteilungshilfsmittel dienen: Mit seiner Hilfe setzen wir Zeit und kognitive Anstrengung wirtschaftlicher ein, als wenn wir alles aus dem Nichts heraus selbst entscheiden würden. Wenn wir beispielsweise durch eine unbekannte Stadt spazieren und nach einem guten Lokal zum Abendessen suchen, fühlen wir uns von einem vollen Restaurant stärker angezogen als von dem leeren nebenan.
Der Herdentrieb war in der Geschichte immer eine Ursache von Modeerscheinungen. Er hat auch Einfluss darauf, ob wir andere kulturelle Normen, religiöse Ansichten oder politische Vorlieben übernehmen. Die gleiche psychologische Verzerrung destabilisiert aber auch Märkte und Finanzsysteme. Die Dotcom-Blase der 1990er Jahre wurde beispielsweise von Investoren vorangetrieben, die immer mehr Geld in Internetunternehmen steckten, obwohl viele dieser Startups finanziell nicht auf soliden Füßen standen. Ein Investor folgte auf den anderen, und jeder nahm an, dass die anderen über zuverlässigere Einschätzungen verfügten, oder man wollte in der Hektik einfach nicht abgehängt werden. In den frühen 2000er Jahren platzte dann die Blase, und die Aktienkurse brachen ein. Solche Spekulationsblasen gab es in der Geschichte schon seit der »Tulpenmanie«, die Anfang des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden herrschte, und das gleiche Herdenverhalten steckt auch hinter den Boom-Bust-Zyklen, wie wir sie beispielsweise im Markt für Kryptowährungen beobachten.
Dieses Buch ist das dritte in einer Trilogie – wobei man jeden Titel auch unabhängig voneinander lesen kann. Ich möchte damit den großen historischen Rahmen und die Entstehung unserer modernen Welt jeweils aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Der erste war Das Handbuch für den Neustart der Welt, eine Art Gebrauchsanleitung, wie man die Zivilisation nach einer Apokalypse schnell wieder in Gang bringen könnte. Darin nutze ich die Vorstellung, dass wir alles verlieren, was uns heute selbstverständlich erscheint, um hinter die Kulissen der modernen Welt zu blicken, zu untersuchen, wie alles funktioniert, und darzulegen, wie die verschiedensten Entdeckungen und Erfindungen den Fortschritt der Menschheit überhaupt erst möglich gemacht haben. Das zweite Buch Ursprünge: Wie die Erde uns erschaffen hat untersucht aus größerem Abstand, wie die Eigenschaften des Planeten, auf dem wir leben – von der Plattentektonik bis zu den Klimazonen, von Bodenschätzen bis zu den Kreisläufen der Atmosphäre –, die Geschichte der Menschen tiefgreifend beeinflusst haben. Ursprünge führt uns von der Entstehung unserer Spezies in der riesigen Spalte des ostafrikanischen Rift-Tals durch die Jahrtausende mit Aufstieg und Fall der Zivilisationen und Großreiche bis in die moderne Welt und zeigt, wie der charakteristische Fingerabdruck der Natur auch in der heutigen Politik zu erkennen ist.
In diesem Buch nun möchte ich den Faden weiterspinnen und uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte die Geschichte der Menschen aus der Sicht der Biologie und des Wesens des Menschseins erzählen. Ich bin ausgebildeter Biologe, und so kehre ich damit in gewisser Weise in mein Heimatrevier zurück. Ich möchte offenlegen, auf welch tiefgreifenden und oftmals überraschenden Wegen untrennbare Aspekte unserer Anatomie, Genetik, Biochemie und Psychologie ihre Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlassen haben.
Wir werden der Frage nachgehen, wie romantische Liebe und Familie sich als Folge der Launen unserer Evolution entwickelt haben, und wie die Ehe von den Herrscherhäusern als Hilfsmittel der Politik ausgenutzt wurde. Warum neigten insbesondere europäische Königsfamilien zur unzuverlässigen Fortpflanzung, und wie lösten andere Dynastien das gleiche Problem – und warum brachten sie dabei eine Kaste unfruchtbarer Soldaten hervor, die der in einer Ameisenkolonie ähnelte?
Ebenso werden wir uns im Einzelnen ansehen, wie unsere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten in der Weltgeschichte vielfach eine zentrale Rolle spielte. Wie führten endemische Krankheiten zur politischen Vereinigung von England und Schottland, und wie trugen sie dazu bei, dass sich die Größe der Vereinigten Staaten über Nacht verdoppelte? Epidemien halfen bei der Ausbreitung einer einstmals abseitigen Religion und leiteten den Niedergang des Feudalismus ein, wurden aber auch zur Triebkraft für den transatlantischen Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika.
Grundlegende Aspekte der Bevölkerung, so ihr Wachstum und das Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen, können weitreichende Auswirkungen haben; mit den Effekten solcher demographischen Kräfte werden wir uns ebenfalls beschäftigen. Außerdem werden wir erfahren, wie wir unseren Bewusstseinszustand ändern können und wie psychoaktive Substanzen mit ihren Auswirkungen auf unseren Geist die Welt verändern können. Wir werden die Frage stellen, wie der Alkohol zu einem berauschenden gesellschaftlichen Schmiermittel werden konnte, welche anregenden Folgen Tee und Kaffee haben, wie Tabak zum belebenden Suchtmittel wurde und wie der Schlafmohn als Werkzeug der imperialistischen Unterwerfung diente.
Aus Fehlern in unserem genetischen Code ergeben sich tiefgreifende Folgerungen. Wir werden erfahren, wie eine seltene Mutation, die bei Königin Victoria entstand, hundert Jahre später in ganz Europa katastrophale Folgen für die Königshäuser nach sich zog und auch bei der russischen Revolution ihre Hand im Spiel hatte. Ein anderes funktionsunfähiges Gen, das allen Menschen gemeinsam ist, spielte im Zeitalter der Segelschiffe eine entscheidende Rolle und führte unbeabsichtigt dazu, dass die berüchtigtste Verbrecherorganisation der Welt entstand.
Und schließlich werden wir uns mit den weitreichenden Folgen von Fehlern in unserer mentalen Software beschäftigen. Von welcher besonderen kognitiven Voreingenommenheit Kolumbus auch besessen war: Trug sie als folgenschwerer Faktor dazu bei, dass ein halbes Jahrtausend später im Irak eine Invasion stattfand, und lauert sie heute hinter dem Problem der politischen Polarisierung? Welche anderen mentalen Schwächen führten zu dem katastrophalen Todesritt der Leichten Brigade im Krimkrieg, und wie suchen sie heute internationale Handelsbeziehungen und Territorialkonflikte wie die zwischen Israel und Palästina heim?
Aber zunächst werden wir unsere Evolution betrachten und erfahren, warum die Menschen lange, bevor sie mit dem Anbau wilder Pflanzenarten und der Zähmung von Wildtieren die Landwirtschaft und Zivilisation schufen, sich erst einmal selbst domestizieren mussten. Welche Entwicklung führte dazu, dass Menschen harmonisch in immer größeren Gruppen zusammenlebten und erfolgreich gemeinsame Unternehmungen in Angriff nehmen konnten?
Kapitel 1
Software für die Zivilisation
Zu nichts scheint die Natur den Menschen mehr bestimmt zu haben, denn zu einem gesellschaftlichen Wesen.
– Michel de Montaigne, »Über die Freundschaft«1
In der Gruppe zu leben, hat für Tiere viele Vorteile. Partnerinnen und Partner sind einfacher zu finden, man hat im Rudel größeren Erfolg bei der Jagd, und die größere Zahl bietet Sicherheit und Schutz gegenüber natürlichen Feinden. Aber im Vergleich zu einer Gnuherde oder einem Fischschwarm sind die Gesellschaften der Menschen dann doch weitaus komplexer. Denn der Schlüssel zum Erfolg des Menschen lag nicht nur in der fachkundigen Werkzeugbenutzung, die durch die außerordentliche Geschicklichkeit unserer Hände möglich wurde, sondern auch in unserer Bereitschaft, uns gegenseitig zu Hilfe zu kommen und miteinander zu kooperieren, selbst wenn wir nicht miteinander verwandt sind und uns wahrscheinlich nie wieder treffen werden. Nichola Raihani formuliert es in ihrem ausgezeichneten Buch The Social Instinct so: »Kooperation ist die Superpower unserer Spezies, der Grund, warum die Menschen auf der Erde nicht nur überleben konnten, sondern in nahezu allen Lebensräumen der Erde hervorragend gedeihen.« Wir bringen einander Fähigkeiten bei und tauschen Informationen aus, die wir uns im Laufe eines Lebens niemals selbst hätten aneignen können. Dieser Prozess des kulturellen Lernens macht die schnelle Ausbreitung neuer Fähigkeiten nicht nur in Populationen möglich, sondern auch additiv über viele Generationen hinweg.
In diesem Kapitel werden wir zwei wichtige Entwicklungen aus der Evolution des Menschen betrachten, die entscheidende Voraussetzungen dafür darstellten, komplexe, im Wesentlichen friedliche Gesellschaften zu bilden und in dem gewaltigen Projekt, das wir Zivilisation nennen, zusammenzuarbeiten:[2] die Verminderung aggressiver Reaktionen und die Entwicklung einer gesellschaftlichen Software in unserem Gehirn, die ein beispielloses Ausmaß an Kooperation möglich macht.2
Wie wir uns selbst gezähmt haben
Sich aggressives Verhalten als eine einzige ununterbrochene Skala von Sanftmut bis Gewalt vorzustellen, ist zu einfach. Es gibt bei Menschen zwei Formen der Aggression, die sich stark voneinander unterscheiden. Reaktive Aggression ist eine hitzköpfige Antwort, ein impulsiver Schlag gegen eine unmittelbare Bedrohung. Die proaktive Aggression dagegen wird weniger von Impulsen und Gefühlen angetrieben: Sie ist eine berechnete, vorgeplante Aktion zum Erreichen eines bestimmten Ziels. Während der Entwicklung unserer Spezies haben sich diese beiden Ausdrucksformen von Aggression in unterschiedlichen Richtungen entwickelt – bei der ersten sind wir sehr langsam geworden, bei der zweiten dagegen höchst versiert. Wenn wir Aggression als Doppelphänomen betrachten, erkennen wir leicht, dass die Behauptung, Menschen könnten sowohl gutmütig als auch gewalttätig sein, kein Widerspruch in sich ist.3
Unsere engsten heutigen Verwandten, die Schimpansen und Bonobos, bilden gemischte Gruppen aus Männchen und Weibchen. Größe und Zusammensetzung solcher Gruppen ändern sich ständig: Eine größere Horde teilt sich in kleinere Rudel auf, die tagsüber in unterschiedlichen Gebieten auf Nahrungssuche gehen, bevor sie sich nachts zum Schlafen wieder zusammenfinden. Über längere Zeiträume wechseln einzelne Individuen zwischen verschiedenen Gruppen, die sich in einer Region verteilen. Schimpansenmännchen, die miteinander verwandt sind, bleiben beispielsweise zusammen, paaren sich aber mit Weibchen aus Nachbargemeinschaften, sobald sie dafür alt genug sind.
Eine solche Form des Gruppenlebens bezeichnet man als Fission-Fusion-Gesellschaftsorganisation. Unter Schimpansen sind Aggression und Gewaltausbrüche in solchen gemischten Gruppen an der Tagesordnung. Männchen belästigen Weibchen, und zwischen den Männchen gibt es Gegnerschaft und Konkurrenz, weil sie um den Zugang zu den Weibchen streiten. Durch die Kämpfe zwischen den Männchen bildet sich eine Hierarchie, und das Alphamännchen muss seine Stellung am oberen Ende der Leiter mit Gewalt oder Gewaltandrohung aufrechterhalten. Schimpansenmännchen bilden auch Gruppen, die an den Grenzen ihres Reviers patrouillieren oder in die Gebiete von Nachbargruppen eindringen. Sie greifen Männchen anderer Gruppen an und töten sie manchmal sogar, um ihren Einflussbereich zu erweitern und sich Zugang zu mehr Nahrung oder Weibchen zu verschaffen. Bonobos sind in der Regel weniger gewalttätig als Schimpansen, aber auch sie zeigen Aggression gegenüber anderen Mitgliedern der eigenen Gruppe wie auch gegen Außenstehende.4
Während Aggression für Schimpansen also Ausdruck einer Lebensform ist, nahm die Evolution der Menschen einen ganz anderen Verlauf. Körperliche Aggression kommt bei Primaten – und zwar selbst bei den friedlicheren Bonobos – über hundertmal häufiger vor als bei Menschen.5 Tatsächlich sind Akte reaktiver Wut heute in traditionellen Gesellschaften von Jägern und Sammlern sogar bemerkenswert selten. In solchen Gruppen herrscht außerdem eine ausgeprägte Gleichberechtigung, dominierende Alpha-Männer oder eine ausgeprägte Dominanzhierarchie gibt es nicht.
Die entscheidende Entwicklung in der Evolution der Menschen war offenbar die Entstehung von Männerbündnissen, die jeden Möchtegern-Tyrannen in Schach halten oder beseitigen konnten. Für diesen Wandel in unserer Gesellschaftsstruktur gab es zwei wichtige Triebkräfte: Sprache und Waffen. Eine effiziente Kommunikation versetzte Individuen in die Lage, sich zusammenzutun und koordinierte Maßnahmen gegen einen Tyrannen zu ergreifen, während sie sich gleichzeitig gegenseitig ihrer gemeinsamen Absichten und ihres Engagements versicherten. Kurz gesagt, eröffnet Sprache die Möglichkeit, einen Despoten mit einer mehr oder weniger ausgeklügelten Verschwörung zu beseitigen. Und wenn dann ein solcher Angriff stattfand, ermöglichten Steine, Speere oder andere Wurfgeschosse den entscheidenden Schlag, ohne dass ein Einzelner sich großen körperlichen Gefahren aussetzen musste.6 Derartige Koalitionen greifen in der Regel nur dann an, wenn sie zahlenmäßig weit überlegen sind und mit einem sicheren Sieg rechnen können. Die gleichen Berechnungen von Kräfteverhältnissen standen auch während der gesamten Menschheitsgeschichte in den Köpfen der Generäle an oberster Stelle.7 Es ist also sehr stark zu vermuten, dass der erste derart geplante Tyrannenmord sicher schon Hunderttausende von Jahren vor der berühmten Ermordung des römischen Diktators Julius Caesar (44 v. Chr.) stattfand.
Nachdem Einzelne mit vereinten Kräften ohne Gefahr für sich selbst aggressive Despoten herausfordern und stürzen konnten, herrschte automatisch stärkere Gleichberechtigung. Der Einfluss des Einzelnen in der Gesellschaft entkoppelte sich von der Körperkraft und beruhte nun stattdessen auf der Stärke des gesellschaftlichen Netzwerks und dem Ruf, den man sich durch Großzügigkeit oder andere gute Taten verschafft hatte. Von dem dominierenden Alphamännchen, das seine Autoritätsposition mit brutaler Kraft und Gewaltandrohungen gegenüber Herausforderungen gewonnen hatte, verlagerte sich die Macht in die größere Gruppe und war nun gleichmäßiger verteilt. Damit war ein neuartiges politisches System entstanden, das den Aufbau der frühen menschlichen Gemeinschaften veränderte: Eine streng hierarchische Struktur machte einer stärker von Gleichberechtigung geprägten Gesellschaft Platz. Und dieser Rückgang der reaktiven Aggression bei gleichzeitig zunehmender Friedfertigkeit schuf die Grundlagen für die Entwicklung komplexerer Formen von Kooperation und kulturellem Lernen.8
Nachdem es nun möglich war, dominierende, gewalttätige Individuen durch koordinierte Allianzen mit geplanter, proaktiver Aggression in Schach zu halten,9 ergab sich ein Selektionsdruck zur Verminderung der hitzköpfigen reaktiven Aggression. Anders als für einen Schimpansen auf dem Höhepunkt seiner Kraft zahlte es sich für Menschen nicht mehr aus, Rivalen zu verprügeln und so in die Spitzenstellung aufzusteigen. Im Gegenteil: Wer in dem Ruf stand, gewalttätig zu sein, riskierte nur, dass eine Koalition von Gegnern sich später gegen ihn stellte. Die kollektive Bestrafung reaktiver Aggression führte dazu, dass sie in der Evolution unterdrückt wurde. Wir domestizierten uns selbst.[3]
Als sich dieser Wandel in der Gesellschaftsstruktur der Menschen vollzog, konnte man das Gleichgewicht innerhalb der Gruppe mit anderen, milderen Sanktionen aufrechterhalten, ohne zu proaktiver Gewalt greifen zu müssen. Wer nicht bei seinem Leisten blieb, wurde öffentlich lächerlich gemacht, beschimpft oder ausgegrenzt – solche Verhaltensmuster und Rituale finden wir noch heute in Gesellschaften von Jägern und Sammlern. Aber die Gefahr, von einer Koalition derjenigen angegriffen zu werden, die ein Diktator zu beherrschen versuchte, blieb die ultimative Abschreckung.
Die Möglichkeit, dass eine Gemeinschaft einen Despoten beseitigt, bietet zwar keine Gewähr für eine gleichberechtigte, gerechte Gesellschaft, sie ist aber eine Voraussetzung dafür und ein großer Schritt in Richtung der Einebnung von Dominanzhierarchien.
Während also die hitzköpfige reaktive Aggression in der Evolutionslinie der Menschen gedämpft wurde, blieb die berechnete, proaktive Aggression erhalten.14 Das Motiv für Überraschungsangriffe auf Siedlungen oder Dörfer war der Wunsch, Konkurrenten zu beseitigen oder sich Nahrung oder – in den meist männlich dominierten Kulturen – Partnerinnen zu beschaffen. Als spätere und uns nähere Erweiterung solcher Verhaltensweisen bildete sich mit der Entwicklung von Stadtstaaten und Zivilisationen das Konzept von Krieg heraus. Krieg ist die stärkste Ausdrucksform der proaktiven Aggression: Er wird von Herrschern angeordnet, von Strategen geplant und in der Hitze des Gefechts von Generälen befehligt.
Im normalen Leben ist tödliche Gewalt gesellschaftlich geächtet; im Krieg dagegen geht es gerade darum, eine entscheidende Zahl von Feinden zu töten. Im Allgemeinen haben Menschen jedoch eine tief verwurzelte Abneigung dagegen, Gewalt gegen ihresgleichen auszuüben – eine biologisch codierte Friedfertigkeit, die aus unserer Evolution in gleichberechtigten gesellschaftlichen Organisationen stammt. Anführer können zwar ihre Leute mit der Behauptung anstacheln, man könne auf dem Schlachtfeld – im Kampf für Gott, König oder Vaterland – Ehre und Ruhm gewinnen, aber während der gesamten Geschichte fanden viele Soldaten – oftmals Bauern, die man von ihren Feldern geholt hatte – den Gedanken, einen anderen Menschen zu töten, zutiefst abstoßend. Die gesellschaftlichen Merkmale und Neigungen, durch die Menschen in einer komplexen Gesellschaft harmonisches Zusammenleben und eine Zivilisation entwickeln konnten, sind genau die gleichen, die überwunden werden müssen, wenn wir uns auf den Krieg vorbereiten. Um Soldaten zum Töten zu veranlassen, ist militärische Ausbildung häufig darauf ausgerichtet, die Aggression zu steigern, und Propaganda zielt darauf ab, dem Feind sein Menschsein abzusprechen.15
Zivilisation und der Wiederaufstieg der Despoten
Die im Wesentlichen von Gleichberechtigung geprägte Gesellschaftsstruktur blieb nach heutiger Kenntnis während des allergrößten Teils unserer Geschichte als anatomisch moderner Homo sapiens bestehen. Aber das Streben nach persönlicher Macht und Dominanz verschwand nie ganz. So kam es dazu, dass sich durch die Einführung der Landwirtschaft und die Entstehung der ersten Zivilisationen die Bedingungen änderten und zum Wiederaufstieg despotischer Herrscher führten.
In einer Gesellschaft von Jägern und Sammlern muss das frische Fleisch nach einer erfolgreichen Jagd ebenso wie die gesammelten, verderblichen pflanzlichen Produkte – beispielsweise Früchte – sofort verbraucht werden, damit sie nicht ungenießbar werden. Deshalb ist es sinnvoll, sie in der Gruppe aufzuteilen, zumal die Gruppe ständig in Bewegung ist und nicht über die Möglichkeit verfügt, Nahrungsvorräte anzulegen.
Mit der Entwicklung der Landwirtschaft lebten die Menschen erstmals in dauerhaften Siedlungen in der Nachbarschaft ihrer Felder oder Viehweiden. Bauern mussten sich nicht mehr auf die Besitztümer beschränken, die sie selbst tragen konnten. Außerdem entstand mit der Fülle der Nahrung in der Erntezeit die Notwendigkeit, Überschüsse in Getreidespeichern aufzubewahren und damit erstmals Handelsware, die man horten konnte. Daraus konnte sich die Idee von Reichtum – und damit gesteigerter Macht – entwickeln. Landwirtschaftliche Überschüsse ermöglichten zudem eine immer dichtere Besiedlung mit Menschen, schließlich die Entstehung von Städten und ein größeres Ausmaß an gesellschaftlicher Organisation. So wurden kompliziertere Staaten geboren, und die Zivilisation entwickelte sich.
Zwar deutet vieles darauf hin, dass auch schon manche Gesellschaften von Jägern und Sammlern nicht vollkommen gleichberechtigt waren und ein gewisses Maß an Sesshaftigkeit, gesellschaftlicher Schichtenbildung und Arbeitsteilung innerhalb der Gemeinschaft aufwiesen.16 Klar ist aber, dass all das erst mit der Einführung der Landwirtschaft weiter um sich griff und sich stärker ausprägte.
Personen, die eine Führungsposition erlangten – vielleicht weil sie andere besser zur Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten wie dem Bau und der Instandhaltung von Bewässerungssystemen anleiten konnten –, verfügten auch über die Befehlsgewalt über solche lebenswichtige Infrastruktur und konnten entsprechend mehr Nahrung für sich selbst anhäufen. Wer die Kontrolle über die Verteilung wertvoller Nahrungsvorräte und anderer Vermögensgegenstände hatte, konnte lebenswichtige Ressourcen zurückhalten und damit Druck ausüben oder Loyalität kaufen, sodass alle Führungsanfechtungen oder Aufstände unterdrückt wurden. Und durch die Weitergabe materieller Reichtümer und sozialer Positionen von einer Generation zur nächsten durch Vererbung in den Familien (ein Thema, auf das wir im nächsten Kapitel zurückkommen werden) verstärkten sich die anfangs kleinen Unterschiede im Besitz von Ressourcen ebenso wie der Einfluss und die Stellung, die damit verbunden waren. Herrscher konnten ihre Position festigen. Privilegien und Macht konzentrierten sich zunehmend in einer Elite, und in der Gesellschaftsstruktur bildeten sich stärkere Schichten aus. In einer landwirtschaftlich geprägten Welt, die auf eine vorhandene Infrastruktur und städtisches Leben angewiesen war, konnten Menschen sich nicht ohne Weiteres entfernen, das heißt, sie hatten kaum eine andere Wahl, als sich den zunehmend autokratischen Herrschern zu fügen.17
Weiter verstärkt wurde die ungleiche Machtverteilung durch Neuerungen wie die ersten Methoden zur Metallverarbeitung und die Produktion von Waffen, Rüstungen und Schilden aus Bronze. In dem ursprünglichen Zustand, in dem potentielle Waffen für alle frei verfügbar waren – jeden schweren Stein und jeden angespitzten Ast konnte man gegen einen Feind richten – wurde die Gleichberechtigung begünstigt. Wenn aber überlegene Waffen und Rüstungen schwierig herzustellen sind, oder wenn man dafür seltene, teure Rohstoffe braucht, tritt der umgekehrte Effekt ein: Jetzt wird die Dominanz des Despoten gefördert. Nur der oberste Boss, der die Kontrolle über den Reichtum hat, kann es sich leisten, die Loyalität gesunder, kräftiger Männer zu kaufen und sie mit den neuesten Waffen auszustatten. Damit wird es für eine spontan entstandene Koalition erheblich schwieriger, einen Tyrannen zu stürzen. Häufig wird ein Staat sogar als zusammenhängendes politisches Gebilde definiert, das innerhalb seiner Grenzen ein Gewaltmonopol ausübt – wobei der souveräne Herrscher des Staates darüber bestimmt, wo und wann die Gewalt angewandt wird.18
Kooperation und Altruismus
Nicht nur die Wege unserer Aggression haben sich verändert, um uns ein friedliches Leben in großen Gruppen zu ermöglichen, sondern wir sind auch in großem Umfang kooperativ und auf einzigartige Weise altruistisch geworden. Die Unterscheidung zwischen beidem ist wichtig: Altruismus verschafft dem Empfänger auf Kosten des Gebenden einen Nutzen; von kooperativem Verhalten dagegen profitieren beide Seiten. Kooperation ist im Tierreich weit verbreitet. Wenn Hyänen im Rudel jagen, können sie eine Antilope zur Strecke bringen, die weitaus größer ist als sie selbst. Mit vereinten Kräften gelangen sie also zu einem Ziel, das kein Tier allein erreichen könnte. Aber die Kooperation von Menschen stellt mit ihrem schieren Ausmaß alles in den Schatten, was andere Tierarten zustande bringen. Der höchste Ausdruck von Kooperation ist die Zivilisation selbst: Große Menschengruppen tragen zu einem gemeinsamen Projekt bei.
Wenn Menschen sich auf diese Weise gegenseitig helfen, handeln sie in vielen Fällen altruistisch. Das heißt, der eine hilft dem anderen auf eigene Kosten, was Nahrung, Energie, Zeit oder andere kostbare Ressourcen angeht, und das anscheinend ohne unmittelbaren Nutzen für den Gebenden. Auf den ersten Blick scheinen solche Handlungen vor dem Hintergrund der Evolution schwer erklärbar zu sein. Wenn jedes Individuum in einer Population mit den anderen im Wettbewerb um Überleben und Fortpflanzung steht, stellt sich die Frage: Was erreicht man, indem man einem anderen hilft, insbesondere wenn es für einen selbst mit Kosten verbunden ist?
Natürliche Selektion wird häufig unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie gut ein Individuum in einer bestimmten Umwelt überleben und mit Artgenossen wie auch mit Mitgliedern anderer biologischer Arten konkurrieren kann (beispielsweise indem es natürlichen Feinden entkommt), und wie gut es ihm gelingt, Nahrung und Paarungspartner zu finden. Tiere mit vorteilhaften Merkmalen behalten die Oberhand, pflanzen sich fort und bringen Nachkommen hervor, sodass in der nächsten Generation mehr Individuen über diese Merkmale und die Gene, die sie hervorbringen, verfügen. Im Laufe der Zeit passt sich eine Spezies also immer besser an ihre Umwelt an. Der eigentliche Erfolg eines Individuums besteht nicht in der Zahl der Nachkommen, die es produzieren kann, sondern in der Zahl der Nachkommen, die ihrerseits überleben und sich wiederum fortpflanzen. Das Ganze muss man langfristig betrachten: Eignung bedeutet, eine möglichst große Zahl von Enkeln zu haben.19
Hinzu kommt aber eine weitere wichtige Erkenntnis. Selektion begünstigt nicht nur Merkmale, die den eigenen unmittelbaren Nachkommen einen Vorteil verschaffen – also die Zahl der Enkel –, sondern auch solche, die zum Fortpflanzungserfolg von Verwandten beitragen. Ein bestimmtes Gen gedeiht nicht nur dann, wenn das Individuum, das es trägt, einen Vorteil davon hat, sondern auch wenn verwandte Individuen – die mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der Abstammung ebenfalls Kopien dieses Gens tragen – überleben und sich fortpflanzen. Das ganze Konzept wird als Gesamtfitness bezeichnet.
Nach diesem Gedankengang kann ein Individuum den Kopien seiner eigenen Gene auch dann helfen, zu überleben und sich zu verbreiten, wenn es seine Verwandten in dem Ausmaß unterstützt, das ihrem Verwandtschaftsgrad entspricht. Genauer gesagt, gedeihen die Gene eines Individuums dann, wenn die Kosten, die diesem Individuum durch die Hilfe für einen Verwandten entstehen, dividiert durch den Nutzen für diesen Familienangehörigen geringer sind als das Ausmaß ihrer genetischen Verwandtschaft. Diese Gesetzmäßigkeit ist als Hamilton-Regel bekannt, benannt nach dem Evolutionsbiologen W. D. Hamilton, der sie in eine mathematische Formel fasste. Am besten versteht man sie aber anhand eines Beispiels. Jeder von uns ist genetisch zu 50 Prozent mit einem echten Geschwister verwandt, das heißt, es besteht eine Chance von 50 zu 50, dass ein beliebiges, zufällig ausgewähltes Gen aufgrund der Abstammung mit dem unseres Bruders oder unserer Schwester identisch ist. Wenn dann jede Handlung, mit der wir unserem Geschwister helfen, diesem mindestens doppelt so viel Nutzen bringt, wie sie uns kostet, führt sie insgesamt zu einem Vorteil für unsere gemeinsamen Gene. Das war eine entscheidende Erkenntnis, die den Evolutionsbiologen J. B. S. Haldane vor Freunden in einem Londoner Pub zu der scherzhaften Bemerkung veranlasste, er würde in einen Fluss springen und sein Leben aufs Spiel setzen, um zwei Brüder zu retten, nicht aber, wenn es nur einer wäre, oder um acht Cousins zu retten, aber nicht sieben.20
Wer Familienangehörigen und insbesondere engen Verwandten hilft, erweist also indirekt den Kopien der eigenen Gene einen Dienst. Eine solche Evolutionsstrategie, mit der das Überleben und die Fortpflanzung von Verwandten auch dann begünstigt werden, wenn es für einen selbst mit Kosten verbunden ist, wird als Verwandtenselektion bezeichnet.
Scheinbar altruistisches Verhalten, das sich an Verwandte richtet, ist also immer noch Eigennutz, denn es trägt dazu bei, die gemeinsamen Gene weiterzugeben. In kleinen, engen Gemeinschaften, in denen kaum Individuen aus anderen Gruppen kommen oder eigene gehen, sind die Menschen in der Umgebung mit hoher Wahrscheinlichkeit verwandt, und deshalb zahlt es sich aus, allgemein gegenüber den anderen Mitgliedern der eigenen Gruppe hilfsbereit zu sein.
Verwandtenselektion ist in der Tierwelt allgegenwärtig: Wie man zeigen konnte, helfen Angehörige vieler Arten bevorzugt ihrer unmittelbaren Familie oder denen in ihrer Gruppe, die höchstwahrscheinlich mit ihnen verwandt sind und deshalb viele Gene mit ihnen gemeinsam haben. Und das ist noch nicht alles. Viele Tiere einschließlich des Menschen befolgen offensichtlich intuitiv die Hamilton-Regel: Sie verhalten sich gegenüber Verwandten nicht nur stärker altruistisch als gegenüber anderen, sondern sie sind auch engeren Verwandten gegenüber selbstloser, als wenn es sich um entferntere Verwandte handelt.21 In menschlichen Gruppen findet die Verwandtenselektion ihren Ausdruck in allem Möglichen: Wir wenden uns gegen einen Angreifer, um die Familie zu schützen, hungern, damit unsere Geschwister etwas zu essen haben, oder helfen, die Kinder unserer Schwester großzuziehen (oder springen in einen Fluss, um eine besonders vom Pech verfolgte Gruppe von acht Cousins zu retten).[4]
Die Verwandtenselektion bietet eine hübsche Erklärung für den größten Teil des Altruismus, den wir in der Natur finden. Akte der Großzügigkeit gegenüber nicht verwandten Individuen kann sie aber nicht erklären. Wie kann eine Verhaltensweise in der Evolution nützlich sein, wenn sie für uns Kosten verursacht und wir nicht damit rechnen können, dass der Nutznießer seine Gene mit uns gemeinsam hat? Die Tatsache, dass Menschen im Vergleich zu anderen Tieren ungewöhnlich freundlich gegenüber nicht verwandten Individuen sind, erfordert also eine andere Erklärung.
Gegenseitiger Altruismus
Die Theorie, die nach allgemeiner Meinung erklärt, wie nicht verwandte Individuen profitieren, wenn sie sich gegenseitig helfen, wird als gegenseitiger Altruismus bezeichnet. Dahinter steht ein wichtiger Gedanke: Wenn ein Individuum einem anderen hilft und dafür unter Umständen sogar einen Preis bezahlt, wird der Gefallen zu einem späteren Zeitpunkt erwidert. Auf diese Weise kann sich Kooperation in der Evolution als Kette gegenseitiger altruistischer Taten entwickeln.23
Einen solchen gegenseitigen Altruismus findet man im Tierreich nicht annähernd so häufig wie den Altruismus gegenüber Verwandten, aber bei wenigen Arten gibt es Belege dafür, dass für sie wie für Menschen die ökologische Notwendigkeit eines sozialen Austausches besteht.24 Anhaltspunkte für einen solchen Austausch beobachtet man bei Pavianen, Schimpansen und anderen Primaten, aber auch bei Ratten, Mäusen, manchen Vögeln und sogar bei Fischen.25 Eine der bestuntersuchten Tierarten sind die Vampirfledermäuse. Sie ernähren sich vom Blut großer Wildtiere, aber auch von domestizierten Nutztieren. Oft ist es für sie aber schwierig, eine Mahlzeit zu finden, und wegen ihres intensiven Stoffwechsels müssen sie mindestens alle ein bis zwei Tage fressen. Vampirfledermäuse leben in großen Kolonien, und wenn ein Individuum bei der Nahrungssuche erfolgreich war, würgt es häufig Blut hoch, um damit einen Nachbarn zu füttern, der weniger Glück hatte. Eine Fledermaus, die in einer Nacht altruistisch Blut abgibt, bekommt den Gefallen wahrscheinlich an einem anderen Tag, wenn die Verhältnisse umgekehrt liegen, zurück.26
Dass der gegenseitige Altruismus so gut funktioniert, liegt letztlich an einem einfachen wirtschaftlichen Prinzip. Wer bei der Nahrungssuche Erfolg hatte, besitzt oft mehr, als er zum Überleben braucht. Der Überschuss wird weniger wertvoll, sodass er für die eigenen Aussichten kaum noch eine Rolle spielt. Für ein Individuum, das nicht genug zu essen hat, ist die zusätzliche Nahrungsmenge aber unglaublich kostbar – sie kann zu einer Frage von Leben und Tod werden. Ein Wohltäter kann also seinen Überschuss an einen Bedürftigen abgeben, wobei die Kosten für ihn selbst minimal sind, während der Empfänger davon einen gewaltigen Nutzen hat. Einer Vampirfledermaus liefert ein Blut-Festmahl auf einem Tier mehr als genug für den Lebensunterhalt; ein Individuum, das erfolgreich nach Nahrung gesucht hat, kann also Nahrung an eine andere, weniger glückliche Fledermaus abgeben, die ansonsten verhungert wäre. Später, wenn das Glück auf der anderen Seite steht und der ursprüngliche Empfänger einen Überschuss besitzt, kann er den Gefallen erwidern, wobei sich wiederum der größtmögliche Nutzen ergibt. Gegenseitiger Altruismus ist also eine Form von Vermögensaustausch, und jeder Spender erhält für seine Investition eine beträchtliche Rendite.
Mit solchen Methoden haben beide Seiten aus einem Überschuss, der zu unterschiedlichen Zeiten anfällt, den größtmöglichen Nutzen gezogen. Deshalb wird ein solches Verhalten auch häufig als verzögerter Altruismus bezeichnet. Konkurrenz gilt als Nullsummenspiel: Wenn ein Individuum gewinnt, muss ein anderes verlieren. Für Kooperation gilt das aber nicht. Von ihr können beide Seiten profitieren, und das oftmals in beträchtlichem Maße. Einer solchen Dynamik bedienen sich nicht nur die Vampirfledermäuse, sondern auch die Frühmenschen, die Nahrung und andere Ressourcen teilten oder sich gegenseitig Dienste erwiesen. Raihani formuliert es so: »Der gegenseitige Altruismus ist als Triebkraft der Kooperation von so zentraler Bedeutung, dass es in der Sprache eine Fülle von Ausdrücken gibt, die ihn umschreiben. ›Eine Hand wäscht die andere‹; ›Gutes mit Gutem vergelten‹. Auch der lateinische Ausdruck quid pro quo lebt noch heute weiter. ›Eine Hand wäscht die andere‹ gibt es auch im Italienischen, und das spanische hoy por ti, mañana por mí bedeutet ›heute für dich, morgen für mich‹«27.
Wenn man aber altruistisch Ressourcen oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt und damit anderen hilft, ergibt sich zwangsläufig ein Problem: Man kann nicht sicher sein, dass der Gefallen in Zukunft erwidert wird, das heißt, man läuft Gefahr, ausgenutzt zu werden. Betrüger können die unterschiedslose Großzügigkeit missbrauchen, und am Ende zahlt einer den Preis für die Hilfeleistung, erhält aber im Gegenzug kaum einen Nutzen. Damit das System funktioniert, müssen Schnorrer in Schach gehalten werden: Wer nichts zurückgibt, wird bestraft, indem man ihm das nächste Mal die Hilfe verweigert. Nur so besteht ein Anreiz für kooperatives Verhalten beruhend auf Gegenseitigkeit. Wenn sich der Empfänger weigert, die Freundlichkeit zu erwidern, sobald das Schicksal in die andere Richtung geht – mit anderen Worten: wenn er betrügt –, muss der erste Altruist sich daran erinnern und darauf verzichten, in Zukunft noch einmal zu helfen: Gebranntes Kind scheut das Feuer. Eine solche Verhaltensstrategie des »Zug um Zug« findet man ebenfalls bei manchen Tierarten: Bei Raben hat man beispielsweise beobachtet, dass sie anderen Individuen nicht mehr helfen, wenn diese sie in der Vergangenheit betrogen haben.28
Freundschaft und das Paradox des Bankers
Ständig mental darüber Buch zu führen, welche Individuen sich in der Vergangenheit für Freundlichkeiten erkenntlich gezeigt haben, ist aber mit einer beträchtlichen kognitiven Anstrengung verbunden. Dafür hat die Evolution des Menschen eine Lösung entwickelt. Nach mehrfachem gegenseitigem Austausch von Gefallen mit derselben Person überwachen wir die Beziehung nicht mehr so genau – oder anders gesagt, wir vertrauen einander, und die Beziehung wird zu einer tieferen Bindung: zu Freundschaft. Ein Freund oder eine Freundin gilt in anderen gesellschaftlichen Wechselbeziehungen als vertrauenswürdig, hilfreich und verbündet, und wir geben es auf, mentale Bilanzen über das Verhalten des anderen zu erstellen. Wir erwarten oder fordern nicht mehr ausdrücklich, dass ein bestimmter Gefallen zurückgezahlt wird. Die Bindung ist eine eigenständige Versicherung der Wechselseitigkeit und damit eine Investition in die Zukunft.29 Natürlich wissen wir, dass Freundschaften schiefgehen können, aber das geschieht nur, wenn ein Partner über längere Zeit mehr nimmt, als er gibt.
Freundschaftsbande werden biologisch durch das Oxytocin vermittelt, ein Hormon, das bei allen Säugetieren dafür sorgt, dass Mütter ihre Jungen versorgen; beim Menschen stärkt es die Paarbindung zwischen Sexualpartnern, damit die Beziehung so lange bestehen bleibt, dass man Kinder erfolgreich gemeinsam großziehen kann (auf das Thema werden wir in Kapitel 2 zurückkommen). Freundschaft unter Menschen ist eine Ausweitung dieser engen Beziehung zwischen Eltern und ihren Nachkommen: Auch zu denen, mit denen wir regelmäßig in Austausch treten, gehen wir eine enge Bindung ein. Wegen dieser neurochemischen Bindung ist Betrug durch einen engen Freund erheblich schmerzhafter, als wenn wir von einem Fremden betrogen werden.
Das Band der Freundschaft dürfte möglicherweise vor allem die Lösung für ein Problem darstellen, das als Paradox des Bankers bekannt ist. Wenn wir vor dem finanziellen Ruin stehen und besonders dringend ein Darlehen brauchen, wird die Bank uns wahrscheinlich keines geben, weil wir ein entsetzlich hohes Kreditrisiko darstellen. Läuft dagegen alles glatt, bietet die Bank uns nur allzu gern Mittel an.
Die gleiche Dynamik war in der Welt unserer Vorfahren auch ein tiefgreifendes Problem für den gegenseitigen Altruismus. Individuen erhalten mit geringster Wahrscheinlichkeit Hilfe, wenn sie am stärksten darauf angewiesen sind, denn dann sind sie auch am wenigsten in der Lage, in absehbarer Zeit den Gefallen zu erwidern. Welcher Anreiz sollte für jemanden, der nicht mit uns verwandt ist, bestehen, uns zu Hilfe zu eilen, wenn doch die Chance, dass wir die Unterstützung erwidern können, unglaublich gering ist? Eine Lösung für dieses Dilemma ist die Evolution der Freundschaft. Die vom Oxytocin vermittelte Bindung zwischen befreundeten Menschen sorgt dafür, dass beide füreinander unersetzlich sind. Wenn ein Freund ernsthaft erkrankt, geben wir ihn nicht herzlos auf, um einen anderen zu finden, mit dem wir gegenseitigen Altruismus betreiben können, sondern wir haben ein emotionales Interesse an seinem Wohlbefinden, und das zwingt uns, ihm beizustehen. Ein Freund in Not ist ein wahrer Freund. Auf diese Weise könnte sich die Freundschaft unter Menschen in der Evolution als eine Art Versicherung gegen schlechte Zeiten entwickelt haben.30
Aus dem Tierreich kennen wir einige Beispiele für gegenseitigen Altruismus – darunter die Vampirfledermäuse –, außergewöhnlich stark verbreitet ist er aber bei uns Menschen. Er ist die Erklärung für einen großen Teil der Großzügigkeit und Kooperation, die wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen beobachten. Das gilt insbesondere in kleinen, engen Gemeinschaften, in denen eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass Einzelne sich erneut begegnen, sodass altruistische Taten vergolten werden können.
Ein wirklich außergewöhnlicher Aspekt im Verhalten der Menschen ist aber ein charakteristisches Kennzeichen unserer Spezies, das sich von allen anderen Tieren unterscheidet: unsere Neigung, uns auch dann zu helfen, wenn wir nicht mit regelmäßigen Interaktionen und einer Erwiderung des Gefallens rechnen können. Also die Freundlichkeit gegenüber Fremden. Menschen bieten oftmals Hilfe bereitwillig auch denen an, die ihnen nie zuvor begegnet sind und bei denen sie auch eigentlich nicht damit rechnen können, ihnen jemals wieder zu begegnen. Wie lassen sich solche einseitigen Akte der Freundlichkeit erklären? Verwandtenselektion und gegenseitiger Altruismus können nicht die Ursache sein. An dieser Eigenart unserer Spezies müssen noch andere Faktoren mitgewirkt haben.
Eine mögliche Erklärung liegt in einem evolutionären Missverhältnis. Ursprünglich lebten die Menschen in kleinen Gruppen, in denen die meisten Individuen miteinander verwandt waren. Unter solchen Umständen lassen sich großzügige Handlungen unter den Stammesgenossen leicht mit Verwandtenselektion und gegenseitigem Altruismus erklären, die wir ja schon kennengelernt haben: Entweder hilft man Kopien der eigenen Gene, oder man interagiert immer wieder mit denselben Personen, sodass ein Gefallen erwidert werden kann. Eine solche einfache Evolutionsstrategie funktionierte aber weniger gut, als die Menschen erstmals in größeren, komplizierteren Gesellschaften lebten, und insbesondere als immer größere Bevölkerungsgruppen sich in einem städtischen Umfeld niederließen, in dem flüchtige Interaktionen mit Fremden, zu denen keine familiäre Beziehung bestand, die Regel waren. Auf meinem morgendlichen Spaziergang zur Arbeit begegne ich auf der Straße mehr Fremden, als meine Vorfahren, die Jäger und Sammler, sie vermutlich während ihres ganzen Lebens getroffen haben. Und doch kooperieren wir immer noch meist mit anderen Menschen in unserem Umfeld, auch wenn wir daran kein genetisches Eigeninteresse mehr haben.
Unser Geist hat sich in der Evolution dazu entwickelt, Verhaltensweisen voranzutreiben, die unter den Lebensbedingungen unserer Vorfahren mit ihren kleinen, auf Verwandtschaft basierenden Gemeinschaften in der afrikanischen Savanne der Anpassung dienten. Und als sich dann die soziale Umwelt umfassend wandelte, erhielt dieses kognitive Betriebssystem kein Software-Update. Unsere altruistischen Neigungen wurden also nicht auf unsere evolutionär neuartige Welt abgestimmt. So kam es zu der auf den ersten Blick unverständlichen Verhaltensweise, Fremden zu helfen, wenn der Gefallen niemals erwidert wird.31
Es gibt aber noch eine bessere Erklärung dafür, warum die Menschen in so großem Umfang kooperativ sind, auch wenn sie keine unmittelbare Gegenleistung erwarten können – und damit lässt sich dieses scheinbar paradoxe Verhalten auch überzeugend begründen, ohne dass man es nur als Überbleibsel einer evolutionären Programmierung betrachten muss.
Indirekte Gegenseitigkeit
Der Begriff der indirekten Gegenseitigkeit besagt, dass ein Gefallen nicht gegenüber demselben Altruisten erwidert wird, sondern der Nutznießer gibt ihn an andere weiter. A hilft B, der dann C hilft, der seinerseits D hilft, und so fort. Der Gefallen wird in der Gemeinschaft weitergetragen, bis er früher oder später zu A zurückkehrt. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Das Ganze hat noch eine weitere Ebene: Ein anderes Individuum, das Zeuge der ursprünglichen Freundlichkeit von A gegenüber B geworden ist, weiß jetzt, dass A großzügig ist, und will zu diesem eine Beziehung aufbauen: Z hilft A. Anders als bei der unmittelbaren Gegenseitigkeit müssen zwei Individuen sich dabei kein zweites Mal begegnen, sondern sie profitieren vom altruistischen Verhalten der ganzen Gruppe. Hilfsbereite Menschen erhalten selbst häufiger Hilfe, während Schnorrer, die anderen die Hilfe verweigern, bestraft werden.32 Diese indirekte Gegenseitigkeit ist eine einzigartig hochentwickelte Form der Kooperation unter Menschen.33 Damit das System funktioniert, sind zwei entscheidende Abläufe erforderlich, die es bei anderen Tieren nicht gibt.
Erstens muss es nicht nur Zeugen geben, die eine Interaktion beobachten und feststellen, ob eine Seite großzügig oder egoistisch handelt, sondern diese wertvolle Information über das Verhalten von Einzelnen muss auch in einen gemeinsamen Informationsschatz der ganzen Gruppe einfließen. Mit anderen Worten: Die Mitglieder einer Gemeinschaft müssen tratschen. Wenn ein Individuum in den Ruf gerät, unzuverlässig zu sein oder immer egoistisch Freundlichkeiten anzunehmen, ohne aber selbst anderen zu helfen, geizen die Mitglieder der Gemeinschaft einfach das nächste Mal ebenfalls mit ihrer Unterstützung, wenn der Schwindler etwas braucht. Zwar stimmt es nicht, dass »Betrug sich niemals auszahlt« – oft kommt ein Betrüger insbesondere in größeren, anonymeren Gemeinschaften auf kurze Sicht davon –, aber früher oder später wird er ertappt, und sein Ruf ist beschädigt. Klatsch und Tratsch ist also eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass indirekte Gegenseitigkeit nicht durch Schnorrer zu stark belastet wird, und so ist er in den Kulturen der Menschen auch allgegenwärtig, vom Lagerfeuer der Jäger und Sammler bis zur Kaffeemaschine im Büro. Tratsch und Gerede ersetzen sogar andere Tätigkeiten wie das gegenseitige Kraulen, die bei Primaten der Festigung von Beziehungen dienen.
Diese umfangreiche Weitergabe von Informationen über das Verhalten jedes Einzelnen in der Gemeinschaft – ähnlich einem durch Gerede vermittelten sozialen Netzwerk – schafft ein System, in dem der Ruf jedes Einzelnen und damit seine Eignung für Kooperation festgelegt wird. Die natürliche Selektion begünstigt Individuen, die freundlich handeln, deshalb hat sich die Psyche des Menschen in der Evolution so herausgebildet, dass uns sehr viel an unserem Ruf liegt. Tratsch bildet das soziale Mittel, durch das wir fair spielen.
In einer tratschenden Gesellschaft lautet daher die erste Lebensregel: Achte darauf, was du tust – oder, noch wichtiger: Achte darauf, was andere davon halten, was du tust.34 Damit wurde die Gesellschaft der Menschen zu einer Ansammlung von Gedanken, die andere Gedanken nachvollziehen: Wir stellen Vermutungen darüber an, welche Motive und Einstellungen andere haben könnten und wie sie wahrscheinlich unsere Handlungsweise wahrnehmen. So können wir unseren Ruf besser steuern. Seinen Ausdruck findet dies im Gewissen, unserer inneren Stimme, die uns warnt, jemand könne zusehen, und die uns deshalb bedenken lässt, wie andere unsere Handlungen vermutlich wahrnehmen. Damit versuchen wir, gesellschaftlicher Bestrafung zuvorzukommen.35
Der zweite entscheidende Faktor, der indirekte Gegenseitigkeit erleichtert, ist die Bestrafung von Betrug. Bei den wiederholten Eins‑zu-eins-Interaktionen der unmittelbaren Gegenseitigkeit, die wir zuvor betrachtet haben, erinnert sich ein Individuum, ob es von einem anderen schon einmal betrogen wurde, und kann ihm das nächste Mal die Hilfe verweigern. Auch Schimpansen nehmen bekanntermaßen Rache für Handlungen, die ihnen persönlich zum Nachteil gereicht haben.36 Eine andere Verhaltensweise dagegen gibt es ausschließlich bei Menschen: Hier kann auch eine dritte Partei, die nicht unmittelbar an einem Akt der Ausnutzung beteiligt war, sich entschließen, den Betrug zu bestrafen, ohne selbst daraus materiellen Gewinn zu ziehen – so etwas bezeichnet man als altruistische Bestrafung oder Bestrafung durch Dritte.37
Das Verhalten der altruistischen Bestrafung lässt sich bei Menschen mit einfachen Wirtschaftsplanspielen untersuchen. In dem Spiel, von dem hier die Rede sein soll, trägt eine Gruppe von Teilnehmern zu einem gemeinsamen Ergebnis bei, das für alle mit einem Vorteil verbunden ist – zu einem Gemeingut, wie man es auch nennt.
Solche kooperativen Projekte sind in den Gesellschaften der Menschen allgegenwärtig: von der Jagd auf ein großes Tier über den Bau und die Instandhaltung eines Kanalsystems zur Bewässerung von Feldern bis zur Errichtung eines Rathauses. Die Geschichte der Zivilisation ist eine Geschichte von Menschen, die zu Gemeingütern beigetragen haben, und je weiter die Zivilisation fortschritt, desto stärker nahmen auch Zahl und Komplexität dieser Gemeingüter zu.38 Städte und Staaten bieten Dienstleistungen wie die Instandhaltung von Straßen, die Versorgung mit sauberem Wasser, Notdienste, Bildung und Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und eine gemeinsame nationale Verteidigung. Die Ergebnisse kommen der gesamten Gemeinschaft zugute, aber die Kosten werden nur von denen getragen, die sich daran beteiligt haben.
Gemeingüter sind aber auch stets gefährdet: Sie können von Drückebergern untergraben werden, denn die kommen unter Umständen damit davon, wenn sie wenig oder nichts zum gemeinsamen Projekt beitragen und dennoch den Lohn einstreichen.
Beim hier beschriebenen Spiel um die Gemeingüter erhält jeder Mitspieler eine bestimmte Summe und kann in jeder Runde entscheiden, wie viel er davon in einen gemeinsamen Topf werfen will. Am Ende der Runde können die Spieler einstreichen, was in ihrem persönlichen Topf übriggeblieben ist, und der gemeinsame Topf wird durch einen bestimmten Faktor (der zwischen 1 und der Zahl der Mitspieler liegt) dividiert und dann gleichmäßig aufgeteilt. Das bestmögliche Ergebnis für die ganze Gruppe kommt zustande, wenn alle Spieler ihren gesamten Topf einzahlen, sodass jeder auch den größtmöglichen Betrag zurückbekommt. Ein Schnorrer kann aber betrügen und daraus Gewinn ziehen: Er zahlt nichts ein und behält nicht nur seinen eigenen Topf, sondern auch die Dividende aus der Großzügigkeit aller anderen.
Bei der Mehrheit solcher Spiele zahlen die meisten Mitspieler ungefähr die Hälfte ihres persönlichen Budgets in den gemeinsamen Topf ein – eine vernünftige, vorsichtige Herangehensweise. Wenn die Beteiligten allerdings bemerken, dass einige von ihnen nur sehr wenig oder gar nichts zu der gemeinschaftlichen Summe beitragen, sinken auch die Beiträge aller anderen von Runde zu Runde bis auf Null,39 und das Gemeinschaftsprojekt bricht durch die egoistischen Handlungen von Schnorrern komplett zusammen.
Mit einer einfachen Abwandlung der Spielregeln kann man aber die Kooperation stärken und das gemeinsame Projekt zum Nutzen aller retten: Ein zusätzlich eingeführtes Sanktionssystem führt dazu, dass die Spieler einen Teil ihres eigenen Spielgeldes einsetzen, um das Einkommen derer zu mindern, die nach ihrem Eindruck getäuscht haben – sie können beispielsweise einen Euro zahlen und damit den Gewinn eines Betrügers um drei Euro senken. Durch eine solche altruistische Bestrafung verändert sich die Dynamik des Spiels radikal. Jetzt beobachtet man im Allgemeinen hohe individuelle Beiträge zum gemeinsamen Ziel – manchmal über 70 Prozent des Betrages, der jedem Mitspieler zur Verfügung steht. Auf dieser Höhe bleiben sie auch in einer Spielrunde nach der anderen. Anscheinend sind Menschen bereit, einen persönlichen Preis zu bezahlen, um Betrüger zu bestrafen. Eine solche altruistische Bestrafung schreckt Schnorrer sehr effizient ab und fördert gleichzeitig insgesamt die Kooperation in der Gruppe. Im realen Leben ist es genauso: Unverbesserliche Betrüger, die mit egoistischen oder unsozialen Handlungen die Gemeinschaft sabotieren, riskieren Bestrafung. Ihnen werden Wohltaten verweigert, man grenzt sie sozial aus, oder sie werden sogar zum Ziel aktiver Gewalt.
Hinter der altruistischen Bestrafung steckt offensichtlich eine angeborene, emotionale Triebkraft – die Spieler berichten über empörte oder verärgerte Gefühle gegenüber Schnorrern und über den impulsiven Wunsch, sie zu bestrafen.40 Wie sich in Studien herausgestellt hat, löst die gerechte Bestrafung von Personen, die betrügen oder andere unfair behandeln, in den Belohnungszentren des Gehirns die gleiche Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin aus wie beispielsweise die Sättigung bei Hunger oder Durst, sexuelle Aktivität oder Brutpflege. (Auf das Dopaminsystem werden wir in Kapitel 6 zurückkommen.) Diese Welle des dopaminergen Vergnügens veranlasst uns, den Aufwand für eine verdiente Bestrafung anderer auf uns zu nehmen.41 Kooperation und soziales Verhalten werden also bei Menschen anscheinend durch eine eigenständige, angeborene Belohnung begünstigt.42