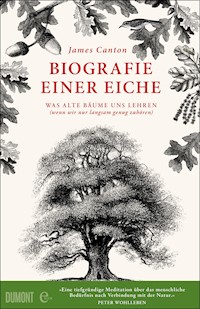
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
James Canton besucht die achthundert Jahre alte Honywood-Eiche in Essex. Sie war ein Schössling, als die Magna Carta unterzeichnet wurde und König Johann England regierte. Heute bildet sie ein eigenes Ökosystem, in dem unzählige Insekten, Vögel und Fledermäuse, Moose, Farne und Pilze leben. Eichen sind zu Mythen und Legenden geworden. In vielen Religionen spielen sie eine besondere Rolle, und für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation waren und sind sie von großer Bedeutung. Wir bauten unsere Häuser und Schiffe aus ihrem Holz, schürten unsere Feuer damit und mahlten ihre Eicheln in Zeiten der Hungersnot zu Mehl. ›Biografie einer Eiche‹ ist ein Buch über die Lehren, die wir aus der Natur ziehen können, wenn wir nur langsam genug zuhören. »Eine Betrachtung über das Finden von Verbindungen in einer unzusammenhängenden Welt« THE INDEPENDENT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Ähnliche
»Ein Buch, zu dem man immer wieder zurückkehrt. Durch die Lektüre versteht man mehr und mehr, dann vergisst man sich selbst, dann findet man heraus, wer man ist.«
DAILY TELEGRAPH
JAMES CANTON besucht die achthundert Jahre alte Honywood-Eiche in Essex. Sie war ein Schössling, als die Magna Carta unterzeichnet wurde und König Johann England regierte. Heute bildet sie ein eigenes Ökosystem, in dem zahllose Insekten und Vögel, Fledermäuse und Moose, Farne und Blumen leben. Eichen sind zu Mythen und Legenden geworden. In allen Religionen spielen sie eine besondere Rolle und für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation waren und sind sie von großer Bedeutung. Wir bauten unsere Häuser und Boote, schürten unsere Feuer mit ihrem Holz und mahlten ihre Eicheln in Zeiten der Hungersnot zu Mehl. ›Biografie einer Eiche‹ ist ein Buch über die Lehren, die wir aus der Natur ziehen können, wenn wir nur langsam genug zuhören.«
JAMES CANTON leitet seit 2009 den Wild Writing MA an der University of Essex. Er unterrichtet Creative Writing mit besonderem Schwerpunkt auf narrativer Non-Fiction. Zudem schreibt er für Zeitungen und ist regelmäßig Gast im britischen Fernsehen und Radio. Bislang hat er drei Bücher veröffentlicht. ›Biografie einer Eiche‹ ist das erste Buch, das von ihm auf Deutsch erscheint.
SOFIA BLIND lebt als Autorin, Übersetzerin und Gärtnerin im Lahntal. Bei DuMont erschien zuletzt ihr Buch ›Die alten Obstsorten‹ (2020). Außerdem übersetzte sie u.
James Canton
BIOGRAFIEEINER EICHE
Was alte Bäume uns lehren(wenn wir nur langsam genug zuhören)
Aus dem Englischenvon Sofia Blind
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel»The Oak Papers« bei Canongate Books Ltd, Edinburgh.
© James Canton, 2020
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Sofia Blind
Lektorat: Kerstin Thorwarth
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Eichenblüte: © akg-images / bilwissedition, Eichenprachtkäfer: © The Book Worm / Alamy Stock Foto, Gartenbaumläufer: © gameover / Alamy Stock Foto
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-7120-9
www.dumont-buchverlag.de
Für Eva, Molly und Joe
Anfänge
Vor ungefähr fünf Jahren suchte ich Trost vom Lauf der Welt, indem ich mich von einer alten Eiche umfangen ließ. Es handelt sich um einen verehrungswürdigen Baum, achthundert Jahre alt, der auf einem kleinen Landgut am Waldrand wächst, wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Aus diesem ersten Treffen erwuchs ein seltsames Gefühl der Nähe, das ich erst bewusst wahrnahm, als ich erkannte, welche Bedeutung Bäume, insbesondere Eichen, für unser Leben haben können. Anfangs ging ich einfach wegen des sanften Trostes hin, den das Sitzen neben diesem prachtvollen Baum lieferte. Ich konnte meine Arbeit als Dozent, mein Leben und meine Verantwortung hinter mir lassen und mich in eine Welt begeben, die etwas vom Garten Eden hatte. Ich konnte meine eigene Welt verlassen und in die der Eiche eintreten. Ich fühlte, wie sich Ruhe auf mich herabsenkte. Sobald ich dort war, wollte ich nur noch das Hin und Her der Vögel beobachten, der Bienen und der anderen Lebewesen, die das Ökosystem im Inneren und in der Umgebung dieser uralten Eiche bildeten. Ich fühlte, wie Frieden mich jedes Mal überflutete, wenn ich das Landgut betrat, auf dem die Eiche lebt. In den folgenden Monaten fing ich an, die Eiche zu besuchen, wie man eine Freundin besucht. Ich wurde mit ihr vertraut. Ich lernte ihre Eigentümlichkeiten kennen und die Geschöpfe, die in ihrem Reich lebten. Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit saß ich an der Eiche, zu jeder Tages- und Nachtstunde, bis ich diesen Baum kannte wie ein Familienmitglied.
Inzwischen sind Jahre vergangen, und im Rückblick kann ich erkennen, was mit mir geschah. Es gab noch einen weiteren Grund, warum ich die Umarmung jener Eiche suchte. Damals war die Beziehung zu meiner langjährigen Partnerin brüchig geworden und begann, sich aufzulösen. Jeder von uns lebte sein eigenes Leben. Und irgendwoher kam mir die Idee, Zeit an der Honywood-Eiche zu verbringen. Heute kann ich nicht mehr sagen, ob sie dem Wunsch entsprang, mein Zuhause zu meiden, oder dem Bedürfnis nach Einsamkeit. In Wahrheit dürfte beides eine Rolle gespielt haben.
—
Wo immer auf diesem Planeten Eichen wachsen, haben die Menschen eine Beziehung zu ihnen entwickelt. In der gesamten Menschheitsgeschichte wurden außergewöhnliche Eichen geschätzt – wegen ihrer Lage, ihres Alters, ihrer Größe. Eichenveteranen waren immer etwas Besonderes. Menschen versammeln sich unter ihren Kronen. Vielleicht treffen sie sich dort, weil es sich um bedeutende Orte in der Landschaft handelt, vielleicht auch einfach, um Schutz zu suchen. Wir Menschen sind Geschöpfe der Bewegung, Eichen statische Wesen. Sie verlagern ihren Standort nicht. Sie werden auf genau dem Fleckchen Erde geboren, auf dem sie auch sterben. Diese Standfestigkeit macht sie so reizvoll. Alte Eichen strahlen ein kraftvolles Gefühl von Langlebigkeit aus. Dieses Gefühl der Sicherheit, der Zugehörigkeit zu einem einzigen Ort über die Zeit hinweg bezaubert uns. Wir fühlen uns zu alten Eichen hingezogen. Unter einem prächtigen Eichenbaum stehen wir in dem Wissen, dass unsere fernen Vorfahren das Gleiche taten. Eichen bewahren die Erinnerungen früherer Generationen. Wenn wir über ihre Rinde streichen, können wir einen flüchtigen Hauch all derer spüren, die schon gegangen sind.
Menschen und Eichen leben seit uralten Zeiten als Nachbarn zusammen und tun das weiterhin. Wir brauchen die Stämme der Eichen nicht mehr, um unsere Häuser zu bauen oder unsere Feuer zu nähren, und wir brauchen keine Eicheln mehr, um uns während harter Jahre und magerer Ernten zu ernähren. Dennoch stützen wir uns auf einer anderen Ebene nach wie vor auf Eichen. Auf eine Art und Weise, die wir selbst nicht ganz verstehen, brauchen wir sie.
Teil 1
DIE EICHE SEHEN
Die Honywood-Eiche lebt auf dem Landgut Marks Hall Estate im Norden von Essex. Der Baum steht in einer eigenen runden Umzäunung: Eine niedrige Einfriedung aus Holz trennt die alte Eiche von den Kiefern ringsum. Die Eiche wächst hier seit achthundert Jahren oder länger. Ihr Stamm ist knorrig und gerippt, er hat einen Umfang von mehr als acht Metern. Ihr weit ausgebreitetes grünes Blätterdach streckt sich dreißig Meter hoch in den Frühlingshimmel. Der Baum war noch ein Schössling, als die Magna Charta unterzeichnet wurde und König Johann England regierte. Als Vierhundertjähriger schützte er mit seiner Krone die Soldaten im Englischen Bürgerkrieg. Damals war Sir Thomas Honywood der Besitzer von Marks Hall, ein Anführer der Parlamentsanhänger, der 1648 an der Belagerung der nahe gelegenen Stadt Colchester teilnahm; später wurde diese prachtvolle alte Eiche nach ihm benannt.
—
Einst gab es auf diesen Ländereien viele Eichen, Hunderte dicht aneinandergedrängter alter Bäume. Heute gibt es hier nur noch eine. Eine einzige, einsame Gestalt, die auf genau diesem Quadratmeter Erde vor achthundert Jahren geboren wurde und in einem Wimpernschlag der Zeit von einer Eichel zu einem mächtigen Baum heranwuchs. Eines Tages kam ich, um diese Eiche zu sehen, die vor so langer Zeit, so weit jenseits der Erinnerung jedes lebenden Menschen geboren wurde. Ich saß in ihrer Gegenwart und wusste: Hier herrscht Frieden.
Neben dem Kutschenhaus, wo ich bei jedem Besuch mein Auto parkte, gelangt man durch ein einfaches Holztor ins Herz des Landguts. In jenem Augenblick, in dem ich durch dieses Tor trat, geschah etwas wahrhaft Magisches, eine Form der Verwandlung, die es mir erlaubte, alle Sorgen abzuwerfen, die sich auf meinen Schultern angehäuft hatten. Jenseits des Tores erwartete mich eine andere Welt.
Gleich hinter dem Tor befindet sich ein Obstgarten, durch den ich immer zu dem Bach hinunterging, der sich durch das Landgut schlängelt. Ein gewundener Pfad führt zu einer Steinbrücke neben einem See. Jenseits davon steht die Honywood-Eiche. Das Ritual dieses kurzen Spaziergangs fühlte sich an wie der Weg zurück ins Paradies. Durch das Tor in den Obstgarten, hinunter zum See, über die Brücke, hinauf zur alten Eiche. Die Reise dauerte nur ein paar Augenblicke. Aber in dieser kurzen Zeit fiel jegliche Bürde von mir ab.
21.Juni
Ich werde von Jonathan Jukes begrüßt, einem ruhigen, bescheidenen Menschen. Seine Berufsbezeichnung lautet »Baumkonservator«. Wir gehen vom Kutschenhaus hinunter ins Tal und über die Steinbrücke. Ich schaue zur Eiche hinüber, während Jonathan mir die Geschichte der dreihundert anderen alten Eichen erzählt, die ebenfalls auf diesen Ländereien wuchsen und einst zu einem riesigen Wildpark gehörten. In den 1950er-Jahren wurde dieser Eichenbestand wegen seines wertvollen Holzes fast vollständig gefällt. Vier jüngere, etwa dreihundert Jahre alte Bäume neben dem Garten des Wildhüterhäuschens wurden verschont. Sie leben noch heute. Der verbrannte Rest eines weiteren alten Baumes, der »Schreiende Eiche« genannt wird, ist verkrüppelt und entstellt, konnte aber dennoch Leben in seinen Ästen bewahren. Nur eine der wahrhaft alten Eichen blieb verschont: die Honywood-Eiche. Sie ist die einzige intakte Überlebende.
Die Honywood-Eiche wächst an der Grenze eines Gebiets, das einst aus tausend Hektar uralten Waldes bestand. Warum ausgerechnet diesem Baum Axt und Säge erspart blieben, ist ein Rätsel. Der Mann, der am längsten darüber nachgedacht hat – Jonathan Jukes, der heutige Hüter dieses anmutig alternden Baumes –, glaubt, der Baum müsse für Thomas Phillips Price, den damaligen Eigentümer des Landguts, eine besondere Bedeutung gehabt haben.
»Es könnte gut sein, dass Phillips Price die Aussicht auf die prächtige Krone vom Fenster im Obergeschoss des Haupthauses aus gefiel«, vermutet Jonathan. »Ein Foto aus jener Zeit zeigt eine Bank, die an den Eichenstamm gelehnt ist.«
Er könnte es genossen haben, unter dem Schirm aus Eichenlaub zu sitzen, der sich in jedem Frühjahr entfaltete – einen kurzen Moment im kühlen Schatten des Baumes zu verbringen, geschützt vor der sommerlichen Sonnenhitze. Thomas Phillips Price starb 1932. Das Haupthaus verfiel und wurde 1950 abgerissen. Die Wahrheit ist: Kein lebender Mensch weiß, warum ausgerechnet dieser alte Baum als Einziger den Kahlschlag der dreihundert anderen alten Eichen überlebt hat, die viele Jahrhunderte lang glücklich und zufrieden in dieser abgelegenen Ecke Englands vor sich hin gelebt hatten.
Es ist ein klarer Sommertag mit blauem Himmel. Die Kiefern, zwischen denen wir stehen, wurden als Ersatz für die Eichen gepflanzt. In dieser kurzen Zeitspanne sind sie bis auf die Höhe der Honywood-Eiche emporgeschossen und dominieren jetzt die Landschaft. Wir wandern durchs Unterholz dieser jungen Kiefernplantage. Eine Horde Schweine war hier losgelassen worden, um das störrische Brombeergeflecht abzufressen, das sich im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Die Schweine haben den Boden sauber gefegt wie ein Staubsauger. Inzwischen, anderthalb Jahre nach dieser Grundreinigung, ist neues Leben entstanden. Prächtiger rosaroter Fingerhut ragt aus dem Boden; jahrelang schlummernde Samen sind jetzt ausgekeimt.
Jonathan erzählt von den 1950ern, als Trupps von Holzfällern im Wald auftauchten. Eine ortsansässige Firma namens Mann’s führte die Arbeiten durch, die Wochen oder gar Monate gedauert haben müssen. Ich versuche, mir die Szenerie vorzustellen. Das Hacken und Sägen mit langstieligen Äxten und gespannten Zweimannsägen, die sich hin und her in das tiefe Fleisch der Bäume weben – und damit ins Herz der Wälder.
In seiner Anatomie der Melancholie von 1621 verwendete Robert Burton die fast sprichwörtliche Zeile »eine alte Eiche wird nicht auf einen Streich gefällt«.1 Ein paar Jahrhunderte später beschreibt Thomas Hardys Gedicht »Throwing a Tree« das Fällen eines Baumes durch »zwei Henker«, die »zwei Äxte tragen, mit schweren Köpfen, glänzend und breit, / Und eine lange, schlaffe Zweihandsäge, gezähnt zum Schneiden«. Die letzte Zeile von Hardys Gedicht lautet:
»Und zweihundert Jahre währendes Wachstum endet in weniger als zwei Stunden.«2
Und wie lange dauerte es, eine achthundertjährige Eiche zu fällen?
»Neulich habe ich bei einer Beerdigung jemanden getroffen, der damals dabei war«, erzählt Jonathan, »der mitgeholfen hat, die uralten Bäume abzuholzen. Es könnte gut sein, dass es in den Dörfern hier noch andere gibt, die sich vor sechzig Jahren als junge Männer ein paar Schillinge verdienten, indem sie Bäume in Holz verwandelten.«
Wenn ja, werden sie jetzt alte Männer sein.
Ronald Blythe erzählte mir vor nicht allzu langer Zeit, dass die Landbevölkerung alte Eichen genau deshalb liebe, weil sie eine physische Möglichkeit bieten, mit den eigenen Vorfahren Zwiesprache zu halten und ihrer zu gedenken. Oft stehen sie im Zentrum des Dorflebens, entweder auf dem Dorfanger oder neben den ausgetretenen Pfaden, die sich an Hecken und Feldern entlangwinden. Diese Bäume dienen als Leitungen; sie verbinden uns mit denjenigen, die vor uns gegangen sind. Geliebte Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern früherer Generationen haben die zerfurchte Baumrinde an ebender Stelle berührt, an der jetzt lebendige Hände über die gleiche raue Haut streichen. In dem einfachen Akt des Berührens einer alten Eiche liegt ein Gefühl der körperlichen Verbundenheit und damit der kraftvollen Erinnerung.
»Man hat ihnen unrecht getan«, sagt Jonathan, während wir durch die flimmernden Schatten gehen.
Er spricht über die Eichen, die hier gefällt wurden, davon, dass man ihnen das Leben genommen habe. Wir sind wieder an der Honywood-Eiche angekommen. Der Baum hat ein hohes Alter erreicht. »Er wächst wieder nach unten«, sagt Jonathan. Wie die letzten überlebenden Holzfäller, die vor sechzig Jahren in diesen Wäldern ihre Äxte schwangen, richtet sich die Eiche auf einen friedlichen Lebensabend ein.
»Sie waren nicht alle so alt wie die Honywood-Eiche, oder?«, frage ich.
»Nein«, antwortet Jonathan. »Ich glaube nicht. Aber es gab einige von beachtlichem Alter, und mit Sicherheit waren ein paar Bäume größer.«
»Also noch älter als die Honywood-Eiche?«, frage ich.
»Ich denke schon«, sagt Jonathan.
Er erzählt, es gebe ein Verzeichnis aller bedeutenden Eichen, die einst auf diesen Ländereien gewachsen seien; es werde im Archiv von Marks Hall aufbewahrt. Nachdem Thomas Phillips Price das Gut 1897 kaufte, ließ er seinen Grundstücksverwalter alle größeren Eichen vermessen; ihre Höhe und ihr Umfang sind in Kladden verzeichnet, die heute noch besichtigt werden können.
»Dort bekommst du eine Vorstellung von der Größe und Gestalt der Eichen, die damals im Wildpark standen.«
Ich schaue mich um, sehe die hohen Gestelle der Kiefern ringsum. Ich versuche, uralte Eichen zu sehen. Es ist schwierig – schwierig, sich das Ausmaß des Verlusts vorzustellen.
»Sie hätten nie gefällt werden dürfen«, stellt Jonathan fest. »In Thomas Phillips Price’ Testament steht: ›Die Eichen dürfen niemals geschlagen werden.‹«
Aber es geschah dennoch.
Vor hundert Jahren trugen die alten Eichen von Marks Hall keine individuellen Namen; sie wurden kollektiv »die Honywood-Eichen« genannt. Irgendwann, nachdem diese Honywood-Eichen im Wildpark in den 1950ern ausgemerzt worden waren, wechselte der Name in den Singular.
Angesichts dieses Verlusts überkommt mich ein Gefühl echter Trauer.
Alte Eichen haben immer unsere Zuneigung geweckt, oft aber auch unsere Ehrfurcht. Francis Kilvert, der 1876 über den alten Eichenbestand von Moccas Park in Herefordshire schrieb, kannte diese gegensätzlichen Gefühle:
Ich fürchte diese grauen alten Männer von Moccas, diese grauen, knorrigen, finstergesichtigen, x-beinigen, gebeugten, krummen, riesigen, seltsamen, langarmigen, unförmigen, buckligen, missgestalteten Eichenmänner, die Jahrhundert um Jahrhundert dastehen und warten und wachen … Keines Menschen Hand setzte diese Eichen. Sie sind »starke Bäume, die der HERR gepflanzt hat«.3
Die Bäume werden zu »Eichenmännern«, seltsamen und angsteinflößenden Gestalten. Vielleicht liegt in einer solchen Verwandlung ihre Rettung. Göttlich sind sie auch noch. Niemand möchte heilige, von Gottes eigener Hand gesäte Wesen absägen und töten.
Mit jedem einzelnen alten Baum, der verloren geht, geht eine ganze Waldgemeinschaft unter. Jede ausgewachsene Eiche ist die Heimat einer komplexen, vielköpfigen Schar von Fledermäusen, Insekten, Vögeln, Pilzen und Pflanzen. Jonathan erklärt, eine alte Eiche funktioniere »wie ein Hochhaus«. William Cowper sah die Eiche in seinem Gedicht »Yardley Oak« von 1809 als »Eulenkluft«, als Wohnstätte dieser nachtaktiven Vögel.4 Aber nicht nur Eulen finden dort eine Heimat. Von Baumläufern bis zu Hornissen beherbergen alte Eichen eine so breite Artenvielfalt wie kein anderer Baum.5
Ich stehe im Wald und versuche angestrengt, mir die riesige verlorene Wildtierpopulation vorzustellen, die es hier gäbe, wenn jene Hundertschaften uralter Eichen immer noch auf diesem Stück Land stünden. Sie sind die Geisterwelt, die dieses Waldgebiet heimsucht.
3.Juli
In sanftem Sommerregen treffe ich mich mit Jonathan. Wir steigen über den niedrigen Schutzzaun und sprechen über das Leben der Eiche. Jonathan erzählt, in letzter Zeit sei viel über den plötzlichen Eichentod (Phytophthora ramorum) geschrieben und gesprochen worden. Er sorgt sich um die Gesundheit der Honywood-Eiche. Andere Bäume auf dem Gut haben schon schwarz blutende Flecken entwickelt – Geschwüre, die typische Symptome der Krankheit sind. Ein älterer Baum in der Nähe des Eingangs liegt bereits in den letzten Zügen. Andere, jüngere Eichen haben die Infektion überstanden und sich allmählich erholt. Niemand weiß, wie die Krankheit sich in den nächsten Jahren verbreiten wird. Wenn die Honywood-Eiche sich ansteckt, könnte sie ernste Probleme bekommen.
»In ein paar Jahren ist sie vielleicht tot«, sagt Jonathan.
Wir unterhalten uns noch für ein paar Minuten im Schutz der Eiche. Als Jonathan aufbricht, sehe ich seinen Wagen nach Westen durch die Kiefern entschwinden.
Ich stehe und schaue. Zum ersten Mal bin ich alleine hier neben dem Baum. Eine Zeit lang tue ich weiter nichts. Ich bin wie erstarrt. Dann streckt sich meine rechte Hand aus, bis ich die Eiche berühre. Ich streiche mit den Fingerspitzen, den Handflächen über die raue Rinde. Etwas geschieht. Ich fühle eine Leichtigkeit, die ich seit Ewigkeiten nicht in mir gespürt habe. Mein Herz schlägt langsamer. Mein Geist kommt zur Ruhe. Ich sehe mich um, ob jemand in der Nähe ist. Seltsamerweise fühlt es sich plötzlich wie ein Akt des Eindringens an, wie das unbefugte Betreten einer Tabuzone, in diesem holzumzäunten Rondell an der Eiche zu stehen. Ich bin mir der Gegenwart der Eiche neben mir zutiefst bewusst, aber auch besorgt, jemand könnte hinter der Wegbiegung zwischen den Kiefern auftauchen. Niemand kommt. Zögernd schließe ich die Augen.
Die Zeit vergeht.
Ruhe umfließt mich, als hätte jemand eine Decke um meine Schultern gebreitet.
Ein heiliger Frieden senkt sich herab.
Als ich die Augen wieder öffne, liegt in meinem Blickfeld nur die Eiche, die graue Rinde zerfurcht und ruhig, ganz ruhig. Ich fühle mich wie verzaubert. Ich blinzele, und jetzt wirkt die Eiche wie ein gewaltiges, entspanntes Mammut, das mit einschüchternder, riesenhafter Grazie vor mir steht. Auf der Rinde wölben sich Falten wie Elefantenhaut, und der dicke, nach Norden weisende Aststumpf wirkt wie ein Baumstamm, dessen riesige Äste fest im Boden verwurzelt sind.
Ein Hase taucht auf dem Weg am See auf, eines der letztjährigen Jungtiere. Er besteht nur aus Ohren; mager und zappelig, trabt er den Hang zu mir herauf, verschwindet aber zwischen den langen Gräsern und Farnen, mit denen die sanften Hänge des Bachtals bewachsen sind. Es ist ein Schnitt quer durch die Zeit, der bloßgelegt wird, ein Augenblick, in dem der normale Lauf des Lebens stillsteht, in dem stattdessen ein anderes Seinsgefühl meine Anwesenheit in der Welt zu erfassen und alles in Besitz zu nehmen scheint.
Buddhisten nennen solche flüchtigen Momente satori – wenn die Fassade unserer normalen Existenz zusammenbricht und wir das sehen, was dahinterliegt, die Möglichkeit der Erleuchtung spüren. Wir leben jeden Tag in dem – trügerischen – Gefühl, unsere alltägliche Reise durchs Leben unter Kontrolle zu haben und unseren geregelten Weg auf der Welt zu kennen. Dann, in solchen Momenten des Staunens, können wir nur stehen und schauen. Wir sehen das Alltägliche nicht mehr. Wir fühlen nur die eigene Präsenz, schwerelos wie Luft, unsere federleichte Existenz auf dieser Erde, flüchtig und fragil wie ein Samenschirmchen im Wind.
10.Juli
Der Frieden, die stille Präsenz der Eiche, zieht mich zu ihr zurück. Eine blassblaue Libelle segelt an der Bank vorbei. Ein ruhiger Sommertag. Ich schaue unverwandt den Baum an und stelle mir die Eiche als riesigen Kompass vor, an dem jeder gekappte Ast wie ein Zeiger die Position von Himmelskörpern am nächtlichen Firmament in wichtigen Momenten des Jahres anzeigt: den Sonnenaufgang am Mittsommertag; einen Venustransit; den hellen Punkt des Perseiden-Meteorstroms.
Ein Ast, der als Wegweiser zum Polarstern dient, wurde schon vor vielen Jahren gekappt, abgesägt. Ein Kreis aus Schwärze ist in die runde Abschlussfläche des hellen Holzes gefräst. Es ist eine Spechthöhle, und eine einzige Unterfeder klebt am Eingangsloch. Ein Regenschauer prasselt herab. Sonnenstrahlen zwängen sich durch die Wolken und treffen auf die Kiefern; sie lassen ihre Rinde leuchten und die Eichenblätter ergrünen, erhellen die Rindenbrocken und das freiliegende Kambium in verschatteten, gesprenkelten Hell-Dunkel-Mustern. Auf der Südseite der Eiche erweist sich das, was in fünf Metern Höhe zunächst wie ein Mückenschwarm aussah, als Bienennest. Mit dem Fernglas kann ich die Sechseckstruktur der Waben ausmachen und denke sofort an ihren engen Verwandten, das Fünf-Punkt-Rhombenmuster, jenes Urbild intelligenter Gestaltung, das Thomas Browne in seinem Buch The Garden of Cyrus (1658) als Beweis für die Existenz Gottes präsentierte.
17.Juli
Ein schwüler Sommertag. Ich bin absolut entzückt, hier zu sein, auf der Bank neben der Eiche zu sitzen. Alles andere auf der Welt ist irrelevant. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Mein Herz macht einen kleinen Hüpfer, als ich mich auf dem glatten Holz niederlasse. Ich schließe die Augen. Alles ist richtig. Alles ist gut.
Ich schaue auf und sehe, dass eine Brombeere aus einem Vorsprung an der Eiche sprießt, fünf Meter über der Erde. Auf der Bank werde ich von einer Fliege mit roten Augen, die eindeutig teuflisch aussieht, belästigt, gepiesackt und im Sturzflug attackiert. Schließlich lässt sie sich nieder und gestattet mir eine nähere Inspektion. Ich habe keine Ahnung, worum es sich handelt, habe aber Bestimmungsbücher dabei. Könnte es eine Luchsfliegenart sein? Vielleicht sogar Pandivirilia melaleuca, eine für ihr aggressives Temperament bekannte Fliege? Sie lebt tief im Inneren der Eiche im vermodernden Kernholz des alten Baumes – der Braunfäule. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist: Diese Fliege ruht sich gerade auf der Armlehne der Bank aus, mit riesigen roten, aus dem Kopf ragenden Kugeln als Augen, die in meinen vollkommen fremdartig aussehen.
Waldbrettspiele, eine Schmetterlingsart, taumeln durch die Wiesengräser wie Ascheflocken aus einem Scheiterhaufen. Die Luft ist sanft melodisch. Dies ist der erste sonnige Tag seit Wochen, und alle sind draußen, um die Hitze zu genießen, das Licht. Im Süden herrscht aufgeregt brummendes Kommen und Gehen am Nest der Wildbienen. Ich schreite den Kreis um den Baum ab. Mücken tanzen in den feuchten Hohlräumen zwischen den Wurzeln, wo die Sonne nicht hinkommt. Neben dem hellen Aststumpf, der nach Norden weist, kurvt eine Hornisse aus der Baumkrone, scharf und riesig vor dem azurblauen Himmel, und verschwindet dann in einer perfekten Parabel zurück in den Baum. Auf der Bank liegt ein Stapel von Büchern über Eichen. Ich habe eine kleine Bibliothek mitgebracht, betrachte aber stattdessen das Leben, das um die Eiche fliegt, huscht und summt. Nachdem das Wetter eine Ewigkeit lang jahreszeituntypisch feucht war, erwärmt sich die Welt.
—
Seit dem Ende des Tertiärs vor ungefähr 2,6Millionen Jahren gibt es Eichen auf der Erde. In Großbritannien wachsen sie seit mehr als einer Million Jahren. Während die Gletscher von Norden her vordrangen, verschob sich die Eichengrenze nach Süden; dann wurde das Land allmählich wieder wärmer, die Eisdecke schmolz, und die Eichen kamen zurück. Ihre letzte Rückkehr fand vor ungefähr zehntausend Jahren statt, zu einer Zeit, als die britische Ostküste noch mit dem europäischen Festland verbunden war. Während das Klima sich veränderte und die Temperaturen stiegen, verbreiteten sich die Eichen über Großbritannien und besiedelten die eisfreien Gebiete. Auch die Tiere kamen, gefolgt von den Menschen.
Die Geschichte des menschlichen Lebens ist auf der ganzen Nordhalbkugel eng mit Eichen verbunden. Feuersteinäxte wurden hergestellt, um Eichen zu fällen und zu spalten; außerdem schnitt man Kiefern und Haselsträucher in den prähistorischen Wäldern. Diese nacheiszeitlichen Urwälder, die in Großbritannien wildwoods, »wilde Wälder«, genannt werden, hatten nach dem Rückzug der letzten Gletscher das Land besiedelt und schließlich komplett erobert. Die zähen Gestalten damals speisten mit dem Urwaldholz jene Feuer, die den Winter von ihren Heimen fernhielten. Die Brandrodung und Abholzung von Kiefernwäldern diente auch dazu, Raum für neue Eichen zu schaffen. Vor etwa fünf- bis sechstausend Jahren stellten sich die Menschen von einer nomadischen, von den Jahreszeiten bestimmten Lebensweise auf Nutztierhaltung und Ackerbau um. Mit der Landwirtschaft begann die systematische Zerstörung der Urwälder, um das Land in die ersten Getreidefelder und Weiden für primitive Nutztiere umzuwandeln.
Eichen waren etwas Besonderes. Sie lieferten Feuerholz, aber ihre Stämme konnten auch als Stützen für die Häuser dienen, die aus dem frisch gerodeten Boden wuchsen. Und sie lieferten mehr als nur Holz. Sie produzierten Eicheln, die sich leicht aufsammeln, lagern und später verzehren ließen, sodass Menschen wie Tiere sie in Notzeiten essen und Hungersnöte abwenden konnten. Prähistorische Funde aus ganz Europa zeigen, dass diese ersten Bauern Eichelmehl als Ersatz nutzten, wenn die Getreideernte ausfiel. In einer bronzezeitlichen Siedlung in der Nähe von Berlin war ein metertiefes Erdlager bis zum Rand mit Eicheln gefüllt, die »geschält, halbiert und geröstet« waren, also für den menschlichen Verzehr gedacht, nicht als Schweinefutter.6 In der gesamten Menschheitsgeschichte wurde Eichelmehl zum Backen von Brot verwendet. In verschiedenen Kulturen der Welt wird das bis heute praktiziert.7
Diese frühen Bauern ließen sich in der Landschaft nieder und errichteten Monumente aus Stein und Holz. Ringe aus Eichenpfosten erhoben sich als klar umgrenzte heilige Bezirke aus der Erde. Tierhäute wurden mit Tannin aus Eichenrinde und -galle behandelt, um das Leder weicher zu machen. Eichenplanken wurden gespalten und zu Stegen ausgelegt, die sich kilometerweit durch Sümpfe und Feuchtgebiete zogen. Die ersten Boote der Steinzeit waren Einbäume, ausgehöhlte Kanus aus Eichenstämmen; in der frühen Bronzezeit fertigte man Boote aus Eichenbrettern, die mit gebogenen Eibenruten zusammengenäht und mit Bienenwachs abgedichtet wurden.
Holzkohle aus Eiche machte es den Menschen möglich, sich über das Steinzeitleben hinaus zu entwickeln; Kohle, von Köhlern in den Eichenwäldern hergestellt, heizte die frühen Schmelzöfen auf solche Temperaturen auf, dass ihre Flammen Kupfer, Gold und Zinn aus mineralhaltigen Erzgesteinen herausschmelzen konnten. Nach der Herstellung von Bronze ermöglichten andere mit Eichenkohle befeuerte Schmelzöfen es den Grob- und Waffenschmieden, auf magische Weise Eisen und zuletzt Stahl zu produzieren.
31.August
Der Chor der Abenddämmerung.
Zwitschernde Mehlschwalben huschen in abgehacktem Flug umher. Durch die Kiefern hallt das unaufhörliche Zizibää, Zizibää der Kohlmeisen. Die Mücken sind da. Der Tag ist fast vorbei; nur letzte Lichtschlieren sind noch zu sehen. Im Osten erhebt sich ein Vollmond, das Antlitz rosig von den Farben des Sonnenuntergangs. Die nachtschwarzen Fetzen, die hin und her schießen, sind Fledermäuse. Sie fädeln sich durch die dichter werdende Luft um den Baum. Ein Zaunkönig piept ein Tick-tick-tick-Stakkato irgendwo in der dunkler werdenden Blättermasse mitten in der Eiche und klackert fort in den Schutz der Kiefern, während im schwindenden Licht unten in den Brombeeren ein weißer Federgeistchen-Falter immer strahlender hervortritt.
Die Ruhe, die sich über die Eiche legt, ist die des Tagesabschlusses – ein sanfter Seufzer, den das scharfe Bellen eines Muntjakhirschs von hinten aus dem Wald durchbricht. Der Mond, so weit und weiß, verschwindet bald hinter Wolken. Ich lehne mich auf der Bank zurück, kuschele mich ein gegen die Dunkelheit. Eine Zwergfledermaus gerät in den Lichtstrahl der Taschenlampe und wird einen Moment lang eingefangen, mit weit gespreizten Flügeln. Ich denke an den Sommer vor zwei Jahren, als ich frühmorgens durch einen anderen Wald – den Tiger Wood in Suffolk – ging und für eine Fledermausstudie mithilfe eines Spezialdetektors auf das Echolot-Klicken der Tiere horchte. Die Maschine berichtete, dass es sich bei den Schattenflecken, die über mir lavierten, um Mückenfledermäuse handle, die sich durch die höhere Frequenz ihrer Rufe von ihren Cousinen, den Zwergfledermäusen, unterscheiden. Außerdem lernte ich in jener Nacht, dass diese beiden Pipistrellus-Arten erst seit ungefähr zehn Jahren wissenschaftlich unterschieden werden. Heute Abend sind die Fledermäuse, die durch die Nacht zischen, für mich ununterscheidbar. Wir wissen immer noch so wenig.
In den Wäldern hinter mir durchbricht der erste Schrei eines Waldkauzes die Nachtluft, zwei-, dreihundert Meter weit weg. Ich sitze angespannt da und harre des nächtlichen Lebens in der Eiche, als der Vollmond durch Risse in der Wolkendecke wieder auftaucht – wie kurze Blicke durch ein Fenster auf eine andere, ferne, jenseitige Welt. Ich stehe auf den Brettern der Bank und lausche dem Grillenorchester, das sich in den Brombeeren und Brennnesseln warm spielt. Eine weitere Zwergfledermaus flitzt vorbei. Die Dunkelheit liegt jetzt über mir. Ich sehe wenig bis nichts. Es fühlt sich köstlich lebendig an, hier zu sein, gehalten von diesem schwarzen Nebel.
Jetzt ist das Gehör der wichtigste Sinn. Das rollende Rauschen des fernen Wasserfalls ist stets präsent. Die Grillen stimmen sich ein. Und in der Geräuschlandschaft klaffen immer größere Lücken, weil die Fasane in ihre Baumbetten hinaufgeflattert und verstummt sind. Der Gesang der Tagvögel ist vorüber. Die Dämmerung auch. Jetzt ist es wirklich Nacht.
Die Sekunden verstreichen. Ein Lebewesen schleicht direkt neben mir über den Pfad, und die Dunkelheit ist so vollkommen, dass ich nicht sagen kann, ob es ein Fuchs, ein Hermelin, ein Hirsch oder ein Dachs ist. Bevor ich eine Lampe in seine Richtung drehen kann, ist es weg. Ein weiteres Käuzchen fängt in den Bäumen im Norden an zu rufen. Ich steige hinunter, stehe zwischen den Stämmen, den Ästen der Bäume und weiß, dass ich hier im nächtlichen Wald in ein vergessenes und fremdartiges Land vorgedrungen bin – eines, in dem tief verwurzelte, instinktive Sinne erwachen, in dem die Furcht vor dem Unsichtbaren plötzlich emporschießen und uns packen kann. Der Wald im Dunkeln ist kein Ort für unser modernes menschliches Fühlen und Denken. Selbst in der Urzeit verließen wir die Wälder und hielten uns von ihnen fern. Wir rodeten das Land in unserer Umgebung, um auf den so geschaffenen Flächen zu leben. Wir erbauten unsere Häuser aus den Stämmen der Bäume, die wir fällten. Wieder allein im Dunkeln in die Wälder zu gehen, heißt, in andere Gefilde zurückzukehren, in ein vollkommen anderes Zeitalter. Ich hatte erwartet, dass die Dämmerung herabsinken und die Kreaturen der Nacht unter dem großen Schutzschild der Äste hervorkriechen würden. Stattdessen herrscht eine unirdische Stille – eine tiefe, unveränderliche Lautlosigkeit, die sich anfühlt wie das unhörbare, langsame und stetige Atmen der Erde. Und es entzückt mein ganzes Wesen, hier zu sein. Ich bin so lebendig. Ich brenne vor Elektrizität. Ich sprudle vor bewegungsloser Energie wie ein Jäger, der mitten in der Hatz aufgehalten wird.
Die Mücken fangen sich im Lichtkegel wie tanzende Staubkörnchen. Ein weiteres Lebewesen tanzt mit dunklem Körper aus dem hohen Gras über den Weg. Ich spähe hinüber. Obwohl die Sicht trüb und grau ist, spüre ich, dass es ein Fuchs ist. Ein Kiefernzapfen fällt herab. Ich höre, wie er in zehn Metern Höhe abbricht, es folgt eine kurze Pause, und dann höre ich seinen Aufprall auf der Erde, einen guten Meter entfernt.
Ich trinke lauwarmen Tee aus einer Thermoskanne, mampfe altbackene Kekse und merke, dass auch ich eine lärmende Präsenz bin; ich durchbreche die stille Wacht der Nacht genau wie die Mücken und die Grillen, vergänglich wie alle anderen hier außer der großen Eiche. Im Süden ruft ein Waldkauz. Der Wasserfall stürzt in den Bach. Es ist schwer, von dieser Bank aufzustehen, an der so wenig und so viel geschieht. Ich wende mich wieder der starren, stillen Eiche zu. Bald werde ich sie der dunklen Nacht überlassen müssen, denke ich. Dann hallt ein Schuss im Norden; er durchschlägt die Stille mit plötzlicher, lähmender Gewalt. Die Explosion aus Lärm ist furchtbar, mit tödlichem Nachhall, und erstirbt nur langsam, wie Wellen auf der Oberfläche eines Tümpels. Endlich klingt die Spannung der nachfolgenden Stille zu der tonlosen Ruhe ab, die vorher herrschte.
Während ich die Eiche in weit ausholenden Kreisen umschreite, knipse ich meine schwere Taschenlampe an und suche nach Spuren von Leben. Der Lichtkegel schneidet einen Tunnel aus brutaler, scharfer Helligkeit ins Dunkel. Er ist wie ein Suchscheinwerfer in einem Meer aus Nacht, eine Alabasterfackel, die einen Kreis aus klarem Licht wirft. Ich hatte erwartet, Schutz suchende Vögel, erwachende Eulen zu finden. Stattdessen starre ich auf Nacktschnecken – eine olivgrün gesprenkelte Kolonie riesiger gelber Nacktschnecken, die an der Westseite der Eiche über den Wurzelstock kriechen. Sie haben etwas Außerirdisches an sich, was mit dem plötzlichen Auftauchen des Mondes aus einem Wolkenband zu tun haben könnte; er wirkt jetzt größer als zuvor, während er im Osten emporsteigt und den Sonnenaufgang viele Stunden zuvor imitiert. Und jetzt ist der Mond mit glühenden Kohlen besetzt und trägt ein Muster aus drei einzelnen Wolkenstreifen, verwandelt von einer blassen Schattenerde, die neben unserer dahintreibt, in einen zweiten Jupiter, der riesig und nah am Nachthimmel brennt. Und während ich neben der Eiche stehen bleibe und mich mit einer Hand an ihr abstütze, um nicht zu schwanken, frage ich mich, ob ich vielleicht auf irgendeinem unbekannten Wege auf die Zukunft unseres eigenen Planeten Erde hinausblicke, während dessen letzte Reste verglühen und seine Zerstörung endlich vollendet ist.
18.September
Ein Wald ist in allen Mythologien ein geheiligter Ort, wie die Eichen bei den Druiden und der Hain der Egeria […].
Henry David Thoreau, Tagebuch, 23.





























