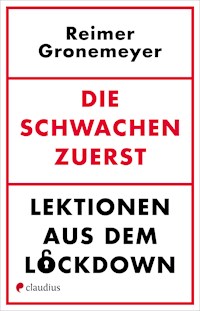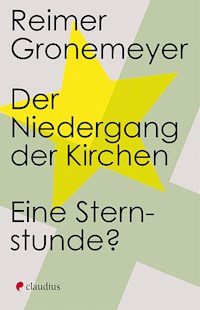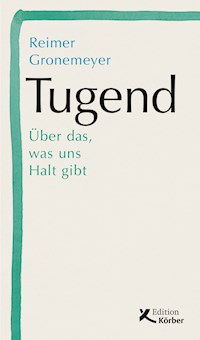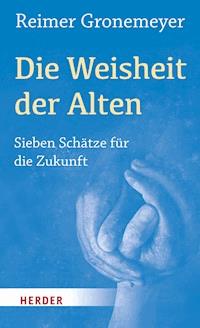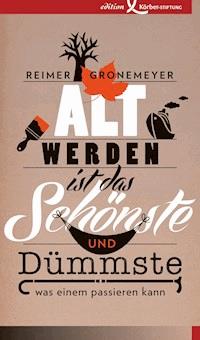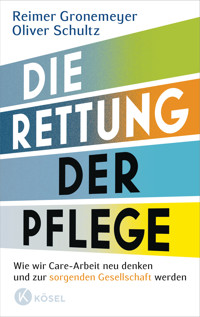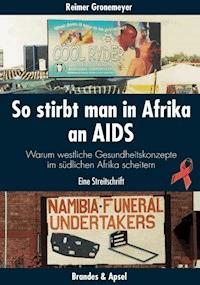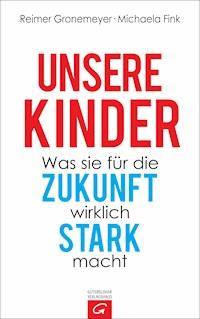17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Prominente wie Rudi Assauer, Tilman Jens und Arno Geiger haben die Öffentlichkeit wachgerüttelt – nun liefert Reimer Gronemeyer den Hintergrund zu einer längst überfälligen Debatte: Sein Buch "Das vierte Lebensalter" beschreibt den schwierigen Alltag dementer Menschen und ihrer Angehörigen und prophezeit eine soziale Kernschmelze: In unserer alternden Gesellschaft werden immer mehr Menschen dement, ihre Familien sind immer weniger in der Lage, diese Menschen aufzufangen, und die Kosten für ihre Betreuung explodieren. Reimer Gronemeyer fordert einen Perspektivwechsel. Seine These: Mit medizinischer Forschung werden wir das Problem nicht lösen! Was wir brauchen, ist eine Strategie gegen die sozialen Folgen von Demenz. Denn wir wissen nicht, wodurch Demenz ausgelöst wird – aber wir wissen, dass es jeden treffen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Ähnliche
Reimer Gronemeyer
Das 4. Lebensalter
Demenz ist keine Krankheit
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
… für das Gießener Team:
Sylvia Allendörfer, Daniela Dohr, Julia Erb,Michaela Fink, Philipp Kumria, Jonas Metzger,Andrea Newerla, Verena Rothe
»Unsere Gesellschaft will in dem Kranken, den sie verjagt oder einsperrt, nicht sich selbst erkennen; sobald sie die Krankheit diagnostiziert, schließt sie den Kranken aus.«
Michel Foucault[1]
Vorwort Liliputaner und Demenzriesen
»Ich habe um meine Kindheit gebeten, und sie ist wiedergekommen, und ich fühle, dass sie immer noch so schwer ist wie damals und dass es nichts genützt hat, älter zu werden.«
Rainer Maria Rilke[2]
Wir leben im Jahrhundert der Demenz.[3] Es sieht so aus, als würden die alten Industriegesellschaften, in denen die Demenz jährlich zunimmt, unter Ermüdungserscheinungen leiden. Das Einzige, was in diesen Gesellschaften noch wächst, sind offenbar die Zahl der Alten und die Zahl der Menschen mit Demenz. Die Moderne frisst ihre Kinder nicht, sondern macht ihre Angehörigen zu greisen Kindern.
Und noch etwas wächst: die Dienstleistungsbranche »Pflege« und die Versorgungsindustrie »Demenz«. In diesem Wachstumsmarkt sind heute weit mehr Menschen beschäftigt als in der Automobilindustrie. Mit den Hinfälligen und Hilflosen werden gewaltige Umsätze erzielt. Kann das eigentlich längerfristig gutgehen? Werden die Kräfte der Jungen und ihre Aufbruchswünsche durch die Bewohner des Vierten Lebensalters so gebunden, dass sie irgendwann aufbegehren werden?
Der Versuch, das Thema Demenz in pflegerische und medizinische Ghettos zu verbannen und dort zu beherrschen, muss scheitern. Es ist an der Zeit, die soziale Seite der Demenz zu entdecken. Ob wir imstande sind, humane, menschenfreundliche Wege des Umgangs mit der Demenz zu entwickeln und zu erfinden, das wird über unsere kulturelle und soziale Zukunft entscheiden. Während die Blicke gebannt auf die Börsenkurse gerichtet sind, während an Rettungsschirmen gebastelt wird, bildet sich an der sozialen Basis der Gesellschaft eine explosive Gemengelage. Merkwürdigerweise werden das Thema Pflege und das Thema Demenz bei uns behandelt, als gäbe es keine ökonomischen und keine ökologischen Krisen, die doch irgendwann mit Vehemenz auf das Vierte Lebensalter durchschlagen werden. Es wird so getan, als würden die absehbaren gesellschaftlichen Konflikte und Verteilungskämpfe an den Themen Pflege und Demenz spurlos vorübergehen, als gäbe es da ein Reservat für die Pflege, in dem man unbeirrt von weiterem Wachstum, von Ausbau und Erweiterung reden könnte, als gäbe es die Erschütterungen nicht, von denen täglich in den Medien gesprochen wird. Die ökonomische und ökologische Krise findet außerhalb des Areals »Viertes Lebensalter« statt. Bis die Dämme brechen – dann trifft es die Angehörigen und die Branche unvorbereitet.
Das Glück der Längerlebigkeit, das im rüstigen Rentner, im guten Kunden und im Leser der Apotheken-Rundschau seine prominentesten Figuren findet, gebiert ein ökonomisches und ein soziales Problem, das an der Substanz der postbürgerlichen Gesellschaft nagt. »Die Generationen empfinden sich gegenseitig als ›Untote‹, hier die alten Zausel, die nicht sterben wollen und ›von unserem Geld‹ weiterleben, ohne Nutzen zu bringen, dort die von Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll (oder was da gerade in Mode sein mag) durchdrungenen besinnungs- und verantwortungslosen Mitglieder der entkörperten und überkörperten ›Spaßgesellschaft‹.«[4] Bei kultivierteren Menschen finden sich statt Hass und Häme – so schreiben Markus Metz und Georg Seeßlen – Mitleid und Einfühlung, »was die Sache aber keineswegs viel besser macht«. Es zementiert die Spaltung von Alt und Jung auf andere Weise, »Grufties«, »Junkies«, »Workaholics« und »Karriereristen« finden sich zum Untoten-Tanz – »aber ohne Anfassen«.[5] Solche bissig-ironischen Analysen kommen in der Demenzszene vermutlich gar nicht gut an, vor allem weil man hier – von Ausnahmen abgesehen, die man am leichtesten unter den Betroffenen findet – eine weitgehend humorfreie Zone betritt.
Unablässig werden neue Konzepte zum richtigen Umgang mit Demenz entwickelt: Framen, inkludieren, validieren, mappen usw. Ständig habe ich schon wieder eine Neuerung übersehen, noch nicht gelesen, nicht zur Kenntnis genommen. Schlechtes Gewissen: Ist soeben wieder eine aktuelle Sprachregelung an mir vorbeigegangen? Wenn ein Mensch mit Demenz um sich schlägt, sich nicht waschen lassen will oder sich auf sonst eine Weise widersetzt, dann spricht der Demenzexperte, der auf der Höhe der Zeit ist, von »herausforderndem Verhalten«. Im Kreis normaler Bürgerinnen und Bürger hat das – meiner Erfahrung nach – eher einen Lachanfall zur Folge. Konzepte bringen das Einzelgesicht zum Verschwinden und befreien von der Notwendigkeit, in der konkreten Situation nachdenklich, ja »be-sinnlich« zu sein. Wer solch ein gerade modisches Instrument oder Vokabular zur Hand hat, sieht sich sowieso auf der Seite des Richtigen, und alle anderen stecken im Sumpf der Uninformiertheit.
Ich fühle mich angesichts dieser Konzept-Geschäftigkeit an die eifrigen Liliputaner erinnert, die den Riesen Gulliver mit tausend Fäden zu binden und zu fesseln und zu beherrschen versuchen. Konzepte, Konzepte, Konzepte. Die Bemühung verdient Respekt, die vielen pflegenden Profis und vor allem die Angehörigen leisten Unglaubliches. Doch in Wirklichkeit bebt der Boden schon, auf dem alle diese Konzept-Gebäude stehen.
Dieses Buch beabsichtigt nicht, mit einem neuen Demenzkonzept Aufmerksamkeit zu erregen. Ich plädiere einfach dafür, die Demenz aus ihrem medizinisch-pflegerischen Ghetto herauszuholen. Schauen, was dann passiert. Ich plädiere auch dafür, die Demenz als den Schlüssel zum Verständnis unserer Gesamtlage zu begreifen. Ich rede also eigentlich gar nicht von der Demenz, sondern darüber, was sie mit uns – die wir »das« noch nicht haben – macht. Es kommt mir so vor, als ob sich in der Demenz die Gesellschaft vollendet, in der wir leben. Der erinnerungslose, radikal individualistische Single, der das heimliche Ideal ist, setzt sich im Menschen mit Demenz durch – aber so war es natürlich nicht gemeint! Der Schlüssel zu einer anderen Gesellschaft, in der wir in wieder erwärmten freundschaftlichen Verhältnissen leben könnten, liegt deshalb bei ihnen, den Dementen. Das ist das offene Geheimnis.
Währenddessen wird an nationalen Demenzplänen gebastelt, die Weltgesundheitsorganisation skizziert eine Alzheimerepidemie, die weltweit ihre Krakenarme ausstrecken wird, wenn wir nicht rechtzeitig etwas machen, »Leuchttürme« mit medizinischen Demenzforschungsprojekten werden in Deutschland mit Millionen Euro ausgestattet. Die Liliputaner werkeln offenbar weiter, getrieben von dem Versuch, den Demenz-Gulliver zu fixieren. Das Demenzgetümmel geht weiter. Zu den Merkwürdigkeiten, die einen stutzen lassen könnten, gehört die Tatsache, dass die Angehörigen, die oft in einer dramatisch schwierigen Lage sind, die »Angebote« der Demenzexperten, der Demenzberatungsstellen und der Demenzinnovateure nicht nutzen. Wahrscheinlich lohnt es sich, diesen Tatbestand anzuschauen, statt ihn mit den Waffen der Aufklärung wegzumachen.
Es geht darum, versuchsweise die Denkrichtung umzukehren. Es geht darum, die Frage zu stellen, ob wir in die richtige Richtung gehen. Sind die professionelle Pflege und der Ausbau der ambulanten bzw. stationären Versorgung die einzige Antwort auf eine alternde Gesellschaft, in der »Familie« immer seltener die Antwort auf das Pflegeproblem sein wird? Kann und darf diese Richtungsfrage überhaupt noch gestellt werden? Oder ist der Zug schon längst abgefahren, und wir rauschen mit Hochgeschwindigkeit in die Arme einer notwendigerweise immer weiter automatisierten, industrialisierten Pflege und Verwahrung der Hilfsbedürftigen?
Und was verstehe ich eigentlich von dem Thema? Ich habe keine Erfahrung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Muss ich deshalb den Mund halten?
Ich habe allerdings ein wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen, die hilfsbedürftig sind. Das hat mich dankbar gemacht und empfindsam für das Geschenk, das ein unbeschädigtes Leben nun einmal ist. Ich glaube auch zu wissen, dass inmitten der Mühsal, die einem die Sorge für Hilfsbedürftige aufbürdet, diese Sonnenstrahlen aus den dunklen Wolken leuchten können: Augenblicke, in denen begriffen wird, dass die Sorge für andere beschenkt. So hat es Søren Kierkegaard, der dänische Theologe und Philosoph, gesagt:
»Aber jede wahre Kunst der Hilfe muss mit einer Erniedrigung anfangen. Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte. Er muss begreifen, dass zu helfen nicht zu beherrschen ist, sondern zu dienen; dass helfen nicht eine Macht, sondern eine Geduldsausübung ist; dass die Absicht zu helfen einem Willen gleichkommt, bis auf weiteres zu akzeptieren, im Unrecht zu bleiben und nicht zu begreifen, was der andere verstanden hat.«[6]
Wenn man diesen Satz nur wirklich begreifen könnte!
Demenz: Wir brauchen eine andere Perspektive
»Die erste Regel besagt:
Folge dem Hauptstrom der Forschung, alles andere kannst du vergessen.
Die zweite Regel lautet:
Den Hauptstrom der Forschung, dem alle folgen, kannst du vergessen.«
Harald Weinrich[7]
Eine neue Geißel der Menschheit? Über die soziale Seite der Demenz
»Kultur ist Reichtum an Problemen.«
Egon Friedell
Vor kurzem ist mir etwas widerfahren, was meine Alltagsroutine unterbrochen hat. Ich bin es gewohnt, auf Vortragsreisen zu sein. So auch an dem Tag, an dem ich eingeladen war, in Frankfurt am Main auf dem Altenhilfetag zu sprechen. Über Demenz natürlich. Als ich zum Ende gekommen war, hatte ich den Eindruck, meine Zuhörer einigermaßen in den Bann geschlagen zu haben. Es gibt ja so Tage, an denen gelingt die freie Rede, es gibt Kontakt zum Publikum, der Funke springt über. In dem Gefühl, mein Ziel erreicht zu haben, machte ich mich auf den Heimweg. Ich war in Eile, denn ich wollte am Hauptbahnhof einen bestimmten Zug bekommen, um eine Verabredung einhalten zu können. Mit schnellen Schritten verließ ich also den Vortragssaal und musste zur nächsten Straßenbahn nur die Straße überqueren, die direkt vor dem Ausgang des Gebäudes lag.
Und dann stand ich vor dem Fahrkartenautomaten, um eine Fahrkarte bis zum Bahnhof zu lösen. Ich versuchte diese Taste und jene Taste. Ich glaube, die Frankfurter Fahrkartenautomaten sind berüchtigt für ihre Undurchschaubarkeit. Ein Blick über die rechte Schulter machte mich noch nervöser, denn ich sah die Straßenbahn kommen. Erneuter Versuch, erneutes Scheitern.
In mir braute sich wie ein plötzliches Unwetter an einem Sommertag ein moralisches Dilemma zusammen: Sollte ich die Bahn fahren lassen und es weiter am Automaten versuchen, oder sollte ich, um meinen Termin zu retten, ohne Fahrkarte einsteigen? Der Gedanke an einen Kontrolleur, der missbilligend mich weißhaarigen Schwarzfahrer zur Rede stellt, schreckte mich. Aber es musste entschieden werden, denn die Straßenbahn kam nun schon hinter mir zum Halten.
Ich blickte etwas unsicher über die linke Schulter und sah, dass der Straßenbahnfahrer sein Schiebefenster öffnete und sein schnauzbärtiges Gesicht herausschob. »Wo willst du denn hin?«, hörte ich ihn rufen. Offenbar ein Mann mit Migrationshintergrund – wie man heute wohl korrekt sagt. Ich gab ihm Antwort, und er erklärte mir, auf welche Taste ich drücken müsse, um zum Bahnhof zu kommen. Es gelang mir schließlich, eine Karte zu ziehen, und die Straßenbahn fuhr mit mir ab.
Die Geschichte hat für mich zwei – lehrreiche – Konsequenzen. Einerseits wurde mir klar, wie schnell man vom Vortragenden zum Thema Demenz, der ich bis zu meiner Ankunft am Fahrkartenautomaten war, zum Verdächtigen werden kann: Der Fahrer hielt mich sichtlich für einen etwas verwirrten alten Herrn, auf den schon der Schatten der Demenz fiel. Andererseits wurde mir – als ich nun eingestiegen war – deutlich, dass ich gerade eine Sternstunde zivilgesellschaftlichen Engagements erlebt hatte. Der Schnurrbärtig-Glatzköpfige hatte im richtigen Augenblick das einzig Richtige getan: Alle Regeln seines Berufes ignorierend, hatte er gehandelt und gemacht, was die Situation von ihm forderte: Er hatte meine Ratlosigkeit erfasst und mir mit wenigen Worten geholfen. Zu seiner Ausbildung hatte das sicher nicht gehört. Wahrscheinlich durfte er gar nicht tun, was er tat. Aber jetzt und in Zukunft werden wir – im Umgang mit der Demenz – davon leben: Dass es Menschen gibt, die sensibilisiert sind für die Hilfsbedürftigkeit anderer. Und die dann das tun, was die Situation von ihnen fordert, auch wenn das gar nicht vorgesehen ist – und vielleicht sogar einen Regelverstoß darstellt. Wir leben nicht mehr in dem Dorf, in dem jeder weiß, wohin die verwirrte Frau im Nachthemd gehört, die am Fenster vorbeigeht. Diese verlorene Nachbarschaftlichkeit muss ersetzt werden durch Sensibilität und Engagement in den städtischen Räumen, die der kalten Anonymität den Garaus machen. Klar, das ist einfacher gesagt als getan. Ich erinnere mich an eine Situation in Wiesbaden, die mich ratlos und beschämt zurückgelassen hat. Menschenströme in der Fußgängerzone. Und plötzlich fällt mein Blick auf eine alte Frau, die auf den Stufen einer Treppe steht und im Begriff ist, sich auszuziehen. Die Unterwäsche hatte sie schon heruntergelassen. Jeder eilte nach einem flüchtigen Blick so schnell wie möglich weiter, um der Peinlichkeit zu entkommen. Hätte man etwas tun können? Was? Ich ging weiter, das Bild von dieser verwirrten Frau haftet bis heute in mir.
Die Demenz ist im Begriff, das große soziale, kulturelle, ökonomische Thema unserer Gesellschaft zu werden. Und das nicht nur bei uns in Deutschland. In allen Gesellschaften, in denen viele, viele sehr alte Menschen leben, steht das Thema auf der Tagesordnung – von Japan bis in die Vereinigten Staaten, in China wie in der Schweiz. Es erwischt uns alle: Erst haben wir dafür gesorgt, dass wir immer länger leben, und nun bekommen wir die Konsequenzen zu spüren. Das Vierte Lebensalter, das hohe Alter, das einmal eine Ausnahme war, wird zum Massenphänomen. Der Druck steigt: Noch immer ist es möglich, Erwartungen auf eine weitere medizinisch organisierte Verlängerung des Lebens zu wecken, und zugleich merken wir, dass wir den sozialen Konsequenzen dieses medizinischen Siegeszuges nicht gewachsen sind. Es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen: Es wird in den nächsten Jahrzehnten die große humanitäre Herausforderung für die alternden Gesellschaften sein, ob es gelingt, die wachsende Zahl von Pflegebedürftigen, insbesondere die wachsende Zahl von Menschen mit Demenz, so zu umsorgen und mitzutragen, dass diese Lebensstrecke für die Betroffenen und die Angehörigen nicht nur eine Qual ist.
Eine falsche Antwort liegt nahe, und sie wird schon propagiert: Das durch die Fortschritte der Medizin hervorgebrachte Problem soll von der Medizin (im Bündnis mit der pharmazeutischen Industrie) bewältigt werden. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um zu prognostizieren, dass dieser Ansatz scheitern wird. Stattdessen gilt: Entweder wird die Demenz endlich als eine soziale Aufgabe wahrgenommen, bei der die medizinische Expertise eine helfende Rolle spielen darf, oder wir stehen vor einem ökonomischen, kulturellen und humanitären Bankrott. Es geht nicht um ein bisschen zivilgesellschaftliche Ergänzung der Versorgung, sondern es geht um nicht mehr und nicht weniger als um einen Umbau der Gesellschaft. Aber das wird schwierig. Auch deshalb, weil die Menschen mit Demenz von mächtigen Interessengruppen umstellt sind. Ob zu ihrem Schutz oder ob man sich von ihnen einen Nutzen verspricht, das sei dahingestellt. Dass die Gesundheitsbranche – Apotheker, Mediziner etc. – da eine große Klientel vor sich sieht, ist unübersehbar. Dass die Versorgungsindustrie – um es einmal respektlos zu formulieren – in den Menschen mit Demenz die wichtigste Klientengruppe vor sich hat und damit ein sicheres Geschäft, liegt auf der Hand. Im Grunde ist – vorsichtig gesagt – schwer zu übersehen, dass es eine deutliche Bereitschaft gibt, der Zunahme von Demenz auch gute Seiten abzugewinnen. Und dann gibt es da die Alzheimer-Lobbyisten. Den Alzheimer-Lobbyisten wird niemand unterstellen, sie würden sich über Zuwachsraten in der Demenz auch nur klammheimlich freuen – aber unter dem Strich werden sie nun einmal mächtiger, wichtiger und damit vielleicht auch schwerhöriger gegenüber Kritik. Das ist bei Funktionären ja kaum zu vermeiden.
Die Demenz eignet sich gut, um Schreckensszenarien zu entwerfen. Man sieht eine krisengeschüttelte deutsche Gesellschaft vor sich, die des Demenzproblems nicht mehr Herr wird. Diese Zahlen werden immer wieder vorgebracht, und sie werden immer apokalyptischer:
Gegenwärtig sind in Deutschland 1,2 Millionen Menschen von Demenz betroffen, im Jahr 2050 werden es voraussichtlich 2,6 Millionen sein. Je nachdem, wie die Maßstäbe für Demenz gesetzt werden, kann man die Zahlen immer weiter in die Höhe treiben. Horst Bickel hat für die Deutsche Alzheimer Gesellschaft eine neue Berechnung vorgelegt. Danach lebten 2012 in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Demenzkranke. Zwei Drittel von ihnen waren von der Alzheimer-Krankheit bedroht. Jahr für Jahr treten fast 300000 Ersterkrankungen auf. Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelinge, werde sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2050 auf etwa 3 Millionen erhöhen, so Horst Bickel. Und wenn es keine Erfolge in der Bekämpfung der Demenz gebe, müsse man in den nächsten vierzig Jahren mit mehr als 100 zusätzlichen Krankheitsfällen pro Tag rechnen.[8]
In Deutschland – so heißt es in einer Krankenkassenstudie – muss jeder dritte Mann und jede zweite Frau damit rechnen, irgendwann im Leben an Demenz zu erkranken.
Zwei Drittel der Demenzkranken sind pflegebedürftig.
Im Jahre 2009 waren bereits 29 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen, die im Alter von über 60 Jahren starben, dement.
Die monatlichen Ausgaben der Sozialversicherungen für einen Demenzkranken liegen um durchschnittlich 800 Euro höher als bei einer nicht dementen Person.[9]
Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat diese Entwicklungen zum Anlass genommen, um vor einer immer weitersteigenden Budgetbelastung durch Gesundheitskosten in den G-20-Ländern – den reichen Ländern also – zu warnen. Wenn die Regierungen ihre Systeme zur sozialen Sicherung nicht änderten, werden sie – aus der Sicht von Standard & Poor’s – »unsustainable«, will sagen: Sie werden zusammenbrechen. Die Alterung der Bevölkerung werde zu fundamentalen Veränderungen im Blick auf das ökonomische Wachstum führen. Die Gesundheitskosten würden steigen, und das würde die europäischen Ökonomien stärker treffen als die aufstrebenden Wachstumsgesellschaften. Die Kreditwürdigkeit solcher Länder wie Deutschland würde schließlich aus der Sicht der Ratingagentur drastisch leiden.[10]
Wer Ohren hat zu hören, der weiß: Dies ist die kaum verhohlene neoliberale Aufforderung, die Gesundheitsausgaben radikal zu kürzen, um das Überleben und den Wohlstand der Starken zu sichern. Man könnte auch sagen: Eine Gesellschaft, die sich mit so nutzlosen Elementen wie den Demenzkranken zu sehr belastet, gerät unter die Räder. Die hohe soziale Sicherung in Europa, in Japan und den Vereinigten Staaten, die gleichzeitig an einer »Verschlechterung des demographischen Profils« leiden, wird diese Länder – die Drohung soll gehört werden – in den Abgrund reißen, wenn sie nicht einen anderen Kurs fahren.
Und hat Standard & Poor’s nicht recht?
Diese Prognose ist nicht vom Tisch zu wischen. In Deutschland wurden 2010 im Gesundheitssystem 287,3 Milliarden Euro ausgegeben. Darin sind die Ausgaben von Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, privaten Haushalten, Organisationen mit dem Ziel der Prävention, die Kosten von Behandlungen, Rehabilitation und Pflege, auch die Verwaltungskosten und Investitionsausgaben enthalten. (Zum Vergleich: Der Haushalt des Bundes 2012 sieht Ausgaben in Höhe von 306 Milliarden Euro vor!) Rechnerisch wurden für jeden Einwohner 3150 Euro pro Jahr bezahlt. Den stärksten Zuwachs gab es bei der sozialen Pflegeversicherung – die Ausgaben wuchsen auf 21,5 Milliarden Euro.[11] Zum Vergleich: Die Gesundheitsausgaben in Tansania lagen 2009 bei 25 US-Dollar pro Einwohner. Und man fragt sich sogleich, ob es eigentlich ein Ausdruck von Entwicklung wäre, wenn Tansania da ankommen würde, wo sich jetzt Deutschland befindet – am Rande des Gesundheitsbankrotts.
Die Frage liegt auf dem Tisch: Wie soll das weitergehen? Mit den Gesundheitskosten überhaupt, aber speziell auch mit den Kosten für die Demenz?
Die WHO hat 2012 vor einer dramatischen Ausbreitung der Demenz gewarnt: Gegenwärtig – so die WHO – sind es 66 Millionen Demenzkranke weltweit, die an Alzheimer oder ähnlichen Störungen leiden. Die Zahl wird sich bis zum Jahre 2030 verdoppeln und die Gesundheitssysteme massiv überfordern. 2050 werden dann 115 Millionen Menschen »unter dieser Hirnerkrankung leiden«. Alle vier Sekunden wird weltweit eine Demenzerkrankung neu diagnostiziert.
Die Experten der WHO sprechen im Blick auf die Demenz von einer »Geißel der Menschheit«. Marc Wortman, Direktor von Alzheimer’s Disease International (ADI), der die WHO-Studie maßgeblich mitgestaltet hat, sagt: Die Gesundheitssysteme seien »schlicht überfordert«. Die Demenz sei eine Bürde für die Betroffenen und ihre Angehörigen und sie sei auch ein »sozialer und wirtschaftlicher Alptraum«.[12]
Von einer Geißel der Menschheit ist da die Rede! Haben wir es mit einer neuen Pest zu tun? Alle zwanzig Jahre verdoppelt sich die Zahl der Demenzkranken, wird gerufen![13] Das hieße, dass in hundert Jahren etwa die Hälfte der Deutschen betroffen wäre.
Was passiert da eigentlich? »In vielen Ländern sei das öffentliche Interesse an der Behandlung der Krankheit und die Bereitschaft zur Hilfe für die Betroffenen immer noch sehr gering«, klagt Marc Wortman, der bereits zitierte Direktor von Alzheimer’s Disease International.[14] Müssen wir uns in Alarmbereitschaft versetzen lassen?
Eines ist unübersehbar: Mit der Zahl der als demenzkrank Diagnostizierten steigt die Zahl der Profiteure. Demenzlobbyisten gewinnen an Bedeutung, wenn ihre Klientel wächst. Der Pflegesektor darf sich große Zuwachsraten versprechen. Die medizinischen Demenzspezialisten haben blendende Aussichten, und die Pharmaindustrie darf sich Wachstumsschübe im Sektor Demenz ausrechnen – auch wenn sie nicht wirklich etwas zu bieten hat.
Und so wird, zum Beispiel in der WHO-Studie, nach nationalen Demenzplänen gerufen. Da sollte sich niemand täuschen. Es wird sofort um die Frage gehen: Wer kriegt die Dementen? Man kann davon ausgehen, dass eine Frühdiagnose eingefordert wird, denn das treibt die potenziell Betroffenen in die Praxen. Man kann auch davon ausgehen, dass bei der Erstellung eines nationalen Demenzplanes hinter den Kulissen oder auch auf offener Bühne sogleich heftig über die Frage gestritten wird: Wer kriegt dieses Patientenpaket? Wer darf diagnostizieren, wer behandeln, wer versorgen?
Auf dem Immobilienmarkt werden die Gewinnmöglichkeiten, die in der alternden Gesellschaft erwachsen, schon abgeschätzt: »Die Pflegeimmobilie – Kapitalanlage in einem der letzten Wachstumsmärkte für Immobilien«[15], verspricht der Bund Der Sparer e.V. Bekommt Standard & Poor’s nicht schneller recht, als man gedacht hat? Nichts wächst mehr – nur noch der Pflegemarkt. Auf einer großen Pflegetagung hörte ich kürzlich den Vorsitzenden sagen: Wir sind der Wachstumssektor der Zukunft. Bei uns sind mehr Menschen beschäftigt als in der Autoindustrie. Aber man darf doch die bange Frage stellen, was wird aus einer Gesellschaft, in der die Pflege Hochaltriger zum wichtigsten Wachstums- und Beschäftigungsmotor wird? Kann das gutgehen?
Lebensversicherungen (Kapital-Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Riester-Rentenversicherungen) verlieren, so das »Wirtschaftshaus« in einer werbenden Stellungnahme, ständig an Glaubwürdigkeit. Die Renditen sinken, in den ersten zehn Jahren wird gar keine Rendite erwirtschaftet.[16] Der demografische Wandel dagegen eröffne den Blick auf neue profitable Möglichkeiten. »Jeder vierte Bürger in Deutschland ist älter als 60 Jahre – mit steigender Tendenz. Damit steige der Bedarf an sozialer Pflege und professioneller Betreuung. 2050 wird dieser Bedarf an Pflegeeinrichtungen und Pflegeplätzen eine Größenordnung erreichen, die alle Vorstellungen sprengt. Experten gehen davon aus, dass rund 50 Prozent mehr stationäre Pflegeplätze in den nächsten 20 Jahren benötigt werden. Im Jahr 2040 werden ca. 5,6 Millionen Menschen in Deutschland leben, die 80 Jahre oder älter sind. Die Politik hat sich auf diesen Anstieg überhaupt noch nicht eingestellt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine private Vorsorge mit diesem Hintergrund unumgänglich wird. Die geburtenstarken Jahrgänge der Generation um 1960, die sogenannten »Baby Boomer«, werden, wenn sie in den kommenden Jahren in Rente gehen, einen Bedarf wecken, den man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Damit wird der Wohnbedarf für ältere, pflegebedürftige Mitbürger der Markt, der sich als einer der wenigen in Deutschland expansiv entwickelt.
Ist es nicht doch absurd, sich vorzustellen, dass der Besuch im Pflegeheim uns in das ökonomische und profitable Zentrum der Gesellschaft führt? Kann das funktionieren?
Ich habe ein Erlebnis vor Augen: den Besuch auf einer Demenzstation in Mailand, den ich nicht vergessen kann.
Das übliche Bild. Ein großer Raum, ein Tisch in der Mitte. Sitzecken. Rollstühle. Um den Tisch sitzen Frauen. Alte Frauen. Eine schreit und schlägt die Stoffpuppe, die sie in der Hand hält, mehrfach auf den Tisch. In den Rollstühlen Menschen, die in die Luft starren, Speichel tropft einer Frau, die einmal eine Dame war, aus dem Mundwinkel.
Plötzlich werde ich im Rollstuhl vorbeigeschoben. Jedenfalls habe ich eine Zehntelsekunde lang die Vorstellung, dass ich da sitze: ein Herr in meinem Alter, grauhaarig, in einem geradezu eleganten braunen Anzug. Ich sehe die glatten Revers, italienisches Design, noch immer genau vor mir. In seinem Schoß hockt, von skelettösen Händen umklammert, ein Teddy.
So kann das Leben ausgehen, das wissen wir. Meines auch? Durchaus möglich.
Ob es dann für mich so einen Pfleger gibt, der sich die Mühe macht, den üblichen Jogginganzug und die gelben Pantoffeln zu vermeiden? Vielleicht besteht der pensionierte Schuldirektor oder Bankangestellte – irgend so etwas wird der Herr im Rollstuhl sein – auf diesem Anzug? Vielleicht ist es auch nur der Einfall eines Pflegers, der sich hineinversetzt hat in die Empfindungen des Mannes, dem nun vom Leben nur der Teddybär geblieben ist.
Oder ist es dann egal? Vielleicht kommt es darauf nicht mehr an, wenn andere über mich entscheiden. Schämt man sich, wenn man Windeln tragen muss? Werde ich unter der Abhängigkeit leiden, wenn mir jemand den Suppenlöffel in den Mund schiebt? Werde ich mich ekeln, wenn mein Nachbar im Speisesaal sein Gebiss rausnimmt und auf meinen Teller legt?
Möglicherweise ist das dann alles vorbei. Diese Sorgen, Ängste und Umgangsformen der Normalen – die scheinen nicht mehr zu interessieren. Der zivilisatorische Panzer platzt ab, und aus den Rissen treten Exkremente, Wutanfälle, Speichel und Wortfetzen heraus. Schmerzfrei, von den Plagegeistern der Erinnerung erlöst, haben die Menschen mit Demenz den paradiesischen Zustand erreicht, der allerdings den Normalen als Vorgeschmack der Hölle erscheint. Haben sie dann erreicht, was wir uns immer wieder einmal heimlich wünschen? Den anderen hemmungslos auf die Nerven zu gehen, nicht mehr Vater oder Großmutter oder Ehemann oder sonst was zu sein, nur noch ein essendes und verdauendes Ego, sonst nichts? Keine Schuldgefühle mehr, keine unerledigten Pflichten, kein Zwang mehr, sich für die Sorgen anderer zu interessieren?
Aber so ist es offenbar nicht. Vielleicht sind da doch mehr Schmerzen, als wir wahrnehmen, vielleicht mehr Ängste und Sehnsüchte. Vielleicht ist dieser Zustand der Demenz so quälend wie die Suche nach dem richtigen Wort oder dem richtigen Namen, den ich eben noch wusste. Und dann lässt mir die Suche keine Ruhe. Fühlt sich das so an, wenn man in der Demenz steckt? Das Ehepaar, das morgens seine Rucksäcke aufsetzt und in der weitläufigen Pflegeeinrichtung dann auf die Flucht geht, immer und immer wieder, »weil die Russen kommen«. Wenn die Schwester sie findet, sagt sie: Die Russen kommen aber aus der anderen Richtung, Sie müssen – Fingerzeig der Schwester – dahin gehen. Solche Geschichten zeugen eher von Furien, die in der Seele herumirren als von einem Gemüt, das sich, von Sorgen befreit, fortan wohlig im dauerhaften Irrsinn einrichtet. Die Lebenden sind oft aus den Gedanken der Menschen mit Demenz verschwunden – sie erkennen ihre Kinder nicht mehr. Die Toten hingegen sind präsent: »Wann kommt Erich?«, fragt die Patientin D. – obwohl Erich schon vor fünfzehn Jahren gestorben ist. Gibt es glückliche Demente und unglückliche – wie es im Leben sonst auch ist? Verängstigte und Heitere?
»Es ist bekannt«, schreibt Erasmus von Rotterdam, »dass alle menschlichen Dinge … von innen ein anderes Gesicht haben als von außen: Man sieht den Tod und findet das Leben; man sieht das Leben und findet den Tod.«[17] Das hat er geschrieben auf einem langen Eselsritt, der ihn zu seinem Freund Thomas Morus bringen sollte. Und das Büchlein, das (angeblich) auf diesem Ritt entstand, hat er genannt: »Das Lob der Narrheit«.[18] Die Dementen stellen die Welt auf den Kopf. Sie stellen alles in Frage, was uns wichtig ist: die Verwandtschaft, die Börsenkurse, die Moral, die zivilen Umgangsformen. Uns scheint die Demenz in ihrem fortgeschrittenen Stadium eine Vorstufe des Todes zu sein, vielleicht kommt es den Menschen mit Demenz ganz anders vor? Haben sie nicht den Tod vergessen? Wie das für die aussieht, die im Inneren der Demenz wohnen, wissen wir nicht.
Es ist geradezu ein Patt zwischen den Dementen und den Normalen: Wir wissen nicht, was in ihnen vorgeht. Und sie wissen nichts über uns. Ist das der New Deal einer alternden Gesellschaft? Ein allgemeines »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, das aber nicht sokratischer Weisheit, sondern bitterer Resignation entspringt? Es bleibt dann an den Normalen die Aufgabe hängen, irgendwie mit dem »Demenzproblem« fertig zu werden.
Und die Normalen haben sich erfolgreich verständigt: Die Dementen sind hirnkrank, versorgungsbedürftig, bedauernswert. Dabei wird etwas weggedrängt: Die Normalen strengen sich gewaltig an, den Zustand der Welt, in der sie sich befinden, so zu verharmlosen, dass er als normal gelten kann. Aber wer ist eigentlich wirklich verrückt? Ist der Wissenschaftler, der an der Weiterentwicklung von Streubomben arbeitet, ein Irrer? Oder der Mann, der seine Fernsehzeitung in den Kühlschrank legt? Der junge BWLer, der seine Nächte vor dem Bildschirm verbringt, um mit Nahrungsmitteln zu spekulieren, oder die grauhaarige Ex-Lehrerin, die im Nachthemd auf die Straße läuft? Die Definitionsmacht haben die Scheinnormalen fest im Griff, sie kategorisieren die Dementen (leichte, mittelschwere, schwere Fälle) und arbeiten zugleich wie verrückt daran, die Lebensbedingungen der Menschen auf dem Planeten endgültig zu ruinieren. Vielleicht würden wir weiterkommen, wenn wir zwischen harmlosen Irren und gefährlichen Irren unterscheiden würden?
Natürlich ertappe ich mich dabei, dass mir öfter und öfter Namen nicht mehr einfallen, dass ich Merkzettel brauche, dass ich meine Handtasche liegen lasse, meine Fahrkarte vergesse. Mir fehlen plötzlich italienische Worte. Sollte ich beunruhigt sein?
Offenbar muss sich jeder innerlich darauf vorbereiten, dass es ihn erwischen kann, obwohl das Gefühl mir sagt: Mich trifft es nicht. Auf die Präventions-Tipps pfeife ich. Geistige Regsamkeit, körperliche Fitness – man sollte sich nicht einreden, dass es Mittel und Wege gibt, der Demenz zu entkommen. Die Schar der illustren Geister, die es traf, ist groß und beeindruckend: Immanuel Kant war im Alter ebenso dement wie Karl Marx und Edmund Husserl. Der ruhmreiche Zen-Meister Shunryu Suzuki Roshi war dement, sein Bewunderer Carl Friedrich von Weizsäcker wurde es. Ronald Reagan, der Präsident der Vereinigten Staaten war, Margaret Thatcher, britische Premierministerin, Walter Jens, der Rhetorikprofessor, Peter Falk, der Schauspieler (»Columbo«). In Mozarts Oper Don Giovanni singt Leporello die Liste der weiblichen Eroberungen des Don Giovanni in der ganzen Welt herunter (»doch in Spaniens sind’s 1003«). So könnte ein Demenz-Leporello eine lange Liste der von Demenz Eroberten in der ganzen Welt heruntersingen. Selbst Einstein war zuletzt nicht mehr in der Lage, schlichteste Rechenaufgaben zu lösen. Nicht einmal den Demenztest-Klassiker »hundert minus sieben« wusste er zu bewältigen. Stattdessen lachte er häufig grundlos, klopfte auf das Holz eines Gegenstandes, den seine Pflegerin Geige nannte, und unterhielt sich mit seiner Tabakspfeife.[19]
Kann man gar nichts machen? Nein, es sieht so aus, als greife keine Prävention. Ich merke, wie meine heimliche Hoffnung wächst, dass die Betroffenen alle Fehler gemacht haben, die ich nicht mache. Falsch gegessen, falsch gelebt, zu viele Tabletten, öde Beziehungen, geistig versteppt. Hoffentlich, so rechne ich im Stillen, trifft es die Langweiler, und hoffentlich stellt sich nicht heraus, dass ich selber einer bin.
Kann man sich, muss man sich vorbereiten? Wer Geld hat, kann sich eine professionelle Pflege leisten. Wer nicht, der ruiniert seine Familie finanziell oder gesundheitlich. Halten Beziehungen? Helfen Freundschaften? Wie viel Aggression werde ich auf mich ziehen, wenn ich dement werde? Noch finde ich: Wenn ich meinen Sohn zehnmal in der Nacht wecke, dann darf er sein Zimmer absperren. Aber wie sieht es aus, wenn es wirklich passieren würde oder ich in einen Zustand komme, in dem sich das abzeichnet?
Das Problem fängt wahrscheinlich schon damit an, dass wir es verlernt haben, Hilfe anzunehmen. Schon bei dem Gedanken, jemandem zur Last zu fallen, werde ich nervös. Wie tief ist das eigentlich in uns eingesunken und verankert: dass man ein lebenswertes Leben nur führt, solange man ein aktives, verbrauchendes, die Lebensumstände beherrschendes Wesen ist? Auf heimlich-unheimliche Weise hängt das zusammen mit dem Verschwinden der Lebensrhythmen.
An gotischen Kathedralen findet man über dem Eingang die großen mit farbigem Glas geschmückten Rosetten, die, wenn man den Raum der Kirche betritt, zu leuchtenden Bildern werden. Außen kann man um die Rosette herum oft kleine steinerne Figuren sehen: ein Kind, einen Jüngling, einen Mann, einen Greis. Wo bei einer Uhr die Morgenstunde gezeigt wird, findet sich das Kind in Windeln. Auf der Höhe, zur Mittagszeit, steht ein königlicher Jüngling, der in den Nachmittagsstunden zu stürzen beginnt, und in den späten Stunden erscheint ein Greis, gebeugt und hinfällig. Zu den Figuren gesellt sich jeweils ein Spruch: Ich werde regieren, ich regiere, ich habe regiert, ich bin ohne Regierung. Das Leben ist wie ein Kreis dargestellt, der mit dem kindlichen Aufstreben beginnt und sich zum Verfall im Alter neigt und schließt.
Wir leugnen diesen Kreis – wider besseres Wissen – und phantasieren uns fit bis zum letzten Augenblick, den ich dann am liebsten auch noch selbst bestimmen möchte. Charakteristisch dafür ist ein Bestseller des Jahres 2012 mit dem Titel: »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand«.[20] Der Hundertjährige flieht aus dem Pflegeheim, stiehlt zunächst mehr oder weniger zufällig einen Koffer mit viel Geld, reist mit Freunden umher und erzählt seine Lebensgeschichte. Ein Road Movie gewissermaßen für den Uralten. Leonhard Cohen, der Sänger, der zehn Jahre in einem Zenkloster für seinen Meister gekocht hat, berichtet von einer Äußerung des 102-jährigen Abtes: »Excuse me for not dying.« Das klingt mir weiser, nachdenklicher.
Diese alten Lebensrhythmen versuchen wir zu überspielen, wir können sie auch besser überspielen, weil wir in den modernen Gesellschaften gute Aussichten haben, lange gesund und handlungsfähig zu sein. Das Vierte Lebensalter, das Abhängigkeit und Angewiesenheit bringen kann, wird immer mehr zu einer Kampfstätte, auf der gegen Verfall und Krankheit gekämpft wird, statt dass darüber nachgedacht wird, was diese Lebensphase noch an Erkenntnis, Weisheit und Einverständnis bringen könnte. Und wie denn mit Krankheit und Verfall umzugehen wäre, ohne sie allein als zu bekämpfende Phänomene wahrzunehmen. Tiziano Terzani, an Krebs erkrankt, hat dazu durchaus ergreifend gesagt: »Im Alter eine schöne, würdevolle Erscheinung abzugeben gilt in China als eine Kunst, die man dort über die Jahrhunderte stets verfeinert hat. Und da ich jahrelang unter Chinesen gelebt hatte, glaubte ich, mir ein wenig von ihnen abgeschaut und bewahrt zu haben für die Zeit, wenn es auch bei mir so weit wäre. Mir gefiel die Vorstellung, mit weißen Haaren zu altern und vielleicht sogar mit solch schönen dichten Augenbrauen wie Maos Premierminister Zhou Enlai, der aber auch mit Sicherheit lange, lange daran gearbeitet hatte. Die Chemotherapie machte mir nun einen Strich durch die Rechnung.«[21]
Sowohl die Akzeptanz der Hinfälligkeit als auch eine Kunst des Alterns sind rar geworden.
Weil die Akzeptanz des Alters verschwunden ist und die Möglichkeit der Hilflosigkeit geleugnet wird, bekämpfen wir das Alter mit allen Mitteln, ziehen die Möglichkeit der Hinfälligkeit gar nicht in Betracht.
Viktor, der polnische Flüchtling, der sein Leben auf dem Hof des Seewirts in Bayern verbracht hat, nun alt geworden ist, im Gespräch mit Semi, dem missratenen Sohn des Seewirts. Die Mutter ist ein Pflegefall. Sie ist gelähmt! Ein Krüppel! Sie kann nicht mehr so, wie sie es vielleicht noch gerne würde. Viktors Erregung gilt nicht Semis Mutter. Sie gilt dem ungewissen Schicksal, das alle bedroht. Viktor will so ein Pflegefall nicht werden. Die Mutter des Seewirts ist versorgt von ihrer Familie. Aber Viktor wäre unter fremden Leuten. Da, so sagt er – zeige man sich nicht so intim. Man habe da doch Hemmungen. Das möchte Viktor nicht erleben. Es grause einem ja schon vor den eigenen Körperausscheidungen. Aber die Vorstellung, dass er da die Berührung von einem anderen, einem fremden Menschen würde aushalten müssen, der sich vor ihm ekeln könnte, die ist unerträglich. Wenn man beginnt, darüber nachzudenken, könne man nicht mehr arglos alt werden.«[22]
Semi, der Sohn der pflegebedürftigen Frau schätzt ab – so schreibt Josef Bierbichler –, ob hier Mitleid mit einem anderen Menschen am Werk war oder ob es sich bloß um blankes Selbstmitleid handelte.
Ein nicht mehr von ihm selbst verwaltetes Siechtum würde ihn in den Selbstmord treiben, sinniert Viktor. Damit hätte er kein religiöses oder moralisches Problem. Aber was, wenn ihn eine Lähmung oder ein geschwächtes Hirn daran hindern würde, seinem freien Willen nachzugehen? Die Pflege würde ihm zur Folter werden. Schlimmer könnte ihn das Schicksal nicht schlagen. Es würde ihm das Ende seiner Intimsphäre bringen, die ihm heilig war und bis ins Detail hinein sein Eigen.[23]
Sieben einseitige Sätze zur Demenz – Warum Demenz keine Krankheit ist
»Ihr Gradlinigen, seht euch vor in den Kurven.«
Jerzy Lec [24]
»Das Symptom entsteht, wo die Welt scheiterte, wo der Kreislauf der symbolischen Mitteilungen unterbrochen wurde; es ist eine Art der ›Fortsetzung der Mitteilung mit anderen Mitteln‹.«
Slavoj Žižek[25]
Es ist doch merkwürdig: Die Zahl der Kinder mit der Diagnose »Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung« (ADHS) nimmt zu. Die Zahl der Menschen mit der Diagnose »Burn-out« nimmt auch zu. Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt wächst mit zweistelligen Raten. Und unter den Alten greift die Demenz um sich. Störungen, die das betreffen, was früher die Seele geheißen hat, laufen anderen Krankheiten allmählich den Rang ab. Gleichzeitig wächst die Gesundmachmaschine. Allerdings gerade in diesen Bereichen, in denen die Psyche Schäden aufweist, ohne große Erfolge. Eher gilt: In dem Maße, wie die Kosten wachsen, nehmen wahrscheinlich die Heilungserfolge ab. Man könnte denken, dass die Gesundmacher so etwas wie Bankrottverschleppung betreiben, was ja im Geschäftsbereich strafbar ist. Sie diagnostizieren, verschreiben – ohne ihr Scheitern einzugestehen. Und meistens, ohne nach den gesellschaftlichen Ursachen zu fragen.
Die Frage nach den gesellschaftlichen Verknüpfungen, in denen Burn-out, Depression, Demenz und ADHS losbrechen, wird geradezu tabuisiert und als »Einzelschicksal« verrechnet. Das Leiden der Menschen an unerträglich werdenden Lebensumständen wird privatisiert und in die ärztliche Praxis getragen, wo dann im Zweifelsfall durch den Verweis auf irgendwelche genetischen Schäden die erdrückenden Lebensbedingungen von jeder Schuld freigesprochen werden: »Du lebst falsch«, oder »Du hast schlechte genetische Ausgangsbedingungen«. Zukünftig werden in den Arztpraxen immer häufiger Geräte mit Biomarkern stehen, die den Menschen vorrechnen, welche biologischen Anlagen zwangsläufig zu Depression oder Demenz führen müssen. Nach der Erfahrung von Hektik, Druck, Einsamkeit, Armut, Überlastung muss nicht mehr gefragt werden, wenn man die Biomarker hat. Man fügt sich in sein Schicksal. Christopher Lauer, für die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus, setzt diese Privatisierung und Entpolitisierung von Krankheit konsequent fort, wenn er sagt: »Ich habe ADHS – und das ist gut so.« Man fragt sich, wann die Sätze folgen: Ich bin depressiv – und das ist auch gut so. Ich bin dement – und das ist auch gut so. Ich habe Krebs – und das ist auch gut so.
Man könnte den Sätzen ja sogar etwas abgewinnen, wenn sie den offensiven Umgang mit dem signalisieren würden, was man an Leiden erfährt, die man sich zu erklären versucht. Aber Christopher Lauer scheint das, was ist, kurzerhand heiligzusprechen – letztes Einverständnis mit der versteinerten Gewalt, die gesellschaftlich erfahren, aber nicht mehr verstanden wird. »Ich nehme Methylphenidat. Dies ist der Name eines Präparates, welches einem breiteren Publikum unter dem Handelsnamen ›Ritalin‹ bekannt geworden ist. Allerdings gibt es Generika diverser Firmen. Wichtig ist: Ich nehme Methylphenidat wegen und nicht gegen ADHS. Ich empfinde es als großes Glück, 27 Jahre normal gelebt zu haben und durch das Medikament für 2,5 Stunden oder länger in eine Welt eintauchen zu können, die mir vorher verschlossen war. Ich bin gelassener, und es macht meinen Alltag, insbesondere im Umgang mit anderen Menschen, einfacher. Das bedeutet nicht, dass ich ohne das Medikament nicht mehr klarkommen würde. Die Einnahme von Methylphenidat ist ein bewusster Akt und ein Zugeständnis an eine Gesellschaft, in der 95% der Menschen eben kein ADHS haben.
Mit meinem Schritt in die Öffentlichkeit möchte ich andere ADHSler dazu bewegen, mutig, selbstbewusst und offen mit diesem Zustand umzugehen. Vor allem möchte ich, dass in der öffentlichen Diskussion die Vorteile von ADHS in den Vordergrund rücken. Nichtlineares, asynchrones Denken ist eine Bereicherung für alle. ADHS im Erwachsenenalter ist ein wichtiges Thema. Ich bin wegen, nicht trotz ADHS so, wie ich bin.
Ich habe ADHS – und das ist auch gut so.«[26]